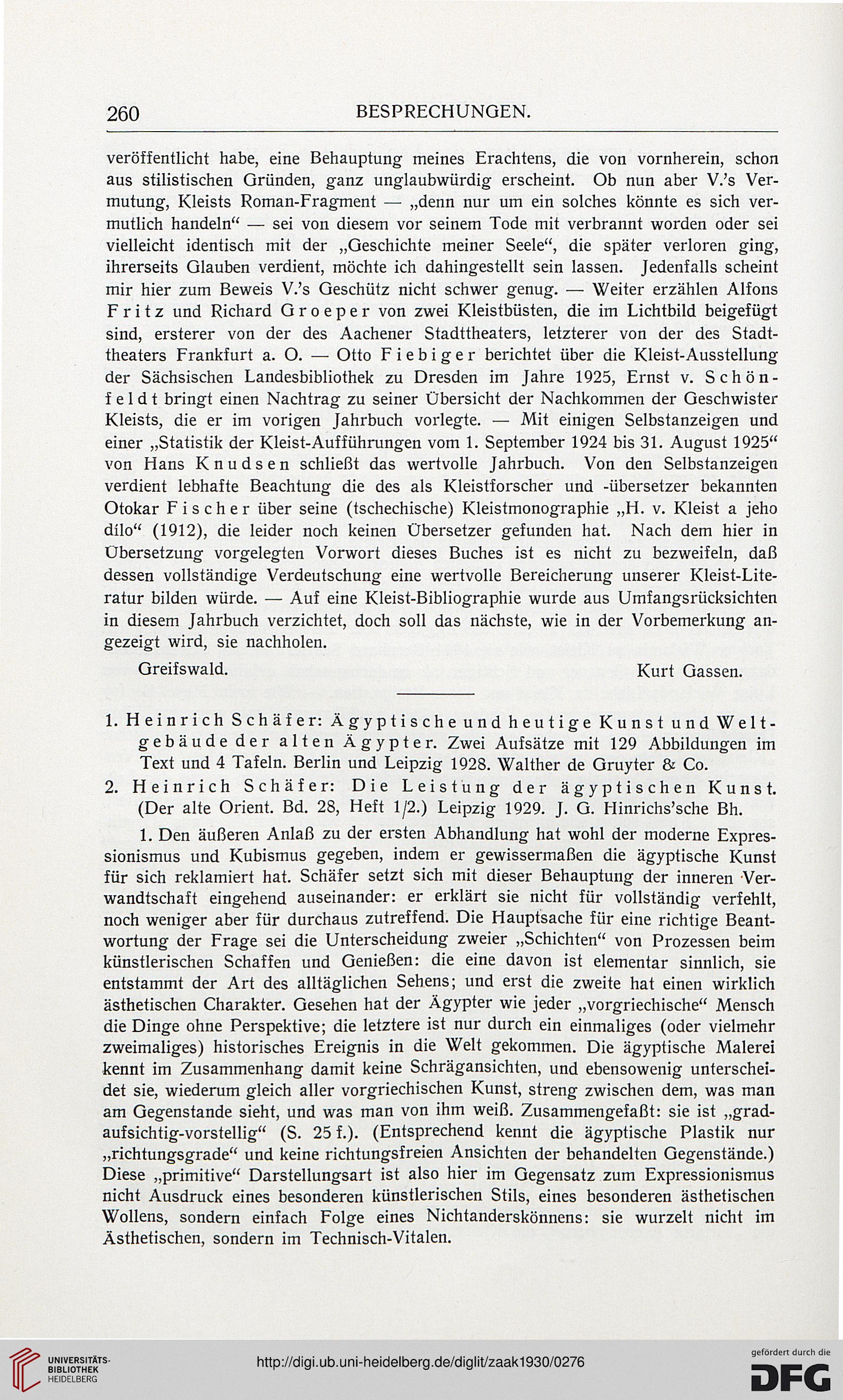260
BESPRECHUNGEN.
veröffentlicht habe, eine Behauptung meines Erachtens, die von vornherein, schon
aus stilistischen Gründen, ganz unglaubwürdig erscheint. Ob nun aber V.'s Ver-
mutung, Kleists Roman-Fragment — „denn nur um ein solches könnte es sich ver-
mutlich handeln" — sei von diesem vor seinem Tode mit verbrannt worden oder sei
vielleicht identisch mit der „Geschichte meiner Seele", die später verloren ging,
ihrerseits Glauben verdient, möchte ich dahingestellt sein lassen. Jedenfalls scheint
mir hier zum Beweis V.'s Geschütz nicht schwer genug. — Weiter erzählen Alfons
Fritz und Richard G r o e p e r von zwei Kleistbüsten, die im Lichtbild beigefügt
sind, ersterer von der des Aachener Stadttheaters, letzterer von der des Stadt-
theaters Frankfurt a. O. — Otto F i e b i g e r berichtet über die Kleist-Ausstellung
der Sächsischen Landesbibliothek zu Dresden im Jahre 1925, Ernst v. Schön-
fei d t bringt einen Nachtrag zu seiner Obersicht der Nachkommen der Geschwister
Kleists, die er im vorigen Jahrbuch vorlegte. — Mit einigen Selbstanzeigen und
einer „Statistik der Kleist-Aufführungen vom 1. September 1924 bis 31. August 1925"
von Hans Knudsen schließt das wertvolle Jahrbuch. Von den Selbstanzeigen
verdient lebhafte Beachtung die des als Kleistforscher und -Übersetzer bekannten
Otokar Fischer über seine (tschechische) Kleistmonographie ,,H. v. Kleist a jeho
düo" (1912), die leider noch keinen Übersetzer gefunden hat. Nach dem hier in
Übersetzung vorgelegten Vorwort dieses Buches ist es nicht zu bezweifeln, daß
dessen vollständige Verdeutschung eine wertvolle Bereicherung unserer Kleist-Lite-
ratur bilden würde. — Auf eine Kleist-Bibliographie wurde aus Umfangsrücksichten
in diesem Jahrbuch verzichtet, doch soll das nächste, wie in der Vorbemerkung an-
gezeigt wird, sie nachholen.
Greifswald. Kurt Gassen.
1. Heinrich Schäfer: Ägyptische und heutige Kunst und Welt-
gebäude der alten Ägypter. Zwei Aufsätze mit 129 Abbildungen im
Text und 4 Tafeln. Berlin und Leipzig 1928. Walther de Gruyter & Co.
2. Heinrich Schäfer: Die Leistung der ägyptischen Kunst.
(Der alte Orient. Bd. 28, Heft 1/2.) Leipzig 1929. J. G. Hinrichs'sche Bh.
1. Den äußeren Anlaß zu der ersten Abhandlung hat wohl der moderne Expres-
sionismus und Kubismus gegeben, indem er gewissermaßen die ägyptische Kunst
für sich reklamiert hat. Schäfer setzt sich mit dieser Behauptung der inneren Ver-
wandtschaft eingehend auseinander: er erklärt sie nicht für vollständig verfehlt,
noch weniger aber für durchaus zutreffend. Die Hauptsache für eine richtige Beant-
wortung der Frage sei die Unterscheidung zweier „Schichten" von Prozessen beim
künstlerischen Schaffen und Genießen: die eine davon ist elementar sinnlich, sie
entstammt der Art des alltäglichen Sehens; und erst die zweite hat einen wirklich
ästhetischen Charakter. Gesehen hat der Ägypter wie jeder „vorgriechische" Mensch
die Dinge ohne Perspektive; die letztere ist nur durch ein einmaliges (oder vielmehr
zweimaliges) historisches Ereignis in die Welt gekommen. Die ägyptische Malerei
kennt im Zusammenhang damit keine Schrägansichten, und ebensowenig unterschei-
det sie, wiederum gleich aller vorgriechischen Kunst, streng zwischen dem, was man
am Gegenstande sieht, und was man von ihm weiß. Zusammengefaßt: sie ist „grad-
aufsichtig-vorstellig" (S. 25 f.). (Entsprechend kennt die ägyptische Plastik nur
„richtungsgrade" und keine richtungsfreien Ansichten der behandelten Gegenstände.)
Diese „primitive" Darstellungsart ist also hier im Gegensatz zum Expressionismus
nicht Ausdruck eines besonderen künstlerischen Stils, eines besonderen ästhetischen
Wollens, sondern einfach Folge eines Nichtanderskönnens: sie wurzelt nicht im
Ästhetischen, sondern im Technisch-Vitalen.
BESPRECHUNGEN.
veröffentlicht habe, eine Behauptung meines Erachtens, die von vornherein, schon
aus stilistischen Gründen, ganz unglaubwürdig erscheint. Ob nun aber V.'s Ver-
mutung, Kleists Roman-Fragment — „denn nur um ein solches könnte es sich ver-
mutlich handeln" — sei von diesem vor seinem Tode mit verbrannt worden oder sei
vielleicht identisch mit der „Geschichte meiner Seele", die später verloren ging,
ihrerseits Glauben verdient, möchte ich dahingestellt sein lassen. Jedenfalls scheint
mir hier zum Beweis V.'s Geschütz nicht schwer genug. — Weiter erzählen Alfons
Fritz und Richard G r o e p e r von zwei Kleistbüsten, die im Lichtbild beigefügt
sind, ersterer von der des Aachener Stadttheaters, letzterer von der des Stadt-
theaters Frankfurt a. O. — Otto F i e b i g e r berichtet über die Kleist-Ausstellung
der Sächsischen Landesbibliothek zu Dresden im Jahre 1925, Ernst v. Schön-
fei d t bringt einen Nachtrag zu seiner Obersicht der Nachkommen der Geschwister
Kleists, die er im vorigen Jahrbuch vorlegte. — Mit einigen Selbstanzeigen und
einer „Statistik der Kleist-Aufführungen vom 1. September 1924 bis 31. August 1925"
von Hans Knudsen schließt das wertvolle Jahrbuch. Von den Selbstanzeigen
verdient lebhafte Beachtung die des als Kleistforscher und -Übersetzer bekannten
Otokar Fischer über seine (tschechische) Kleistmonographie ,,H. v. Kleist a jeho
düo" (1912), die leider noch keinen Übersetzer gefunden hat. Nach dem hier in
Übersetzung vorgelegten Vorwort dieses Buches ist es nicht zu bezweifeln, daß
dessen vollständige Verdeutschung eine wertvolle Bereicherung unserer Kleist-Lite-
ratur bilden würde. — Auf eine Kleist-Bibliographie wurde aus Umfangsrücksichten
in diesem Jahrbuch verzichtet, doch soll das nächste, wie in der Vorbemerkung an-
gezeigt wird, sie nachholen.
Greifswald. Kurt Gassen.
1. Heinrich Schäfer: Ägyptische und heutige Kunst und Welt-
gebäude der alten Ägypter. Zwei Aufsätze mit 129 Abbildungen im
Text und 4 Tafeln. Berlin und Leipzig 1928. Walther de Gruyter & Co.
2. Heinrich Schäfer: Die Leistung der ägyptischen Kunst.
(Der alte Orient. Bd. 28, Heft 1/2.) Leipzig 1929. J. G. Hinrichs'sche Bh.
1. Den äußeren Anlaß zu der ersten Abhandlung hat wohl der moderne Expres-
sionismus und Kubismus gegeben, indem er gewissermaßen die ägyptische Kunst
für sich reklamiert hat. Schäfer setzt sich mit dieser Behauptung der inneren Ver-
wandtschaft eingehend auseinander: er erklärt sie nicht für vollständig verfehlt,
noch weniger aber für durchaus zutreffend. Die Hauptsache für eine richtige Beant-
wortung der Frage sei die Unterscheidung zweier „Schichten" von Prozessen beim
künstlerischen Schaffen und Genießen: die eine davon ist elementar sinnlich, sie
entstammt der Art des alltäglichen Sehens; und erst die zweite hat einen wirklich
ästhetischen Charakter. Gesehen hat der Ägypter wie jeder „vorgriechische" Mensch
die Dinge ohne Perspektive; die letztere ist nur durch ein einmaliges (oder vielmehr
zweimaliges) historisches Ereignis in die Welt gekommen. Die ägyptische Malerei
kennt im Zusammenhang damit keine Schrägansichten, und ebensowenig unterschei-
det sie, wiederum gleich aller vorgriechischen Kunst, streng zwischen dem, was man
am Gegenstande sieht, und was man von ihm weiß. Zusammengefaßt: sie ist „grad-
aufsichtig-vorstellig" (S. 25 f.). (Entsprechend kennt die ägyptische Plastik nur
„richtungsgrade" und keine richtungsfreien Ansichten der behandelten Gegenstände.)
Diese „primitive" Darstellungsart ist also hier im Gegensatz zum Expressionismus
nicht Ausdruck eines besonderen künstlerischen Stils, eines besonderen ästhetischen
Wollens, sondern einfach Folge eines Nichtanderskönnens: sie wurzelt nicht im
Ästhetischen, sondern im Technisch-Vitalen.