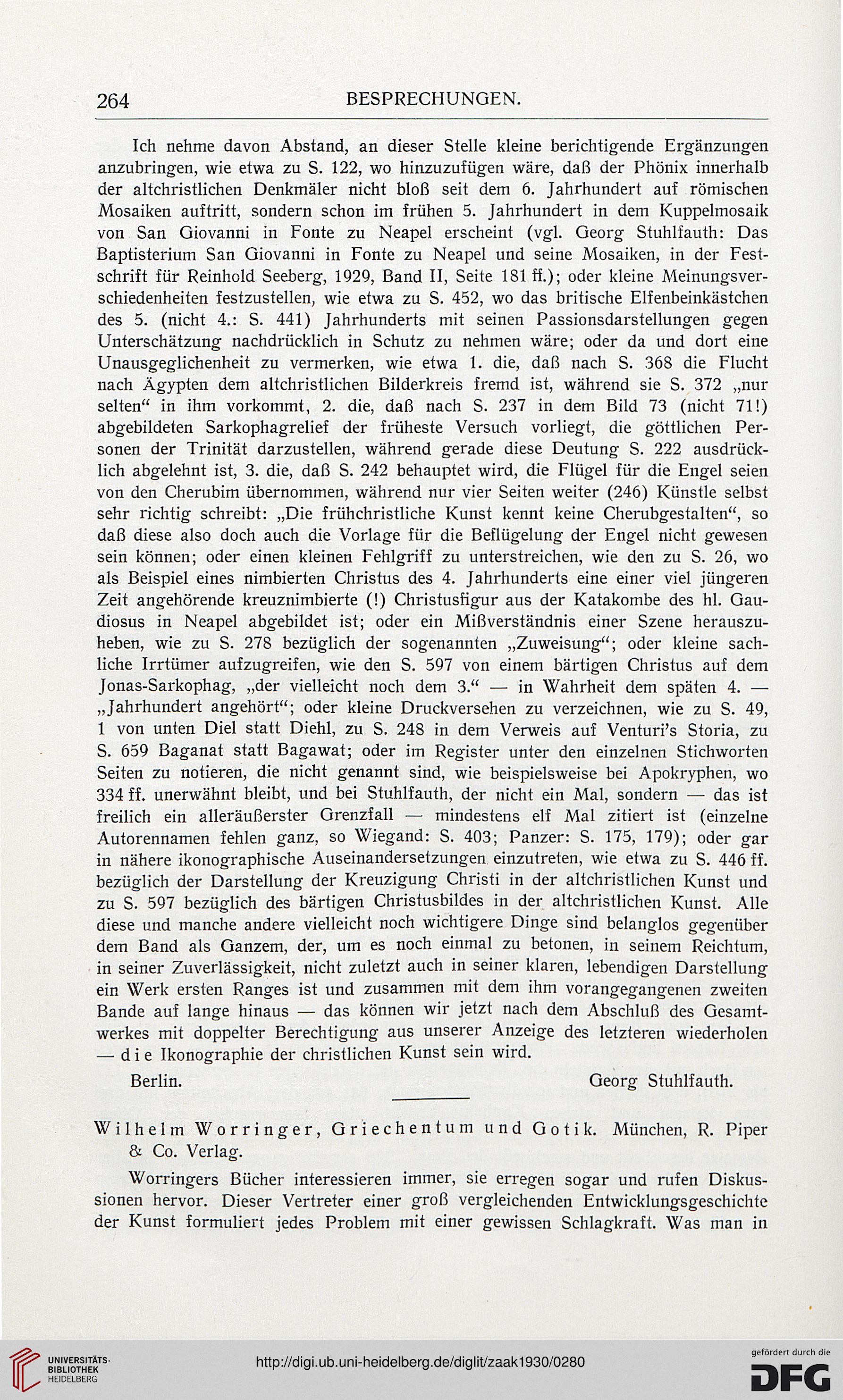264
BESPRECHUNGEN.
Ich nehme davon Abstand, an dieser Stelle kleine berichtigende Ergänzungen
anzubringen, wie etwa zu S. 122, wo hinzuzufügen wäre, daß der Phönix innerhalb
der altchristlichen Denkmäler nicht bloß seit dem 6. Jahrhundert auf römischen
Mosaiken auftritt, sondern schon im frühen 5. Jahrhundert in dem Kuppelmosaik
von San Giovanni in Fönte zu Neapel erscheint (vgl. Georg Stuhlfauth: Das
Baptisterium San Giovanni in Fönte zu Neapel und seine Mosaiken, in der Fest-
schrift für Reinhold Seeberg, 1929, Band II, Seite 181 ff.); oder kleine Meinungsver-
schiedenheiten festzustellen, wie etwa zu S. 452, wo das britische Elfenbeinkästchen
des 5. (nicht 4.: S. 441) Jahrhunderts mit seinen Passionsdarstellungen gegen
Unterschätzung nachdrücklich in Schutz zu nehmen wäre; oder da und dort eine
Unausgeglichenheit zu vermerken, wie etwa 1. die, daß nach S. 368 die Flucht
nach Ägypten dem altchristlichen Bilderkreis fremd ist, während sie S. 372 „nur
selten" in ihm vorkommt, 2. die, daß nach S. 237 in dem Bild 73 (nicht 71!)
abgebildeten Sarkophagrelief der früheste Versuch vorliegt, die göttlichen Per-
sonen der Trinität darzustellen, während gerade diese Deutung S. 222 ausdrück-
lich abgelehnt ist, 3. die, daß S. 242 behauptet wird, die Flügel für die Engel seien
von den Cherubim übernommen, während nur vier Seiten weiter (246) Künstle selbst
sehr richtig schreibt: „Die frühchristliche Kunst kennt keine Cherubgestalten", so
daß diese also doch auch die Vorlage für die Beflügelung der Engel nicht gewesen
sein können; oder einen kleinen Fehlgriff zu unterstreichen, wie den zu S. 26, wo
als Beispiel eines nimbierten Christus des 4. Jahrhunderts eine einer viel jüngeren
Zeit angehörende kreuznimbierte (!) Christusfigur aus der Katakombe des hl. Gau-
diosus in Neapel abgebildet ist; oder ein Mißverständnis einer Szene herauszu-
heben, wie zu S. 278 bezüglich der sogenannten „Zuweisung"; oder kleine sach-
liche Irrtümer aufzugreifen, wie den S. 597 von einem bärtigen Christus auf dem
Jonas-Sarkophag, „der vielleicht noch dem 3." — in Wahrheit dem späten 4. —
„Jahrhundert angehört"; oder kleine Druckversehen zu verzeichnen, wie zu S. 49,
1 von unten Diel statt Diehl, zu S. 248 in dem Verweis auf Venturi's Storia, zu
S. 659 Baganat statt Bagawat; oder im Register unter den einzelnen Stichworten
Seiten zu notieren, die nicht genannt sind, wie beispielsweise bei Apokryphen, wo
334 ff. unerwähnt bleibt, und bei Stuhlfauth, der nicht ein Mal, sondern — das ist
freilich ein alleräußerster Grenzfall — mindestens elf Mal zitiert ist (einzelne
Autorennamen fehlen ganz, so Wiegand: S. 403; Panzer: S. 175, 179); oder gar
in nähere ikonographische Auseinandersetzungen einzutreten, wie etwa zu S. 446 ff.
bezüglich der Darstellung der Kreuzigung Christi in der altchristlichen Kunst und
zu S. 597 bezüglich des bärtigen Christusbildes in der altchristlichen Kunst. Alle
diese und manche andere vielleicht noch wichtigere Dinge sind belanglos gegenüber
dem Band als Ganzem, der, um es noch einmal zu betonen, in seinem Reichtum,
in seiner Zuverlässigkeit, nicht zuletzt auch in seiner klaren, lebendigen Darstellung
ein Werk ersten Ranges ist und zusammen mit dem ihm vorangegangenen zweiten
Bande auf lange hinaus — das können wir jetzt nach dem Abschluß des Gesamt-
werkes mit doppelter Berechtigung aus unserer Anzeige des letzteren wiederholen
— die Ikonographie der christlichen Kunst sein wird.
Berlin. Georg Stuhlfauth.
Wilhelm Worringer, Griechentum und Gotik. München, R. Piper
& Co. Verlag.
Worringers Bücher interessieren immer, sie erregen sogar und rufen Diskus-
sionen hervor. Dieser Vertreter einer groß vergleichenden Entwicklungsgeschichte
der Kunst formuliert jedes Problem mit einer gewissen Schlagkraft. Was man in
BESPRECHUNGEN.
Ich nehme davon Abstand, an dieser Stelle kleine berichtigende Ergänzungen
anzubringen, wie etwa zu S. 122, wo hinzuzufügen wäre, daß der Phönix innerhalb
der altchristlichen Denkmäler nicht bloß seit dem 6. Jahrhundert auf römischen
Mosaiken auftritt, sondern schon im frühen 5. Jahrhundert in dem Kuppelmosaik
von San Giovanni in Fönte zu Neapel erscheint (vgl. Georg Stuhlfauth: Das
Baptisterium San Giovanni in Fönte zu Neapel und seine Mosaiken, in der Fest-
schrift für Reinhold Seeberg, 1929, Band II, Seite 181 ff.); oder kleine Meinungsver-
schiedenheiten festzustellen, wie etwa zu S. 452, wo das britische Elfenbeinkästchen
des 5. (nicht 4.: S. 441) Jahrhunderts mit seinen Passionsdarstellungen gegen
Unterschätzung nachdrücklich in Schutz zu nehmen wäre; oder da und dort eine
Unausgeglichenheit zu vermerken, wie etwa 1. die, daß nach S. 368 die Flucht
nach Ägypten dem altchristlichen Bilderkreis fremd ist, während sie S. 372 „nur
selten" in ihm vorkommt, 2. die, daß nach S. 237 in dem Bild 73 (nicht 71!)
abgebildeten Sarkophagrelief der früheste Versuch vorliegt, die göttlichen Per-
sonen der Trinität darzustellen, während gerade diese Deutung S. 222 ausdrück-
lich abgelehnt ist, 3. die, daß S. 242 behauptet wird, die Flügel für die Engel seien
von den Cherubim übernommen, während nur vier Seiten weiter (246) Künstle selbst
sehr richtig schreibt: „Die frühchristliche Kunst kennt keine Cherubgestalten", so
daß diese also doch auch die Vorlage für die Beflügelung der Engel nicht gewesen
sein können; oder einen kleinen Fehlgriff zu unterstreichen, wie den zu S. 26, wo
als Beispiel eines nimbierten Christus des 4. Jahrhunderts eine einer viel jüngeren
Zeit angehörende kreuznimbierte (!) Christusfigur aus der Katakombe des hl. Gau-
diosus in Neapel abgebildet ist; oder ein Mißverständnis einer Szene herauszu-
heben, wie zu S. 278 bezüglich der sogenannten „Zuweisung"; oder kleine sach-
liche Irrtümer aufzugreifen, wie den S. 597 von einem bärtigen Christus auf dem
Jonas-Sarkophag, „der vielleicht noch dem 3." — in Wahrheit dem späten 4. —
„Jahrhundert angehört"; oder kleine Druckversehen zu verzeichnen, wie zu S. 49,
1 von unten Diel statt Diehl, zu S. 248 in dem Verweis auf Venturi's Storia, zu
S. 659 Baganat statt Bagawat; oder im Register unter den einzelnen Stichworten
Seiten zu notieren, die nicht genannt sind, wie beispielsweise bei Apokryphen, wo
334 ff. unerwähnt bleibt, und bei Stuhlfauth, der nicht ein Mal, sondern — das ist
freilich ein alleräußerster Grenzfall — mindestens elf Mal zitiert ist (einzelne
Autorennamen fehlen ganz, so Wiegand: S. 403; Panzer: S. 175, 179); oder gar
in nähere ikonographische Auseinandersetzungen einzutreten, wie etwa zu S. 446 ff.
bezüglich der Darstellung der Kreuzigung Christi in der altchristlichen Kunst und
zu S. 597 bezüglich des bärtigen Christusbildes in der altchristlichen Kunst. Alle
diese und manche andere vielleicht noch wichtigere Dinge sind belanglos gegenüber
dem Band als Ganzem, der, um es noch einmal zu betonen, in seinem Reichtum,
in seiner Zuverlässigkeit, nicht zuletzt auch in seiner klaren, lebendigen Darstellung
ein Werk ersten Ranges ist und zusammen mit dem ihm vorangegangenen zweiten
Bande auf lange hinaus — das können wir jetzt nach dem Abschluß des Gesamt-
werkes mit doppelter Berechtigung aus unserer Anzeige des letzteren wiederholen
— die Ikonographie der christlichen Kunst sein wird.
Berlin. Georg Stuhlfauth.
Wilhelm Worringer, Griechentum und Gotik. München, R. Piper
& Co. Verlag.
Worringers Bücher interessieren immer, sie erregen sogar und rufen Diskus-
sionen hervor. Dieser Vertreter einer groß vergleichenden Entwicklungsgeschichte
der Kunst formuliert jedes Problem mit einer gewissen Schlagkraft. Was man in