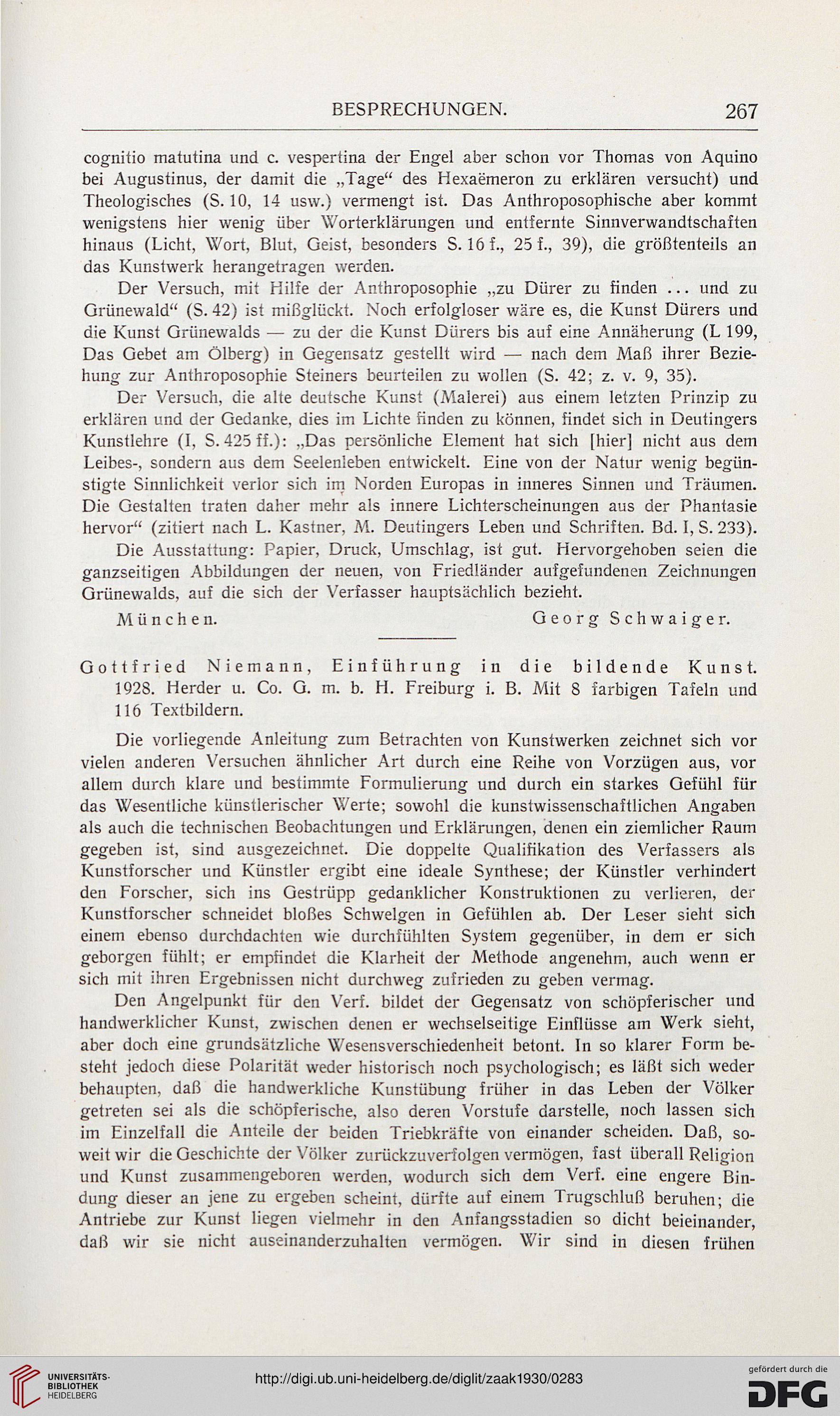BESPRECHUNGEN.
267
cognitio matutina und c. vespertina der Engel aber schon vor Thomas von Aquino
bei Augustinus, der damit die „Tage" des Hexaemeron zu erklären versucht) und
Theologisches (S. 10, 14 usw.) vermengt ist. Das Anthroposophische aber kommt
wenigstens hier wenig über Worterklärungen und entfernte Sinnverwandtschaften
hinaus (Licht, Wort, Blut, Geist, besonders S. 16 f., 25 f., 39), die größtenteils an
das Kunstwerk herangetragen werden.
Der Versuch, mit Hilfe der Anthroposophie „zu Dürer zu finden ... und zu
Grünevvald" (S. 42) ist mißglückt. Noch erfolgloser wäre es, die Kunst Dürers und
die Kunst Grünewalds — zu der die Kunst Dürers bis auf eine Annäherung (L 199,
Das Gebet am Ölberg) in Gegensatz gestellt wird — nach dem Maß ihrer Bezie-
hung zur Anthroposophie Steiners beurteilen zu wollen (S. 42; z. v. 9, 35).
Der Versuch, die alte deutsche Kunst (Malerei) aus einem letzten Prinzip zu
erklären und der Gedanke, dies im Lichte finden zu können, findet sich in Deutingers
Kunstlehre (I, S. 425 ff.): „Das persönliche Element hat sich [hier] nicht aus dem
Leibes-, sondern aus dem Seelenleben entwickelt. Eine von der Natur wenig begün-
stigte Sinnlichkeit verlor sich im Norden Europas in inneres Sinnen und Träumen.
Die Gestalten traten daher mehr als innere Lichterscheinungen aus der Phantasie
hervor" (zitiert nach L. Kastner, M. Deutingers Leben und Schriften. Bd. I, S. 233).
Die Ausstattung: Papier, Druck, Umschlag, ist gut. Hervorgehoben seien die
ganzseitigen Abbildungen der neuen, von Friedländer aufgefundenen Zeichnungen
Grünewalds, auf die sich der Verfasser hauptsächlich bezieht.
München. GeorgSchwaiger.
Gottfried Niemann, Einführung in die bildende Kunst.
1928. Herder u. Co. G. m. b. H. Freiburg i. B. Mit 8 farbigen Tafeln und
116 Textbildern.
Die vorliegende Anleitung zum Betrachten von Kunstwerken zeichnet sich vor
vielen anderen Versuchen ähnlicher Art durch eine Reihe von Vorzügen aus, vor
allem durch klare und bestimmte Formulierung und durch ein starkes Gefühl für
das Wesentliche künstlerischer Werte; sowohl die kunstwissenschaftlichen Angaben
als auch die technischen Beobachtungen und Erklärungen, denen ein ziemlicher Raum
gegeben ist, sind ausgezeichnet. Die doppelte Qualifikation des Verfassers als
Kunstforscher und Künstler ergibt eine ideale Synthese; der Künstler verhindert
den Forscher, sich ins Gestrüpp gedanklicher Konstruktionen zu verlieren, der
Kunstforscher schneidet bloßes Schwelgen in Gefühlen ab. Der Leser sieht sich
einem ebenso durchdachten wie durchfühlten System gegenüber, in dem er sich
geborgen fühlt; er empfindet die Klarheit der Methode angenehm, auch wenn er
sich mit ihren Ergebnissen nicht durchweg zufrieden zu geben vermag.
Den Angelpunkt für den Verf. bildet der Gegensatz von schöpferischer und
handwerklicher Kunst, zwischen denen er wechselseitige Einflüsse am Werk sieht,
aber doch eine grundsätzliche Wesensverschiedenheit betont. In so klarer Form be-
steht jedoch diese Polarität weder historisch noch psychologisch; es läßt sich weder
behaupten, daß die handwerkliche Kunstübung früher in das Leben der Völker
getreten sei als die schöpferische, also deren Vorstufe darstelle, noch lassen sich
im Einzelfall die Anteile der beiden Triebkräfte von einander scheiden. Daß, so-
weit wir die Geschichte der Völker zurückzuverfolgen vermögen, fast überall Religion
und Kunst zusammengeboren werden, wodurch sich dem Verf. eine engere Bin-
dung dieser an jene zu ergeben scheint, dürfte auf einem Trugschluß beruhen; die
Antriebe zur Kunst liegen vielmehr in den Anfangsstadien so dicht beieinander,
daß wir sie nicht auseinanderzuhalten vermögen. Wir sind in diesen frühen
267
cognitio matutina und c. vespertina der Engel aber schon vor Thomas von Aquino
bei Augustinus, der damit die „Tage" des Hexaemeron zu erklären versucht) und
Theologisches (S. 10, 14 usw.) vermengt ist. Das Anthroposophische aber kommt
wenigstens hier wenig über Worterklärungen und entfernte Sinnverwandtschaften
hinaus (Licht, Wort, Blut, Geist, besonders S. 16 f., 25 f., 39), die größtenteils an
das Kunstwerk herangetragen werden.
Der Versuch, mit Hilfe der Anthroposophie „zu Dürer zu finden ... und zu
Grünevvald" (S. 42) ist mißglückt. Noch erfolgloser wäre es, die Kunst Dürers und
die Kunst Grünewalds — zu der die Kunst Dürers bis auf eine Annäherung (L 199,
Das Gebet am Ölberg) in Gegensatz gestellt wird — nach dem Maß ihrer Bezie-
hung zur Anthroposophie Steiners beurteilen zu wollen (S. 42; z. v. 9, 35).
Der Versuch, die alte deutsche Kunst (Malerei) aus einem letzten Prinzip zu
erklären und der Gedanke, dies im Lichte finden zu können, findet sich in Deutingers
Kunstlehre (I, S. 425 ff.): „Das persönliche Element hat sich [hier] nicht aus dem
Leibes-, sondern aus dem Seelenleben entwickelt. Eine von der Natur wenig begün-
stigte Sinnlichkeit verlor sich im Norden Europas in inneres Sinnen und Träumen.
Die Gestalten traten daher mehr als innere Lichterscheinungen aus der Phantasie
hervor" (zitiert nach L. Kastner, M. Deutingers Leben und Schriften. Bd. I, S. 233).
Die Ausstattung: Papier, Druck, Umschlag, ist gut. Hervorgehoben seien die
ganzseitigen Abbildungen der neuen, von Friedländer aufgefundenen Zeichnungen
Grünewalds, auf die sich der Verfasser hauptsächlich bezieht.
München. GeorgSchwaiger.
Gottfried Niemann, Einführung in die bildende Kunst.
1928. Herder u. Co. G. m. b. H. Freiburg i. B. Mit 8 farbigen Tafeln und
116 Textbildern.
Die vorliegende Anleitung zum Betrachten von Kunstwerken zeichnet sich vor
vielen anderen Versuchen ähnlicher Art durch eine Reihe von Vorzügen aus, vor
allem durch klare und bestimmte Formulierung und durch ein starkes Gefühl für
das Wesentliche künstlerischer Werte; sowohl die kunstwissenschaftlichen Angaben
als auch die technischen Beobachtungen und Erklärungen, denen ein ziemlicher Raum
gegeben ist, sind ausgezeichnet. Die doppelte Qualifikation des Verfassers als
Kunstforscher und Künstler ergibt eine ideale Synthese; der Künstler verhindert
den Forscher, sich ins Gestrüpp gedanklicher Konstruktionen zu verlieren, der
Kunstforscher schneidet bloßes Schwelgen in Gefühlen ab. Der Leser sieht sich
einem ebenso durchdachten wie durchfühlten System gegenüber, in dem er sich
geborgen fühlt; er empfindet die Klarheit der Methode angenehm, auch wenn er
sich mit ihren Ergebnissen nicht durchweg zufrieden zu geben vermag.
Den Angelpunkt für den Verf. bildet der Gegensatz von schöpferischer und
handwerklicher Kunst, zwischen denen er wechselseitige Einflüsse am Werk sieht,
aber doch eine grundsätzliche Wesensverschiedenheit betont. In so klarer Form be-
steht jedoch diese Polarität weder historisch noch psychologisch; es läßt sich weder
behaupten, daß die handwerkliche Kunstübung früher in das Leben der Völker
getreten sei als die schöpferische, also deren Vorstufe darstelle, noch lassen sich
im Einzelfall die Anteile der beiden Triebkräfte von einander scheiden. Daß, so-
weit wir die Geschichte der Völker zurückzuverfolgen vermögen, fast überall Religion
und Kunst zusammengeboren werden, wodurch sich dem Verf. eine engere Bin-
dung dieser an jene zu ergeben scheint, dürfte auf einem Trugschluß beruhen; die
Antriebe zur Kunst liegen vielmehr in den Anfangsstadien so dicht beieinander,
daß wir sie nicht auseinanderzuhalten vermögen. Wir sind in diesen frühen