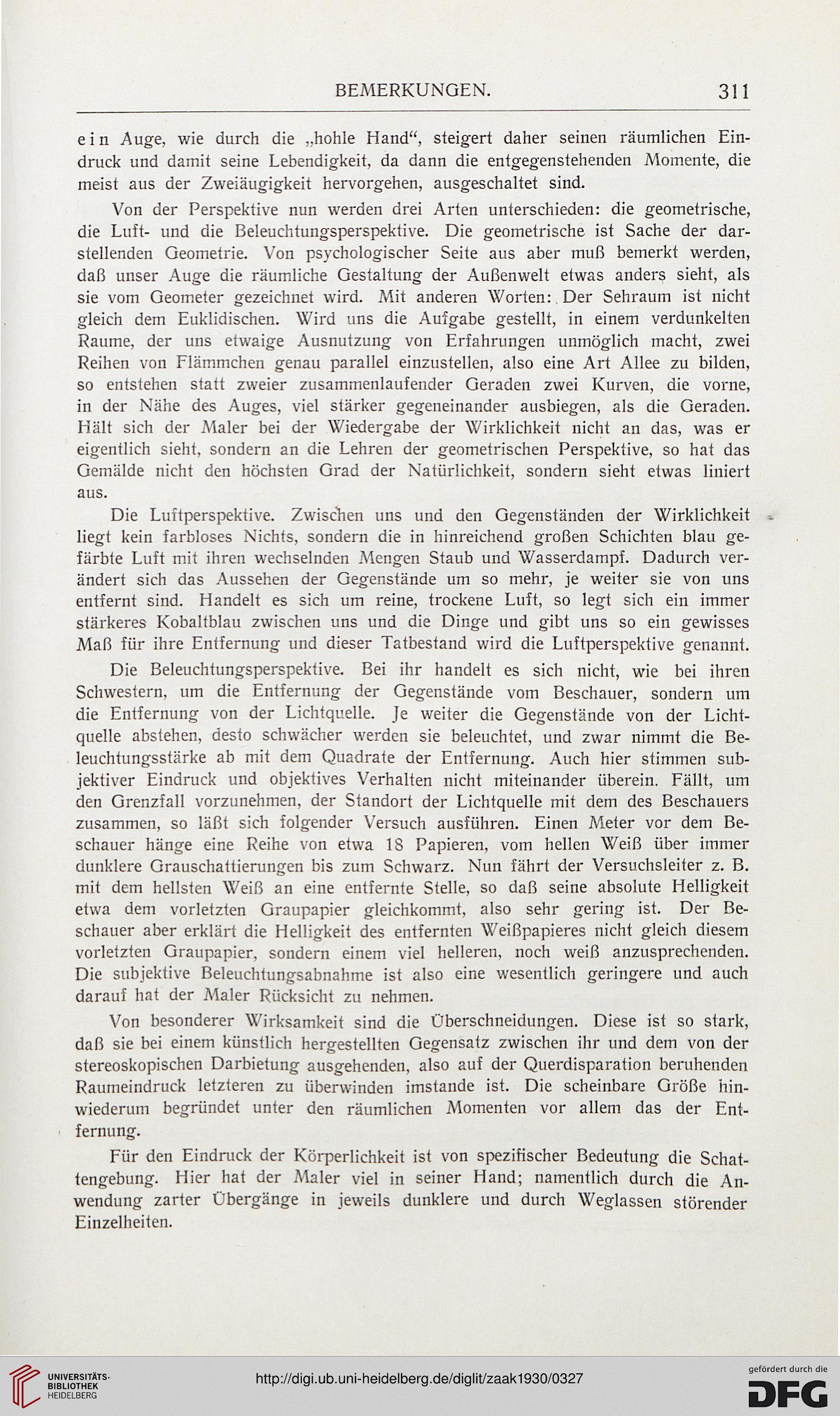BEMERKUNGEN.
311
ein Auge, wie durch die ,.hohle Hand", steigert daher seinen räumlichen Ein-
druck und damit seine Lebendigkeit, da dann die entgegenstehenden Momente, die
meist aus der Zweiäugigkeit hervorgehen, ausgeschaltet sind.
Von der Perspektive nun werden drei Arten unterschieden: die geometrische,
die Luft- und die Beleuchtungsperspektive. Die geometrische ist Sache der dar-
stellenden Geometrie. Von psychologischer Seite aus aber muß bemerkt werden,
daß unser Auge die räumliche Gestaltung der Außenwelt etwas anders sieht, als
sie vom Geometer gezeichnet wird. Mit anderen Worten: Der Sehraum ist nicht
gleich dem Euklidischen. Wird uns die Aufgabe gestellt, in einem verdunkelten
Räume, der uns etwaige Ausnutzung von Erfahrungen unmöglich macht, zwei
Reihen von Flämmchen genau parallel einzustellen, also eine Art Allee zu bilden,
so entstehen statt zweier zusammenlaufender Geraden zwei Kurven, die vorne,
in der Nähe des Auges, viel stärker gegeneinander ausbiegen, als die Geraden.
Hält sich der Maler bei der Wiedergabe der Wirklichkeit nicht an das, was er
eigentlich sieht, sondern an die Lehren der geometrischen Perspektive, so hat das
Gemälde nicht den höchsten Grad der Natürlichkeit, sondern sieht etwas liniert
aus.
Die Luftperspektive. Zwischen uns und den Gegenständen der Wirklichkeit -
liegt kein farbloses Nichts, sondern die in hinreichend großen Schichten blau ge-
färbte Luft mit ihren wechselnden Mengen Staub und Wasserdampf. Dadurch ver-
ändert sich das Aussehen der Gegenstände um so mehr, je weiter sie von uns
entfernt sind. Handelt es sich um reine, trockene Luft, so legt sich ein immer
stärkeres Kobaltblau zwischen uns und die Dinge und gibt uns so ein gewisses
Maß für ihre Entfernung und dieser Tatbestand wird die Luftperspektive genannt.
Die Beleuchtungsperspektive. Bei ihr handelt es sich nicht, wie bei ihren
Schwestern, um die Entfernung der Gegenstände vom Beschauer, sondern um
die Entfernung von der Lichtquelle. Je weiter die Gegenstände von der Licht-
quelle abstehen, desto schwächer werden sie beleuchtet, und zwar nimmt die Be-
leuchtungsstärke ab mit dem Quadrate der Entfernung. Auch hier stimmen sub-
jektiver Eindruck und objektives Verhalten nicht miteinander überein. Fällt, um
den Grenzfall vorzunehmen, der Standort der Lichtquelle mit dem des Beschauers
zusammen, so läßt sich folgender Versuch ausführen. Einen Meter vor dem Be-
schauer hänge eine Reihe von etwa 18 Papieren, vom hellen Weiß über immer
dunklere Grauschattierungen bis zum Schwarz. Nun fährt der Versuchsleiter z. B.
mit dem hellsten Weiß an eine entfernte Stelle, so daß seine absolute Helligkeit
etwa dem vorletzten Graupapier gleichkommt, also sehr gering ist. Der Be-
schauer aber erklärt die Helligkeit des entfernten Weißpapieres nicht gleich diesem
vorletzten Graupapier, sondern einem viel helleren, noch weiß anzusprechenden.
Die subjektive Beleuchtungsabnahme ist also eine wesentlich geringere und auch
darauf hat der Maler Rücksicht zu nehmen.
Von besonderer Wirksamkeit sind die Überschneidungen. Diese ist so stark,
daß sie bei einem künstlich hergestellten Gegensatz zwischen ihr und dem von der
stereoskopischen Darbietung ausgehenden, also auf der Querdisparation beruhenden
Raumeindruck letzteren zu überwinden imstande ist. Die scheinbare Größe hin-
wiederum begründet unter den räumlichen Momenten vor allem das der Ent-
fernung.
Für den Eindruck der Körperlichkeit ist von spezifischer Bedeutung die Schat-
tengebung. Hier hat der Maler viel in seiner Hand; namentlich durch die An-
wendung zarter Obergänge in jeweils dunklere und durch Weglassen störender
Einzelheiten.
311
ein Auge, wie durch die ,.hohle Hand", steigert daher seinen räumlichen Ein-
druck und damit seine Lebendigkeit, da dann die entgegenstehenden Momente, die
meist aus der Zweiäugigkeit hervorgehen, ausgeschaltet sind.
Von der Perspektive nun werden drei Arten unterschieden: die geometrische,
die Luft- und die Beleuchtungsperspektive. Die geometrische ist Sache der dar-
stellenden Geometrie. Von psychologischer Seite aus aber muß bemerkt werden,
daß unser Auge die räumliche Gestaltung der Außenwelt etwas anders sieht, als
sie vom Geometer gezeichnet wird. Mit anderen Worten: Der Sehraum ist nicht
gleich dem Euklidischen. Wird uns die Aufgabe gestellt, in einem verdunkelten
Räume, der uns etwaige Ausnutzung von Erfahrungen unmöglich macht, zwei
Reihen von Flämmchen genau parallel einzustellen, also eine Art Allee zu bilden,
so entstehen statt zweier zusammenlaufender Geraden zwei Kurven, die vorne,
in der Nähe des Auges, viel stärker gegeneinander ausbiegen, als die Geraden.
Hält sich der Maler bei der Wiedergabe der Wirklichkeit nicht an das, was er
eigentlich sieht, sondern an die Lehren der geometrischen Perspektive, so hat das
Gemälde nicht den höchsten Grad der Natürlichkeit, sondern sieht etwas liniert
aus.
Die Luftperspektive. Zwischen uns und den Gegenständen der Wirklichkeit -
liegt kein farbloses Nichts, sondern die in hinreichend großen Schichten blau ge-
färbte Luft mit ihren wechselnden Mengen Staub und Wasserdampf. Dadurch ver-
ändert sich das Aussehen der Gegenstände um so mehr, je weiter sie von uns
entfernt sind. Handelt es sich um reine, trockene Luft, so legt sich ein immer
stärkeres Kobaltblau zwischen uns und die Dinge und gibt uns so ein gewisses
Maß für ihre Entfernung und dieser Tatbestand wird die Luftperspektive genannt.
Die Beleuchtungsperspektive. Bei ihr handelt es sich nicht, wie bei ihren
Schwestern, um die Entfernung der Gegenstände vom Beschauer, sondern um
die Entfernung von der Lichtquelle. Je weiter die Gegenstände von der Licht-
quelle abstehen, desto schwächer werden sie beleuchtet, und zwar nimmt die Be-
leuchtungsstärke ab mit dem Quadrate der Entfernung. Auch hier stimmen sub-
jektiver Eindruck und objektives Verhalten nicht miteinander überein. Fällt, um
den Grenzfall vorzunehmen, der Standort der Lichtquelle mit dem des Beschauers
zusammen, so läßt sich folgender Versuch ausführen. Einen Meter vor dem Be-
schauer hänge eine Reihe von etwa 18 Papieren, vom hellen Weiß über immer
dunklere Grauschattierungen bis zum Schwarz. Nun fährt der Versuchsleiter z. B.
mit dem hellsten Weiß an eine entfernte Stelle, so daß seine absolute Helligkeit
etwa dem vorletzten Graupapier gleichkommt, also sehr gering ist. Der Be-
schauer aber erklärt die Helligkeit des entfernten Weißpapieres nicht gleich diesem
vorletzten Graupapier, sondern einem viel helleren, noch weiß anzusprechenden.
Die subjektive Beleuchtungsabnahme ist also eine wesentlich geringere und auch
darauf hat der Maler Rücksicht zu nehmen.
Von besonderer Wirksamkeit sind die Überschneidungen. Diese ist so stark,
daß sie bei einem künstlich hergestellten Gegensatz zwischen ihr und dem von der
stereoskopischen Darbietung ausgehenden, also auf der Querdisparation beruhenden
Raumeindruck letzteren zu überwinden imstande ist. Die scheinbare Größe hin-
wiederum begründet unter den räumlichen Momenten vor allem das der Ent-
fernung.
Für den Eindruck der Körperlichkeit ist von spezifischer Bedeutung die Schat-
tengebung. Hier hat der Maler viel in seiner Hand; namentlich durch die An-
wendung zarter Obergänge in jeweils dunklere und durch Weglassen störender
Einzelheiten.