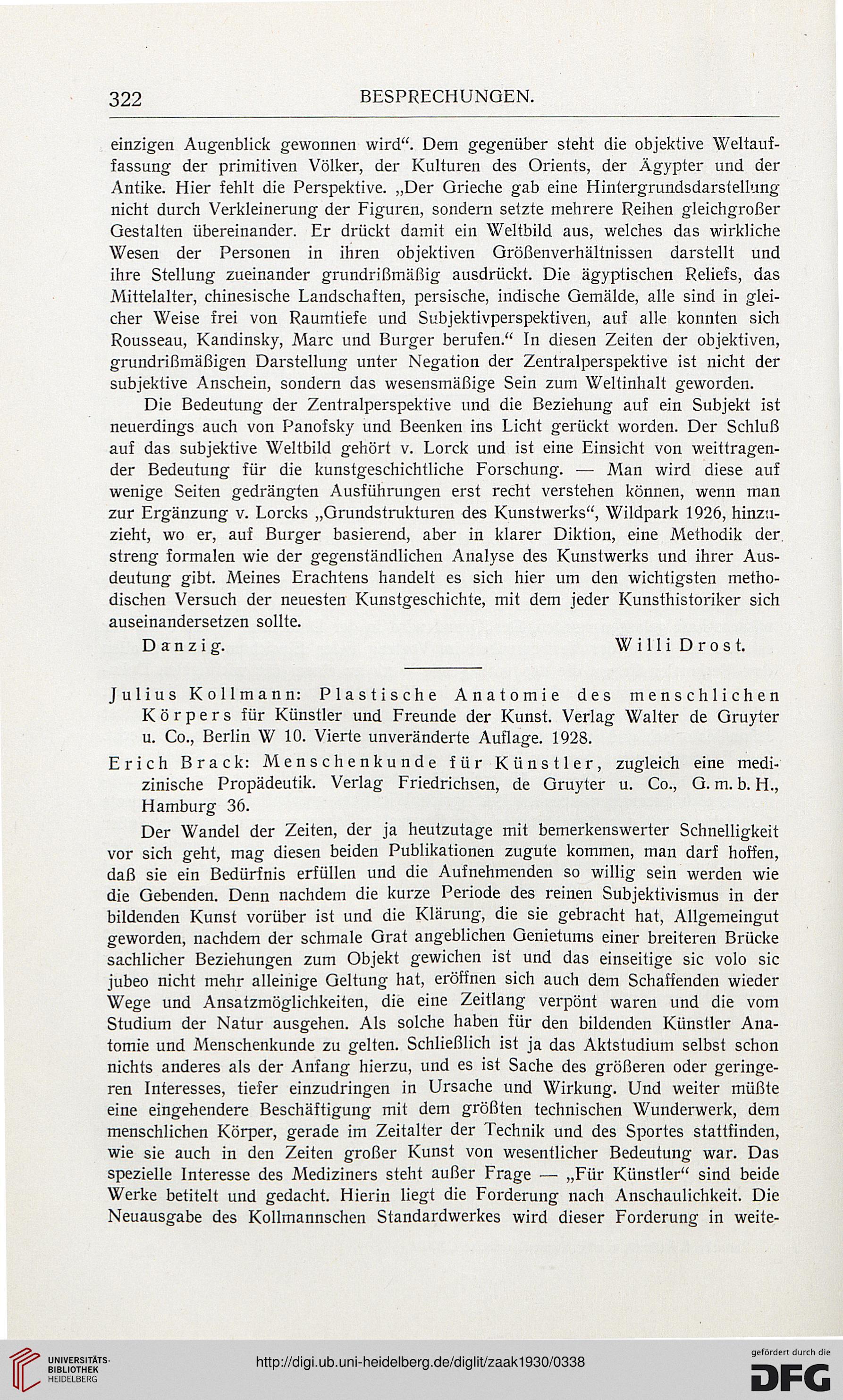322
BESPRECHUNGEN.
einzigen Augenblick gewonnen wird". Dem gegenüber steht die objektive Weltauf-
fassung der primitiven Völker, der Kulturen des Orients, der Ägypter und der
Antike. Hier fehlt die Perspektive. „Der Grieche gab eine Hintergrundsdarstellung
nicht durch Verkleinerung der Figuren, sondern setzte mehrere Reihen gleichgroßer
Gestalten übereinander. Er drückt damit ein Weltbild aus, welches das wirkliche
Wesen der Personen in ihren objektiven Größenverhältnissen darstellt und
ihre Stellung zueinander grundrißmäßig ausdrückt. Die ägyptischen Reliefs, das
Mittelalter, chinesische Landschaften, persische, indische Gemälde, alle sind in glei-
cher Weise frei von Raumtiefe und Subjektivperspektiven, auf alle konnten sich
Rousseau, Kandinsky, Marc und Burger berufen." In diesen Zeiten der objektiven,
grundrißmäßigen Darstellung unter Negation der Zentralperspektive ist nicht der
subjektive Anschein, sondern das wesensmäßige Sein zum Weltinhalt geworden.
Die Bedeutung der Zentralperspektive und die Beziehung auf ein Subjekt ist
neuerdings auch von Panofsky und Beenken ins Licht gerückt worden. Der Schluß
auf das subjektive Weltbild gehört v. Lorck und ist eine Einsicht von weittragen-
der Bedeutung für die kunstgeschichtliche Forschung. — Man wird diese auf
wenige Seiten gedrängten Ausführungen erst recht verstehen können, wenn man
zur Ergänzung v. Lorcks „Grundstrukturen des Kunstwerks", Wildpark 1926, hinzu-
zieht, wo er, auf Burger basierend, aber in klarer Diktion, eine Methodik der
streng formalen wie der gegenständlichen Analyse des Kunstwerks und ihrer Aus-
deutung gibt. Meines Erachtens handelt es sich hier um den wichtigsten metho-
dischen Versuch der neuesten Kunstgeschichte, mit dem jeder Kunsthistoriker sich
auseinandersetzen sollte.
Danzig. WilliDrost.
Julius Kollmann: Plastische Anatomie des menschlichen
Körpers für Künstler und Freunde der Kunst. Verlag Walter de Gruyter
u. Co., Berlin W 10. Vierte unveränderte Auflage. 1928.
Erich Brack: Menschenkunde für Künstler, zugleich eine medi-
zinische Propädeutik. Verlag Friedrichsen, de Gruyter u. Co., G. m. b. H.,
Hamburg 36.
Der Wandel der Zeiten, der ja heutzutage mit bemerkenswerter Schnelligkeit
vor sich geht, mag diesen beiden Publikationen zugute kommen, man darf hoffen,
daß sie ein Bedürfnis erfüllen und die Aufnehmenden so willig sein werden wie
die Gebenden. Denn nachdem die kurze Periode des reinen Subjektivismus in der
bildenden Kunst vorüber ist und die Klärung, die sie gebracht hat, Allgemeingut
geworden, nachdem der schmale Grat angeblichen Genietums einer breiteren Brücke
sachlicher Beziehungen zum Objekt gewichen ist und das einseitige sie volo sie
jubeo nicht mehr alleinige Geltung hat, eröffnen sich auch dem Schaffenden wieder
Wege und Ansatzmöglichkeiten, die eine Zeitlang verpönt waren und die vom
Studium der Natur ausgehen. Als solche haben für den bildenden Künstler Ana-
tomie und Menschenkunde zu gelten. Schließlich ist ja das Aktstudium selbst schon
nichts anderes als der Anfang hierzu, und es ist Sache des größeren oder geringe-
ren Interesses, tiefer einzudringen in Ursache und Wirkung. Und weiter müßte
eine eingehendere Beschäftigung mit dem größten technischen Wunderwerk, dem
menschlichen Körper, gerade im Zeitalter der Technik und des Sportes stattfinden,
wie sie auch in den Zeiten großer Kunst von wesentlicher Bedeutung war. Das
spezielle Interesse des Mediziners steht außer Frage — „Für Künstler" sind beide
Werke betitelt und gedacht. Hierin liegt die Forderung nach Anschaulichkeit. Die
Neuausgabe des Kollmannschen Standardwerkes wird dieser Forderung in weite-
BESPRECHUNGEN.
einzigen Augenblick gewonnen wird". Dem gegenüber steht die objektive Weltauf-
fassung der primitiven Völker, der Kulturen des Orients, der Ägypter und der
Antike. Hier fehlt die Perspektive. „Der Grieche gab eine Hintergrundsdarstellung
nicht durch Verkleinerung der Figuren, sondern setzte mehrere Reihen gleichgroßer
Gestalten übereinander. Er drückt damit ein Weltbild aus, welches das wirkliche
Wesen der Personen in ihren objektiven Größenverhältnissen darstellt und
ihre Stellung zueinander grundrißmäßig ausdrückt. Die ägyptischen Reliefs, das
Mittelalter, chinesische Landschaften, persische, indische Gemälde, alle sind in glei-
cher Weise frei von Raumtiefe und Subjektivperspektiven, auf alle konnten sich
Rousseau, Kandinsky, Marc und Burger berufen." In diesen Zeiten der objektiven,
grundrißmäßigen Darstellung unter Negation der Zentralperspektive ist nicht der
subjektive Anschein, sondern das wesensmäßige Sein zum Weltinhalt geworden.
Die Bedeutung der Zentralperspektive und die Beziehung auf ein Subjekt ist
neuerdings auch von Panofsky und Beenken ins Licht gerückt worden. Der Schluß
auf das subjektive Weltbild gehört v. Lorck und ist eine Einsicht von weittragen-
der Bedeutung für die kunstgeschichtliche Forschung. — Man wird diese auf
wenige Seiten gedrängten Ausführungen erst recht verstehen können, wenn man
zur Ergänzung v. Lorcks „Grundstrukturen des Kunstwerks", Wildpark 1926, hinzu-
zieht, wo er, auf Burger basierend, aber in klarer Diktion, eine Methodik der
streng formalen wie der gegenständlichen Analyse des Kunstwerks und ihrer Aus-
deutung gibt. Meines Erachtens handelt es sich hier um den wichtigsten metho-
dischen Versuch der neuesten Kunstgeschichte, mit dem jeder Kunsthistoriker sich
auseinandersetzen sollte.
Danzig. WilliDrost.
Julius Kollmann: Plastische Anatomie des menschlichen
Körpers für Künstler und Freunde der Kunst. Verlag Walter de Gruyter
u. Co., Berlin W 10. Vierte unveränderte Auflage. 1928.
Erich Brack: Menschenkunde für Künstler, zugleich eine medi-
zinische Propädeutik. Verlag Friedrichsen, de Gruyter u. Co., G. m. b. H.,
Hamburg 36.
Der Wandel der Zeiten, der ja heutzutage mit bemerkenswerter Schnelligkeit
vor sich geht, mag diesen beiden Publikationen zugute kommen, man darf hoffen,
daß sie ein Bedürfnis erfüllen und die Aufnehmenden so willig sein werden wie
die Gebenden. Denn nachdem die kurze Periode des reinen Subjektivismus in der
bildenden Kunst vorüber ist und die Klärung, die sie gebracht hat, Allgemeingut
geworden, nachdem der schmale Grat angeblichen Genietums einer breiteren Brücke
sachlicher Beziehungen zum Objekt gewichen ist und das einseitige sie volo sie
jubeo nicht mehr alleinige Geltung hat, eröffnen sich auch dem Schaffenden wieder
Wege und Ansatzmöglichkeiten, die eine Zeitlang verpönt waren und die vom
Studium der Natur ausgehen. Als solche haben für den bildenden Künstler Ana-
tomie und Menschenkunde zu gelten. Schließlich ist ja das Aktstudium selbst schon
nichts anderes als der Anfang hierzu, und es ist Sache des größeren oder geringe-
ren Interesses, tiefer einzudringen in Ursache und Wirkung. Und weiter müßte
eine eingehendere Beschäftigung mit dem größten technischen Wunderwerk, dem
menschlichen Körper, gerade im Zeitalter der Technik und des Sportes stattfinden,
wie sie auch in den Zeiten großer Kunst von wesentlicher Bedeutung war. Das
spezielle Interesse des Mediziners steht außer Frage — „Für Künstler" sind beide
Werke betitelt und gedacht. Hierin liegt die Forderung nach Anschaulichkeit. Die
Neuausgabe des Kollmannschen Standardwerkes wird dieser Forderung in weite-