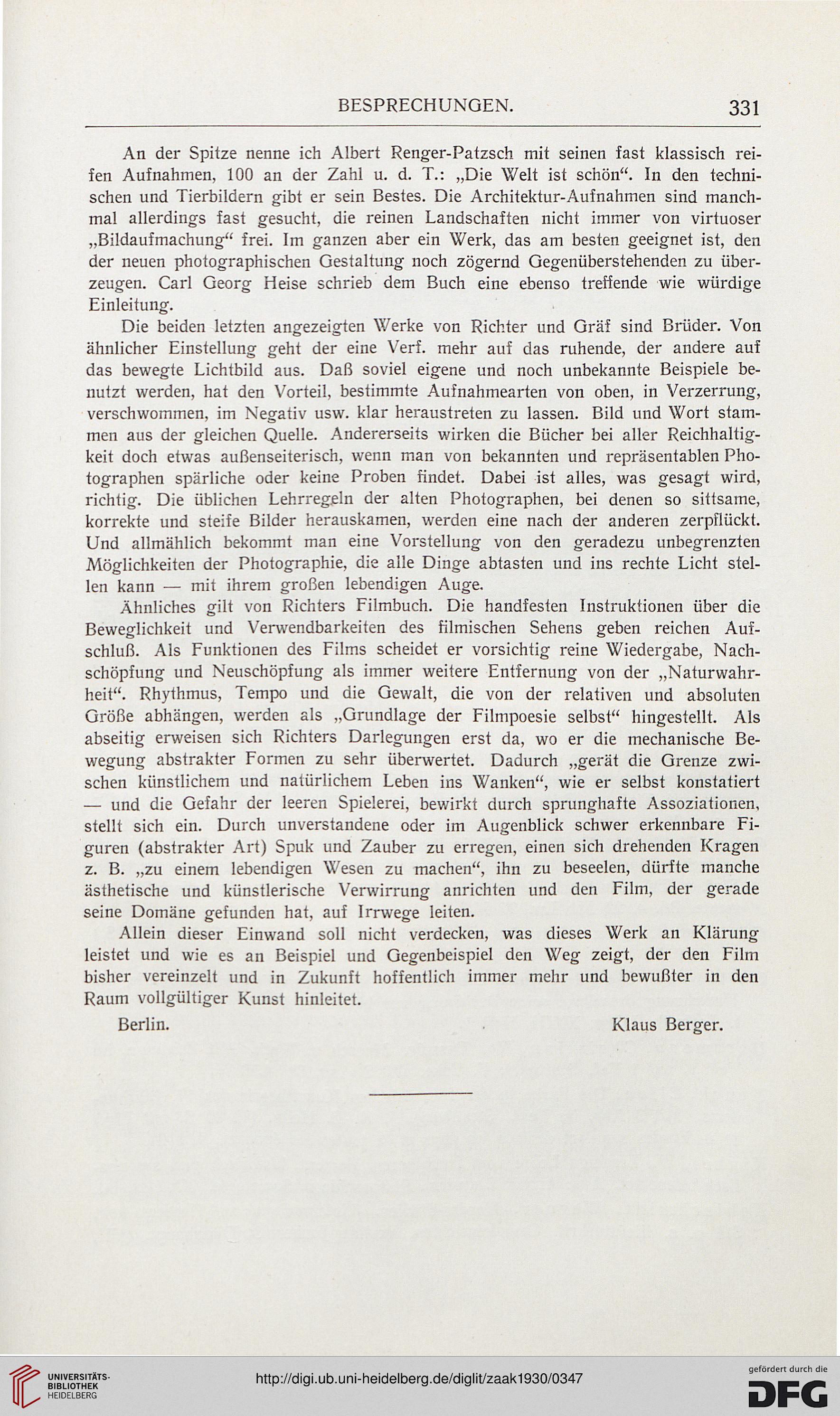BESPRECHUNGEN.
331
An der Spitze nenne ich Albert Renger-Patzsch mit seinen fast klassisch rei-
fen Aufnahmen, 100 an der Zahl u. d. T.: „Die Welt ist schön". In den techni-
schen und Tierbildern gibt er sein Bestes. Die Architektur-Aufnahmen sind manch-
mal allerdings fast gesucht, die reinen Landschaften nicht immer von virtuoser
„Bildaufmachung" frei. Im ganzen aber ein Werk, das am besten geeignet ist, den
der neuen photographischen Gestaltung noch zögernd Gegenüberstehenden zu über-
zeugen. Carl Georg Heise schrieb dem Buch eine ebenso treffende wie würdige
Einleitung.
Die beiden letzten angezeigten Werke von Richter und Graf sind Brüder. Von
ähnlicher Einstellung geht der eine Verf. mehr auf das ruhende, der andere auf
das bewegte Lichtbild aus. Daß soviel eigene und noch unbekannte Beispiele be-
nutzt werden, hat den Vorteil, bestimmte Aufnahmearten von oben, in Verzerrung,
verschwommen, im Negativ usw. klar heraustreten zu lassen. Bild und Wort stam-
men aus der gleichen Quelle. Andererseits wirken die Bücher bei aller Reichhaltig-
keit doch etwas außenseiterisch, wenn man von bekannten und repräsentablen Pho-
tographen spärliche oder keine Proben findet. Dabei ist alles, was gesagt wird,
richtig. Die üblichen Lehrregeln der alten Photographen, bei denen so sittsame,
korrekte und steife Bilder herauskamen, werden eine nach der anderen zerpflückt.
Und allmählich bekommt man eine Vorstellung von den geradezu unbegrenzten
Möglichkeiten der Photographie, die alle Dinge abtasten und ins rechte Licht stel-
len kann — mit ihrem großen lebendigen Auge.
Ähnliches gilt von Richters Filmbuch. Die handfesten Instruktionen über die
Beweglichkeit und Verwendbarkeiten des filmischen Sehens geben reichen Auf-
schluß. Als Funktionen des Films scheidet er vorsichtig reine Wiedergabe, Nach-
schöpfung und Neuschöpfung als immer weitere Entfernung von der „Naturwahr-
heit". Rhythmus, Tempo und die Gewalt, die von der relativen und absoluten
Größe abhängen, werden als „Grundlage der Filmpoesie selbst" hingestellt. Als
abseitig erweisen sich Richters Darlegungen erst da, wo er die mechanische Be-
wegung abstrakter Formen zu sehr überwertet. Dadurch „gerät die Grenze zwi-
schen künstlichem und natürlichem Leben ins Wanken", wie er selbst konstatiert
— und die Gefahr der leeren Spielerei, bewirkt durch sprunghafte Assoziationen,
stellt sich ein. Durch unverstandene oder im Augenblick schwer erkennbare Fi-
guren (abstrakter Art) Spuk und Zauber zu erregen, einen sich drehenden Kragen
z. B. „zu einem lebendigen Wesen zu machen", ihn zu beseelen, dürfte manche
ästhetische und künstlerische Verwirrung anrichten und den Film, der gerade
seine Domäne gefunden hat, auf Irrwege leiten.
Allein dieser Einwand soll nicht verdecken, was dieses Werk an Klärung
leistet und wie es an Beispiel und Gegenbeispiel den Weg zeigt, der den Film
bisher vereinzelt und in Zukunft hoffentlich immer mehr und bewußter in den
Raum vollgültiger Kunst hinleitet.
Berlin. . Klaus Berger.
331
An der Spitze nenne ich Albert Renger-Patzsch mit seinen fast klassisch rei-
fen Aufnahmen, 100 an der Zahl u. d. T.: „Die Welt ist schön". In den techni-
schen und Tierbildern gibt er sein Bestes. Die Architektur-Aufnahmen sind manch-
mal allerdings fast gesucht, die reinen Landschaften nicht immer von virtuoser
„Bildaufmachung" frei. Im ganzen aber ein Werk, das am besten geeignet ist, den
der neuen photographischen Gestaltung noch zögernd Gegenüberstehenden zu über-
zeugen. Carl Georg Heise schrieb dem Buch eine ebenso treffende wie würdige
Einleitung.
Die beiden letzten angezeigten Werke von Richter und Graf sind Brüder. Von
ähnlicher Einstellung geht der eine Verf. mehr auf das ruhende, der andere auf
das bewegte Lichtbild aus. Daß soviel eigene und noch unbekannte Beispiele be-
nutzt werden, hat den Vorteil, bestimmte Aufnahmearten von oben, in Verzerrung,
verschwommen, im Negativ usw. klar heraustreten zu lassen. Bild und Wort stam-
men aus der gleichen Quelle. Andererseits wirken die Bücher bei aller Reichhaltig-
keit doch etwas außenseiterisch, wenn man von bekannten und repräsentablen Pho-
tographen spärliche oder keine Proben findet. Dabei ist alles, was gesagt wird,
richtig. Die üblichen Lehrregeln der alten Photographen, bei denen so sittsame,
korrekte und steife Bilder herauskamen, werden eine nach der anderen zerpflückt.
Und allmählich bekommt man eine Vorstellung von den geradezu unbegrenzten
Möglichkeiten der Photographie, die alle Dinge abtasten und ins rechte Licht stel-
len kann — mit ihrem großen lebendigen Auge.
Ähnliches gilt von Richters Filmbuch. Die handfesten Instruktionen über die
Beweglichkeit und Verwendbarkeiten des filmischen Sehens geben reichen Auf-
schluß. Als Funktionen des Films scheidet er vorsichtig reine Wiedergabe, Nach-
schöpfung und Neuschöpfung als immer weitere Entfernung von der „Naturwahr-
heit". Rhythmus, Tempo und die Gewalt, die von der relativen und absoluten
Größe abhängen, werden als „Grundlage der Filmpoesie selbst" hingestellt. Als
abseitig erweisen sich Richters Darlegungen erst da, wo er die mechanische Be-
wegung abstrakter Formen zu sehr überwertet. Dadurch „gerät die Grenze zwi-
schen künstlichem und natürlichem Leben ins Wanken", wie er selbst konstatiert
— und die Gefahr der leeren Spielerei, bewirkt durch sprunghafte Assoziationen,
stellt sich ein. Durch unverstandene oder im Augenblick schwer erkennbare Fi-
guren (abstrakter Art) Spuk und Zauber zu erregen, einen sich drehenden Kragen
z. B. „zu einem lebendigen Wesen zu machen", ihn zu beseelen, dürfte manche
ästhetische und künstlerische Verwirrung anrichten und den Film, der gerade
seine Domäne gefunden hat, auf Irrwege leiten.
Allein dieser Einwand soll nicht verdecken, was dieses Werk an Klärung
leistet und wie es an Beispiel und Gegenbeispiel den Weg zeigt, der den Film
bisher vereinzelt und in Zukunft hoffentlich immer mehr und bewußter in den
Raum vollgültiger Kunst hinleitet.
Berlin. . Klaus Berger.