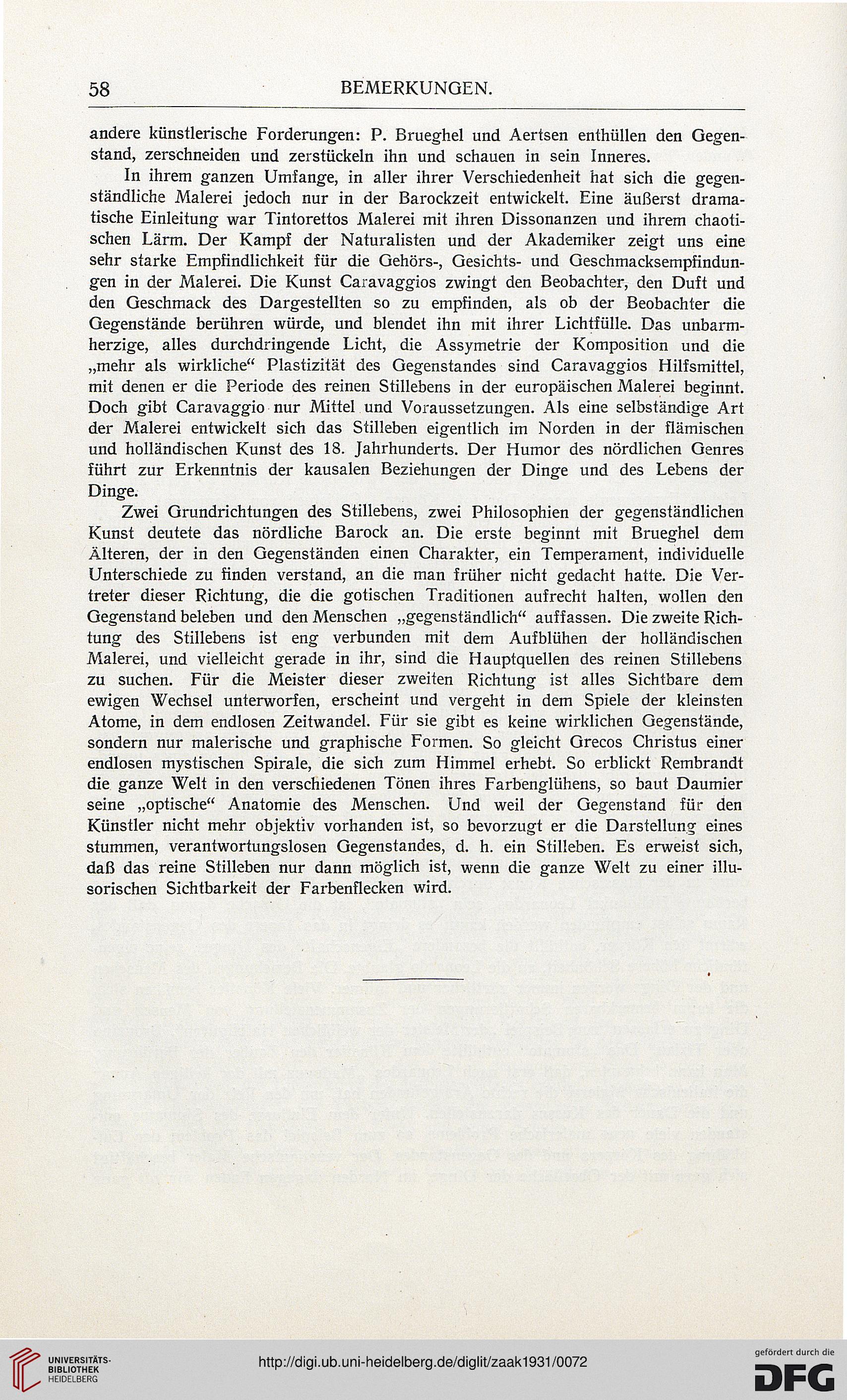58
BEMERKUNGEN.
andere künstlerische Forderungen: P. Brueghel und Aertsen enthüllen den Gegen-
stand, zerschneiden und zerstückeln ihn und schauen in sein Inneres.
In ihrem ganzen Umfange, in aller ihrer Verschiedenheit hat sich die gegen-
ständliche Malerei jedoch nur in der Barockzeit entwickelt. Eine äußerst drama-
tische Einleitung war Tintorettos Malerei mit ihren Dissonanzen und ihrem chaoti-
schen Lärm. Der Kampf der Naturalisten und der Akademiker zeigt uns eine
sehr starke Empfindlichkeit für die Gehörs-, Gesichts- und Geschmacksempfindun-
gen in der Malerei. Die Kunst Caravaggios zwingt den Beobachter, den Duft und
den Geschmack des Dargestellten so zu empfinden, als ob der Beobachter die
Gegenstände berühren würde, und blendet ihn mit ihrer Lichtfülle. Das unbarm-
herzige, alles durchdringende Licht, die Assymetrie der Komposition und die
„mehr als wirkliche" Plastizität des Gegenstandes sind Caravaggios Hilfsmittel,
mit denen er die Periode des reinen Stillebens in der europäischen Malerei beginnt.
Doch gibt Caravaggio nur Mittel und Voraussetzungen. Als eine selbständige Art
der Malerei entwickelt sich das Stilleben eigentlich im Norden in der flämischen
und holländischen Kunst des 18. Jahrhunderts. Der Humor des nördlichen Genres
führt zur Erkenntnis der kausalen Beziehungen der Dinge und des Lebens der
Dinge.
Zwei Grundrichtungen des Stillebens, zwei Philosophien der gegenständlichen
Kunst deutete das nördliche Barock an. Die erste beginnt mit Brueghel dem
Älteren, der in den Gegenständen einen Charakter, ein Temperament, individuelle
Unterschiede zu finden verstand, an die man früher nicht gedacht hatte. Die Ver-
treter dieser Richtung, die die gotischen Traditionen aufrecht halten, wollen den
Gegenstand beleben und den Menschen „gegenständlich" auffassen. Die zweite Rich-
tung des Stillebens ist eng verbunden mit dem Aufblühen der holländischen
Malerei, und vielleicht gerade in ihr, sind die Hauptquellen des reinen Stillebens
zu suchen. Für die Meister dieser zweiten Richtung ist alles Sichtbare dem
ewigen Wechsel unterworfen, erscheint und vergeht in dem Spiele der kleinsten
Atome, in dem endlosen Zeitwandel. Für sie gibt es keine wirklichen Gegenstände,
sondern nur malerische und graphische Formen. So gleicht Grecos Christus einer
endlosen mystischen Spirale, die sich zum Himmel erhebt. So erblickt Rembrandt
die ganze Welt in den verschiedenen Tönen ihres Farbenglühens, so baut Daumier
seine „optische" Anatomie des Menschen. Und weil der Gegenstand für den
Künstler nicht mehr objektiv vorhanden ist, so bevorzugt er die Darstellung eines
stummen, verantwortungslosen Gegenstandes, d. h. ein Stilleben. Es erweist sich,
daß das reine Stilleben nur dann möglich ist, wenn die ganze Welt zu einer illu-
sorischen Sichtbarkeit der Farbenflecken wird.
BEMERKUNGEN.
andere künstlerische Forderungen: P. Brueghel und Aertsen enthüllen den Gegen-
stand, zerschneiden und zerstückeln ihn und schauen in sein Inneres.
In ihrem ganzen Umfange, in aller ihrer Verschiedenheit hat sich die gegen-
ständliche Malerei jedoch nur in der Barockzeit entwickelt. Eine äußerst drama-
tische Einleitung war Tintorettos Malerei mit ihren Dissonanzen und ihrem chaoti-
schen Lärm. Der Kampf der Naturalisten und der Akademiker zeigt uns eine
sehr starke Empfindlichkeit für die Gehörs-, Gesichts- und Geschmacksempfindun-
gen in der Malerei. Die Kunst Caravaggios zwingt den Beobachter, den Duft und
den Geschmack des Dargestellten so zu empfinden, als ob der Beobachter die
Gegenstände berühren würde, und blendet ihn mit ihrer Lichtfülle. Das unbarm-
herzige, alles durchdringende Licht, die Assymetrie der Komposition und die
„mehr als wirkliche" Plastizität des Gegenstandes sind Caravaggios Hilfsmittel,
mit denen er die Periode des reinen Stillebens in der europäischen Malerei beginnt.
Doch gibt Caravaggio nur Mittel und Voraussetzungen. Als eine selbständige Art
der Malerei entwickelt sich das Stilleben eigentlich im Norden in der flämischen
und holländischen Kunst des 18. Jahrhunderts. Der Humor des nördlichen Genres
führt zur Erkenntnis der kausalen Beziehungen der Dinge und des Lebens der
Dinge.
Zwei Grundrichtungen des Stillebens, zwei Philosophien der gegenständlichen
Kunst deutete das nördliche Barock an. Die erste beginnt mit Brueghel dem
Älteren, der in den Gegenständen einen Charakter, ein Temperament, individuelle
Unterschiede zu finden verstand, an die man früher nicht gedacht hatte. Die Ver-
treter dieser Richtung, die die gotischen Traditionen aufrecht halten, wollen den
Gegenstand beleben und den Menschen „gegenständlich" auffassen. Die zweite Rich-
tung des Stillebens ist eng verbunden mit dem Aufblühen der holländischen
Malerei, und vielleicht gerade in ihr, sind die Hauptquellen des reinen Stillebens
zu suchen. Für die Meister dieser zweiten Richtung ist alles Sichtbare dem
ewigen Wechsel unterworfen, erscheint und vergeht in dem Spiele der kleinsten
Atome, in dem endlosen Zeitwandel. Für sie gibt es keine wirklichen Gegenstände,
sondern nur malerische und graphische Formen. So gleicht Grecos Christus einer
endlosen mystischen Spirale, die sich zum Himmel erhebt. So erblickt Rembrandt
die ganze Welt in den verschiedenen Tönen ihres Farbenglühens, so baut Daumier
seine „optische" Anatomie des Menschen. Und weil der Gegenstand für den
Künstler nicht mehr objektiv vorhanden ist, so bevorzugt er die Darstellung eines
stummen, verantwortungslosen Gegenstandes, d. h. ein Stilleben. Es erweist sich,
daß das reine Stilleben nur dann möglich ist, wenn die ganze Welt zu einer illu-
sorischen Sichtbarkeit der Farbenflecken wird.