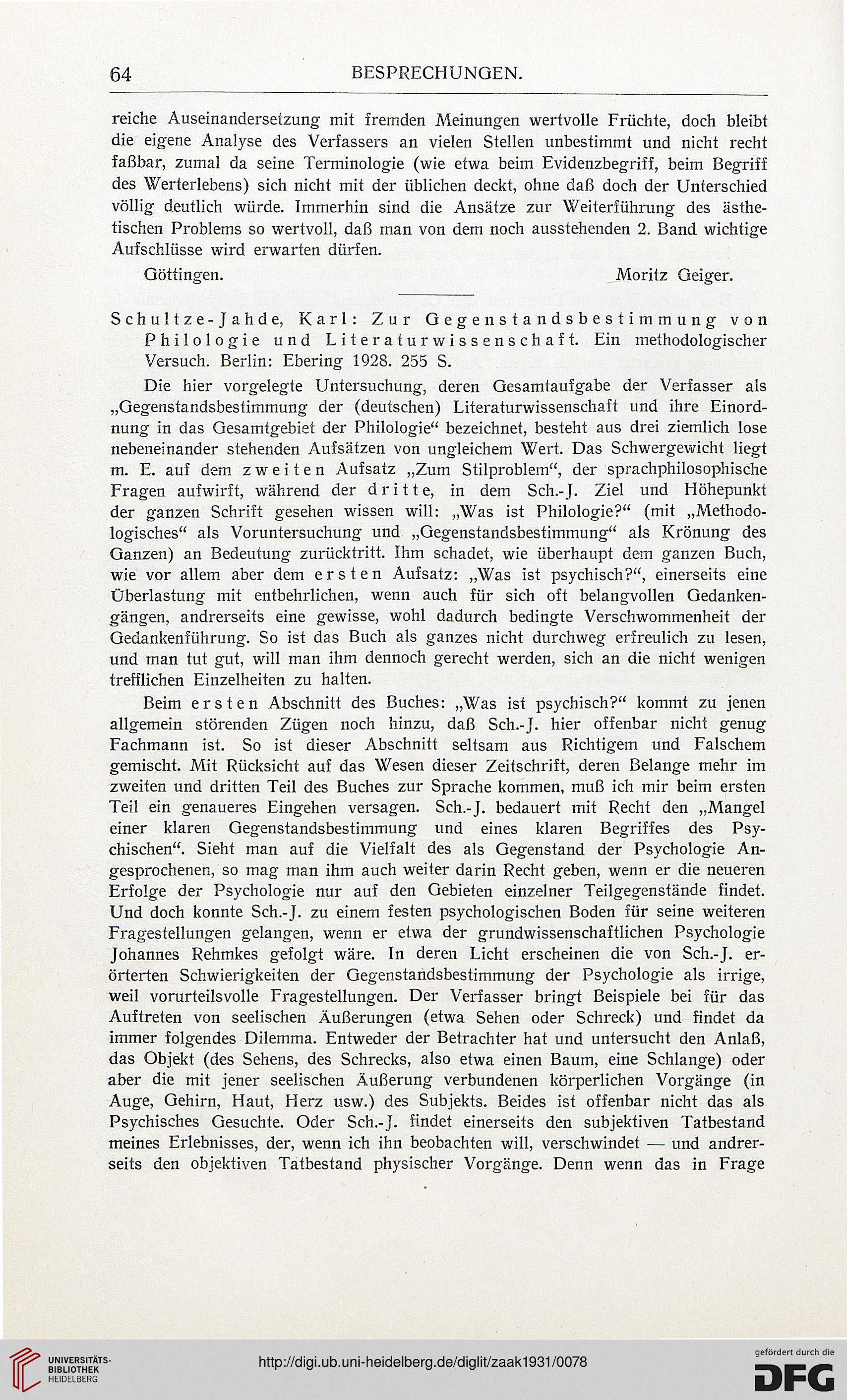64
BESPRECHUNGEN.
reiche Auseinandersetzung mit fremden Meinungen wertvolle Früchte, doch bleibt
die eigene Analyse des Verfassers an vielen Stellen unbestimmt und nicht recht
faßbar, zumal da seine Terminologie (wie etwa beim Evidenzbegriff, beim Begriff
des Werterlebens) sich nicht mit der üblichen deckt, ohne daß doch der Unterschied
völlig deutlich würde. Immerhin sind die Ansätze zur Weiterführung des ästhe-
tischen Problems so wertvoll, daß man von dem noch ausstehenden 2. Band wichtige
Aufschlüsse wird erwarten dürfen.
Göttingen. Moritz Geiger.
Schultze-Jahde, Karl: Zur Gegen Standsbestimmung von
Philologie und Literaturwissenschaft. Ein methodologischer
Versuch. Berlin: Ebering 1928. 255 S.
Die hier vorgelegte Untersuchung, deren Gesamtaufgabe der Verfasser als
„Gegenstandsbestimmung der (deutschen) Literaturwissenschaft und ihre Einord-
nung in das Gesamtgebiet der Philologie" bezeichnet, besteht aus drei ziemlich lose
nebeneinander stehenden Aufsätzen von ungleichem Wert. Das Schwergewicht liegt
m. E. auf dem zweiten Aufsatz „Zum Stilproblem", der sprachphilosophische
Fragen aufwirft, während der dritte, in dem Sch.-J. Ziel und Höhepunkt
der ganzen Schrift gesehen wissen will: „Was ist Philologie?" (mit „Methodo-
logisches" als Voruntersuchung und „Gegenstandsbestimmung" als Krönung des
Ganzen) an Bedeutung zurücktritt. Ihm schadet, wie überhaupt dem ganzen Buch,
wie vor allem aber dem ersten Aufsatz: „Was ist psychisch?", einerseits eine
Überlastung mit entbehrlichen, wenn auch für sich oft belangvollen Gedanken-
gängen, andrerseits eine gewisse, wohl dadurch bedingte Verschwommenheit der
Gedankenführung. So ist das Buch als ganzes nicht durchweg erfreulich zu lesen,
und man tut gut, will man ihm dennoch gerecht werden, sich an die nicht wenigen
trefflichen Einzelheiten zu halten.
Beim ersten Abschnitt des Buches: „Was ist psychisch?" kommt zu jenen
allgemein störenden Zügen noch hinzu, daß Sch.-J. hier offenbar nicht genug
Fachmann ist. So ist dieser Abschnitt seltsam aus Richtigem und Falschem
gemischt. Mit Rücksicht auf das Wesen dieser Zeitschrift, deren Belange mehr im
zweiten und dritten Teil des Buches zur Sprache kommen, muß ich mir beim ersten
Teil ein genaueres Eingehen versagen. Sch.-J. bedauert mit Recht den „Mangel
einer klaren Gegenstandsbestimmung und eines klaren Begriffes des Psy-
chischen". Sieht man auf die Vielfalt des als Gegenstand der Psychologie An-
gesprochenen, so mag man ihm auch weiter darin Recht geben, wenn er die neueren
Erfolge der Psychologie nur auf den Gebieten einzelner Teilgegenstände findet.
Und doch konnte Sch.-J. zu einem festen psychologischen Boden für seine weiteren
Fragestellungen gelangen, wenn er etwa der grundwissenschaftlichen Psychologie
Johannes Rehmkes gefolgt wäre. In deren Licht erscheinen die von Sch.-J. er-
örterten Schwierigkeiten der Gegenstandsbestimmung der Psychologie als irrige,
weil vorurteilsvolle Fragestellungen. Der Verfasser bringt Beispiele bei für das
Auftreten von seelischen Äußerungen (etwa Sehen oder Schreck) und findet da
immer folgendes Dilemma. Entweder der Betrachter hat und untersucht den Anlaß,
das Objekt (des Sehens, des Schrecks, also etwa einen Baum, eine Schlange) oder
aber die mit jener seelischen Äußerung verbundenen körperlichen Vorgänge (in
Auge, Gehirn, Haut, Herz usw.) des Subjekts. Beides ist offenbar nicht das als
Psychisches Gesuchte. Oder Sch.-J. findet einerseits den subjektiven Tatbestand
meines Erlebnisses, der, wenn ich ihn beobachten will, verschwindet — und andrer-
seits den objektiven Tatbestand physischer Vorgänge. Denn wenn das in Frage
BESPRECHUNGEN.
reiche Auseinandersetzung mit fremden Meinungen wertvolle Früchte, doch bleibt
die eigene Analyse des Verfassers an vielen Stellen unbestimmt und nicht recht
faßbar, zumal da seine Terminologie (wie etwa beim Evidenzbegriff, beim Begriff
des Werterlebens) sich nicht mit der üblichen deckt, ohne daß doch der Unterschied
völlig deutlich würde. Immerhin sind die Ansätze zur Weiterführung des ästhe-
tischen Problems so wertvoll, daß man von dem noch ausstehenden 2. Band wichtige
Aufschlüsse wird erwarten dürfen.
Göttingen. Moritz Geiger.
Schultze-Jahde, Karl: Zur Gegen Standsbestimmung von
Philologie und Literaturwissenschaft. Ein methodologischer
Versuch. Berlin: Ebering 1928. 255 S.
Die hier vorgelegte Untersuchung, deren Gesamtaufgabe der Verfasser als
„Gegenstandsbestimmung der (deutschen) Literaturwissenschaft und ihre Einord-
nung in das Gesamtgebiet der Philologie" bezeichnet, besteht aus drei ziemlich lose
nebeneinander stehenden Aufsätzen von ungleichem Wert. Das Schwergewicht liegt
m. E. auf dem zweiten Aufsatz „Zum Stilproblem", der sprachphilosophische
Fragen aufwirft, während der dritte, in dem Sch.-J. Ziel und Höhepunkt
der ganzen Schrift gesehen wissen will: „Was ist Philologie?" (mit „Methodo-
logisches" als Voruntersuchung und „Gegenstandsbestimmung" als Krönung des
Ganzen) an Bedeutung zurücktritt. Ihm schadet, wie überhaupt dem ganzen Buch,
wie vor allem aber dem ersten Aufsatz: „Was ist psychisch?", einerseits eine
Überlastung mit entbehrlichen, wenn auch für sich oft belangvollen Gedanken-
gängen, andrerseits eine gewisse, wohl dadurch bedingte Verschwommenheit der
Gedankenführung. So ist das Buch als ganzes nicht durchweg erfreulich zu lesen,
und man tut gut, will man ihm dennoch gerecht werden, sich an die nicht wenigen
trefflichen Einzelheiten zu halten.
Beim ersten Abschnitt des Buches: „Was ist psychisch?" kommt zu jenen
allgemein störenden Zügen noch hinzu, daß Sch.-J. hier offenbar nicht genug
Fachmann ist. So ist dieser Abschnitt seltsam aus Richtigem und Falschem
gemischt. Mit Rücksicht auf das Wesen dieser Zeitschrift, deren Belange mehr im
zweiten und dritten Teil des Buches zur Sprache kommen, muß ich mir beim ersten
Teil ein genaueres Eingehen versagen. Sch.-J. bedauert mit Recht den „Mangel
einer klaren Gegenstandsbestimmung und eines klaren Begriffes des Psy-
chischen". Sieht man auf die Vielfalt des als Gegenstand der Psychologie An-
gesprochenen, so mag man ihm auch weiter darin Recht geben, wenn er die neueren
Erfolge der Psychologie nur auf den Gebieten einzelner Teilgegenstände findet.
Und doch konnte Sch.-J. zu einem festen psychologischen Boden für seine weiteren
Fragestellungen gelangen, wenn er etwa der grundwissenschaftlichen Psychologie
Johannes Rehmkes gefolgt wäre. In deren Licht erscheinen die von Sch.-J. er-
örterten Schwierigkeiten der Gegenstandsbestimmung der Psychologie als irrige,
weil vorurteilsvolle Fragestellungen. Der Verfasser bringt Beispiele bei für das
Auftreten von seelischen Äußerungen (etwa Sehen oder Schreck) und findet da
immer folgendes Dilemma. Entweder der Betrachter hat und untersucht den Anlaß,
das Objekt (des Sehens, des Schrecks, also etwa einen Baum, eine Schlange) oder
aber die mit jener seelischen Äußerung verbundenen körperlichen Vorgänge (in
Auge, Gehirn, Haut, Herz usw.) des Subjekts. Beides ist offenbar nicht das als
Psychisches Gesuchte. Oder Sch.-J. findet einerseits den subjektiven Tatbestand
meines Erlebnisses, der, wenn ich ihn beobachten will, verschwindet — und andrer-
seits den objektiven Tatbestand physischer Vorgänge. Denn wenn das in Frage