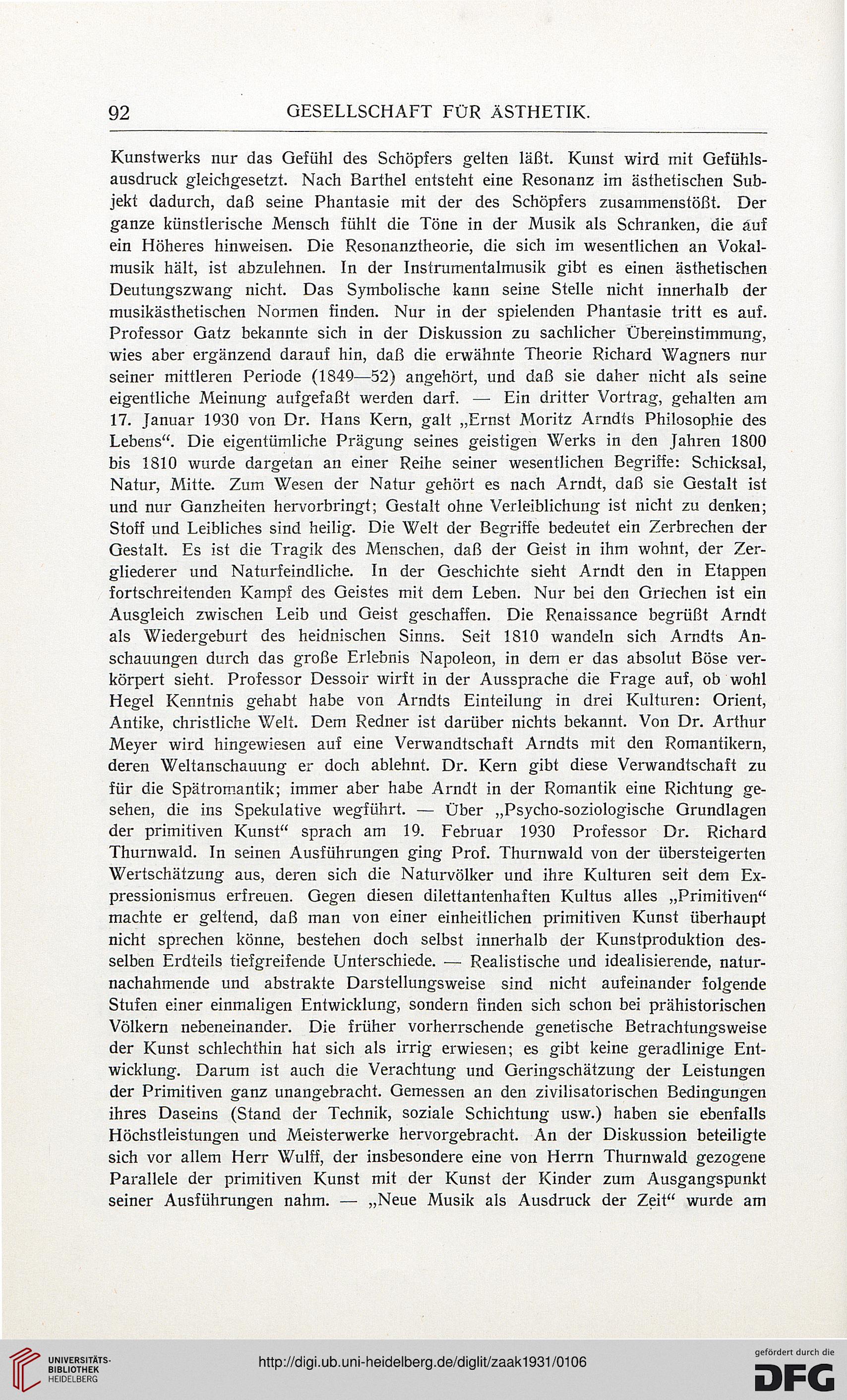92
GESELLSCHAFT FÜR ÄSTHETIK.
Kunstwerks nur das Gefühl des Schöpfers gelten läßt. Kunst wird mit Gefühls-
ausdruck gleichgesetzt. Nach Barthel entsteht eine Resonanz im ästhetischen Sub-
jekt dadurch, daß seine Phantasie mit der des Schöpfers zusammenstößt. Der
ganze künstlerische Mensch fühlt die Töne in der Musik als Schranken, die äuf
ein Höheres hinweisen. Die Resonanztheorie, die sich im wesentlichen an Vokal-
musik hält, ist abzulehnen. In der Instrumentalmusik gibt es einen ästhetischen
Deutungszwang nicht. Das Symbolische kann seine Stelle nicht innerhalb der
musikästhetischen Normen finden. Nur in der spielenden Phantasie tritt es auf.
Professor Gatz bekannte sich in der Diskussion zu sachlicher Übereinstimmung,
wies aber ergänzend darauf hin, daß die erwähnte Theorie Richard Wagners nur
seiner mittleren Periode (1849—52) angehört, und daß sie daher nicht als seine
eigentliche Meinung aufgefaßt werden darf. — Ein dritter Vortrag, gehalten am
17. Januar 1930 von Dr. Hans Kern, galt „Ernst Moritz Arndts Philosophie des
Lebens". Die eigentümliche Prägung seines geistigen Werks in den Jahren 1800
bis 1810 wurde dargetan an einer Reihe seiner wesentlichen Begriffe: Schicksal,
Natur, Mitte. Zum Wesen der Natur gehört es nach Arndt, daß sie Gestalt ist
und nur Ganzheiten hervorbringt; Gestalt ohne Verleiblichung ist nicht zu denken;
Stoff und Leibliches sind heilig. Die Welt der Begriffe bedeutet ein Zerbrechen der
Gestalt. Es ist die Tragik des Menschen, daß der Geist in ihm wohnt, der Zer-
gliederer und Naturfeindliche. In der Geschichte sieht Arndt den in Etappen
fortschreitenden Kampf des Geistes mit dem Leben. Nur bei den Griechen ist ein
Ausgleich zwischen Leib und Geist geschaffen. Die Renaissance begrüßt Arndt
als Wiedergeburt des heidnischen Sinns. Seit 1810 wandeln sich Arndts An-
schauungen durch das große Erlebnis Napoleon, in dem er das absolut Böse ver-
körpert sieht. Professor Dessoir wirft in der Aussprache die Frage auf, ob wohl
Hegel Kenntnis gehabt habe von Arndts Einteilung in drei Kulturen: Orient,
Antike, christliche Welt. Dem Redner ist darüber nichts bekannt. Von Dr. Arthur
Meyer wird hingewiesen auf eine Verwandtschaft Arndts mit den Romantikern,
deren Weltanschauung er doch ablehnt. Dr. Kern gibt diese Verwandtschaft zu
für die Spätromantik; immer aber habe Arndt in der Romantik eine Richtung ge-
sehen, die ins Spekulative wegführt. — Über „Psycho-soziologische Grundlagen
der primitiven Kunst" sprach am 19. Februar 1930 Professor Dr. Richard
Thurnwald. In seinen Ausführungen ging Prof. Thurnwald von der übersteigerten
Wertschätzung aus, deren sich die Naturvölker und ihre Kulturen seit dem Ex-
pressionismus erfreuen. Gegen diesen dilettantenhaften Kultus alles „Primitiven"
machte er geltend, daß man von einer einheitlichen primitiven Kunst überhaupt
nicht sprechen könne, bestehen doch selbst innerhalb der Kunstproduktion des-
selben Erdteils tiefgreifende Unterschiede. — Realistische und idealisierende, natur-
nachahmende und abstrakte Darstellungsweise sind nicht aufeinander folgende
Stufen einer einmaligen Entwicklung, sondern finden sich schon bei prähistorischen
Völkern nebeneinander. Die früher vorherrschende genetische Betrachtungsweise
der Kunst schlechthin hat sich als irrig erwiesen; es gibt keine geradlinige Ent-
wicklung. Darum ist auch die Verachtung und Geringschätzung der Leistungen
der Primitiven ganz unangebracht. Gemessen an den zivilisatorischen Bedingungen
ihres Daseins (Stand der Technik, soziale Schichtung usw.) haben sie ebenfalls
Höchstleistungen und Meisterwerke hervorgebracht. An der Diskussion beteiligte
sich vor allem Herr Wulff, der insbesondere eine von Herrn Thurnwald gezogene
Parallele der primitiven Kunst mit der Kunst der Kinder zum Ausgangspunkt
seiner Ausführungen nahm. — „Neue Musik als Ausdruck der Zeit" wurde am
GESELLSCHAFT FÜR ÄSTHETIK.
Kunstwerks nur das Gefühl des Schöpfers gelten läßt. Kunst wird mit Gefühls-
ausdruck gleichgesetzt. Nach Barthel entsteht eine Resonanz im ästhetischen Sub-
jekt dadurch, daß seine Phantasie mit der des Schöpfers zusammenstößt. Der
ganze künstlerische Mensch fühlt die Töne in der Musik als Schranken, die äuf
ein Höheres hinweisen. Die Resonanztheorie, die sich im wesentlichen an Vokal-
musik hält, ist abzulehnen. In der Instrumentalmusik gibt es einen ästhetischen
Deutungszwang nicht. Das Symbolische kann seine Stelle nicht innerhalb der
musikästhetischen Normen finden. Nur in der spielenden Phantasie tritt es auf.
Professor Gatz bekannte sich in der Diskussion zu sachlicher Übereinstimmung,
wies aber ergänzend darauf hin, daß die erwähnte Theorie Richard Wagners nur
seiner mittleren Periode (1849—52) angehört, und daß sie daher nicht als seine
eigentliche Meinung aufgefaßt werden darf. — Ein dritter Vortrag, gehalten am
17. Januar 1930 von Dr. Hans Kern, galt „Ernst Moritz Arndts Philosophie des
Lebens". Die eigentümliche Prägung seines geistigen Werks in den Jahren 1800
bis 1810 wurde dargetan an einer Reihe seiner wesentlichen Begriffe: Schicksal,
Natur, Mitte. Zum Wesen der Natur gehört es nach Arndt, daß sie Gestalt ist
und nur Ganzheiten hervorbringt; Gestalt ohne Verleiblichung ist nicht zu denken;
Stoff und Leibliches sind heilig. Die Welt der Begriffe bedeutet ein Zerbrechen der
Gestalt. Es ist die Tragik des Menschen, daß der Geist in ihm wohnt, der Zer-
gliederer und Naturfeindliche. In der Geschichte sieht Arndt den in Etappen
fortschreitenden Kampf des Geistes mit dem Leben. Nur bei den Griechen ist ein
Ausgleich zwischen Leib und Geist geschaffen. Die Renaissance begrüßt Arndt
als Wiedergeburt des heidnischen Sinns. Seit 1810 wandeln sich Arndts An-
schauungen durch das große Erlebnis Napoleon, in dem er das absolut Böse ver-
körpert sieht. Professor Dessoir wirft in der Aussprache die Frage auf, ob wohl
Hegel Kenntnis gehabt habe von Arndts Einteilung in drei Kulturen: Orient,
Antike, christliche Welt. Dem Redner ist darüber nichts bekannt. Von Dr. Arthur
Meyer wird hingewiesen auf eine Verwandtschaft Arndts mit den Romantikern,
deren Weltanschauung er doch ablehnt. Dr. Kern gibt diese Verwandtschaft zu
für die Spätromantik; immer aber habe Arndt in der Romantik eine Richtung ge-
sehen, die ins Spekulative wegführt. — Über „Psycho-soziologische Grundlagen
der primitiven Kunst" sprach am 19. Februar 1930 Professor Dr. Richard
Thurnwald. In seinen Ausführungen ging Prof. Thurnwald von der übersteigerten
Wertschätzung aus, deren sich die Naturvölker und ihre Kulturen seit dem Ex-
pressionismus erfreuen. Gegen diesen dilettantenhaften Kultus alles „Primitiven"
machte er geltend, daß man von einer einheitlichen primitiven Kunst überhaupt
nicht sprechen könne, bestehen doch selbst innerhalb der Kunstproduktion des-
selben Erdteils tiefgreifende Unterschiede. — Realistische und idealisierende, natur-
nachahmende und abstrakte Darstellungsweise sind nicht aufeinander folgende
Stufen einer einmaligen Entwicklung, sondern finden sich schon bei prähistorischen
Völkern nebeneinander. Die früher vorherrschende genetische Betrachtungsweise
der Kunst schlechthin hat sich als irrig erwiesen; es gibt keine geradlinige Ent-
wicklung. Darum ist auch die Verachtung und Geringschätzung der Leistungen
der Primitiven ganz unangebracht. Gemessen an den zivilisatorischen Bedingungen
ihres Daseins (Stand der Technik, soziale Schichtung usw.) haben sie ebenfalls
Höchstleistungen und Meisterwerke hervorgebracht. An der Diskussion beteiligte
sich vor allem Herr Wulff, der insbesondere eine von Herrn Thurnwald gezogene
Parallele der primitiven Kunst mit der Kunst der Kinder zum Ausgangspunkt
seiner Ausführungen nahm. — „Neue Musik als Ausdruck der Zeit" wurde am