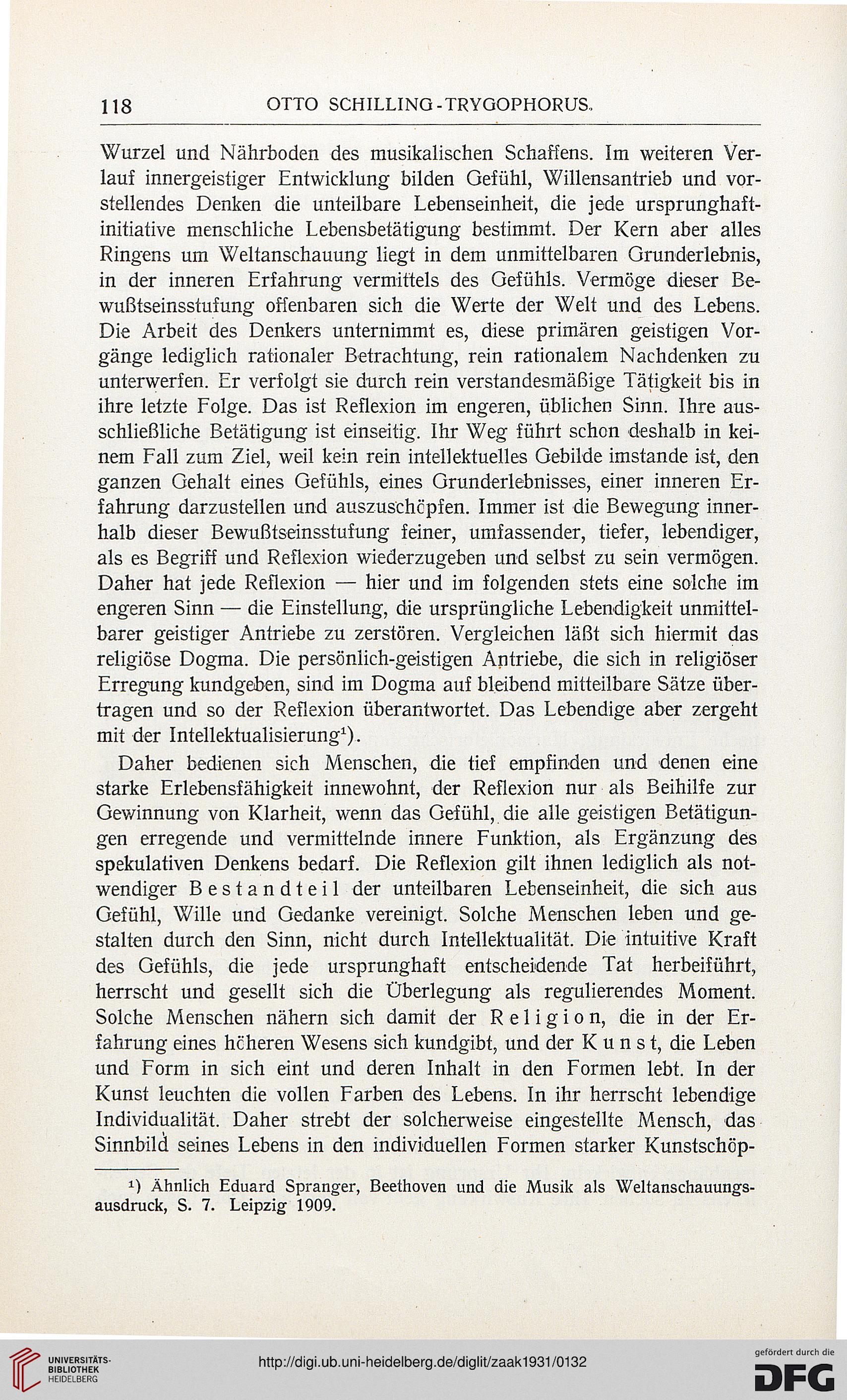118
OTTO SCHILLING-TRYGOPHORUS
Wurzel und Nährboden des musikalischen Schaffens. Im weiteren Ver-
lauf innergeistiger Entwicklung bilden Gefühl, Willensantrieb und vor-
stellendes Denken die unteilbare Lebenseinheit, die jede ursprunghaft-
initiative menschliche Lebensbetätigung bestimmt. Der Kern aber alles
Ringens um Weltanschauung liegt in dem unmittelbaren Grunderlebnis,
in der inneren Erfahrung vermittels des Gefühls. Vermöge dieser Be-
wußtseinsstufung offenbaren sich die Werte der Welt und des Lebens.
Die Arbeit des Denkers unternimmt es, diese primären geistigen Vor-
gänge lediglich rationaler Betrachtung, rein rationalem Nachdenken zu
unterwerfen. Er verfolgt sie durch rein verstandesmäßige Tätigkeit bis in
ihre letzte Folge. Das ist Reflexion im engeren, üblichen Sinn. Ihre aus-
schließliche Betätigung ist einseitig. Ihr Weg führt schon deshalb in kei-
nem Fall zum Ziel, weil kein rein intellektuelles Gebilde imstande ist, den
ganzen Gehalt eines Gefühls, eines Grunderlebnisses, einer inneren Er-
fahrung darzustellen und auszuschöpfen. Immer ist die Bewegung inner-
halb dieser Bewußtseinsstufung feiner, umfassender, tiefer, lebendiger,
als es Begriff und Reflexion wiederzugeben und selbst zu sein vermögen.
Daher hat jede Reflexion — hier und im folgenden stets eine solche im
engeren Sinn — die Einstellung, die ursprüngliche Lebendigkeit unmittel-
barer geistiger Antriebe zu zerstören. Vergleichen läßt sich hiermit das
religiöse Dogma. Die persönlich-geistigen Antriebe, die sich in religiöser
Erregung kundgeben, sind im Dogma auf bleibend mitteilbare Sätze über-
tragen und so der Reflexion überantwortet. Das Lebendige aber zergeht
mit der Intellektualisierung1).
Daher bedienen sich Menschen, die tief empfinden und denen eine
starke Erlebensfähigkeit innewohnt, der Reflexion nur als Beihilfe zur
Gev/innung von Klarheit, wenn das Gefühl, die alle geistigen Betätigun-
gen erregende und vermittelnde innere Funktion, als Ergänzung des
spekulativen Denkens bedarf. Die Reflexion gilt ihnen lediglich als not-
wendiger Bestandteil der unteilbaren Lebenseinheit, die sich aus
Gefühl, Wille und Gedanke vereinigt. Solche Menschen leben und ge-
stalten durch den Sinn, nicht durch Intellektualität. Die intuitive Kraft
des Gefühls, die jede ursprunghaft entscheidende Tat herbeiführt,
herrscht und gesellt sich die Überlegung als regulierendes Moment.
Solche Menschen nähern sich damit der Religion, die in der Er-
fahrung eines höheren Wesens sich kundgibt, und der Kunst, die Leben
und Form in sich eint und deren Inhalt in den Formen lebt. In der
Kunst leuchten die vollen Farben des Lebens. In ihr herrscht lebendige
Individualität. Daher strebt der solcherweise eingestellte Mensch, das
Sinnbild seines Lebens in den individuellen Formen starker Kunstschöp-
Ähnlich Eduard Spranger, Beethoven und die Musik als Weltanschauungs-
ausdruck, S. 7. Leipzig 1909.
OTTO SCHILLING-TRYGOPHORUS
Wurzel und Nährboden des musikalischen Schaffens. Im weiteren Ver-
lauf innergeistiger Entwicklung bilden Gefühl, Willensantrieb und vor-
stellendes Denken die unteilbare Lebenseinheit, die jede ursprunghaft-
initiative menschliche Lebensbetätigung bestimmt. Der Kern aber alles
Ringens um Weltanschauung liegt in dem unmittelbaren Grunderlebnis,
in der inneren Erfahrung vermittels des Gefühls. Vermöge dieser Be-
wußtseinsstufung offenbaren sich die Werte der Welt und des Lebens.
Die Arbeit des Denkers unternimmt es, diese primären geistigen Vor-
gänge lediglich rationaler Betrachtung, rein rationalem Nachdenken zu
unterwerfen. Er verfolgt sie durch rein verstandesmäßige Tätigkeit bis in
ihre letzte Folge. Das ist Reflexion im engeren, üblichen Sinn. Ihre aus-
schließliche Betätigung ist einseitig. Ihr Weg führt schon deshalb in kei-
nem Fall zum Ziel, weil kein rein intellektuelles Gebilde imstande ist, den
ganzen Gehalt eines Gefühls, eines Grunderlebnisses, einer inneren Er-
fahrung darzustellen und auszuschöpfen. Immer ist die Bewegung inner-
halb dieser Bewußtseinsstufung feiner, umfassender, tiefer, lebendiger,
als es Begriff und Reflexion wiederzugeben und selbst zu sein vermögen.
Daher hat jede Reflexion — hier und im folgenden stets eine solche im
engeren Sinn — die Einstellung, die ursprüngliche Lebendigkeit unmittel-
barer geistiger Antriebe zu zerstören. Vergleichen läßt sich hiermit das
religiöse Dogma. Die persönlich-geistigen Antriebe, die sich in religiöser
Erregung kundgeben, sind im Dogma auf bleibend mitteilbare Sätze über-
tragen und so der Reflexion überantwortet. Das Lebendige aber zergeht
mit der Intellektualisierung1).
Daher bedienen sich Menschen, die tief empfinden und denen eine
starke Erlebensfähigkeit innewohnt, der Reflexion nur als Beihilfe zur
Gev/innung von Klarheit, wenn das Gefühl, die alle geistigen Betätigun-
gen erregende und vermittelnde innere Funktion, als Ergänzung des
spekulativen Denkens bedarf. Die Reflexion gilt ihnen lediglich als not-
wendiger Bestandteil der unteilbaren Lebenseinheit, die sich aus
Gefühl, Wille und Gedanke vereinigt. Solche Menschen leben und ge-
stalten durch den Sinn, nicht durch Intellektualität. Die intuitive Kraft
des Gefühls, die jede ursprunghaft entscheidende Tat herbeiführt,
herrscht und gesellt sich die Überlegung als regulierendes Moment.
Solche Menschen nähern sich damit der Religion, die in der Er-
fahrung eines höheren Wesens sich kundgibt, und der Kunst, die Leben
und Form in sich eint und deren Inhalt in den Formen lebt. In der
Kunst leuchten die vollen Farben des Lebens. In ihr herrscht lebendige
Individualität. Daher strebt der solcherweise eingestellte Mensch, das
Sinnbild seines Lebens in den individuellen Formen starker Kunstschöp-
Ähnlich Eduard Spranger, Beethoven und die Musik als Weltanschauungs-
ausdruck, S. 7. Leipzig 1909.