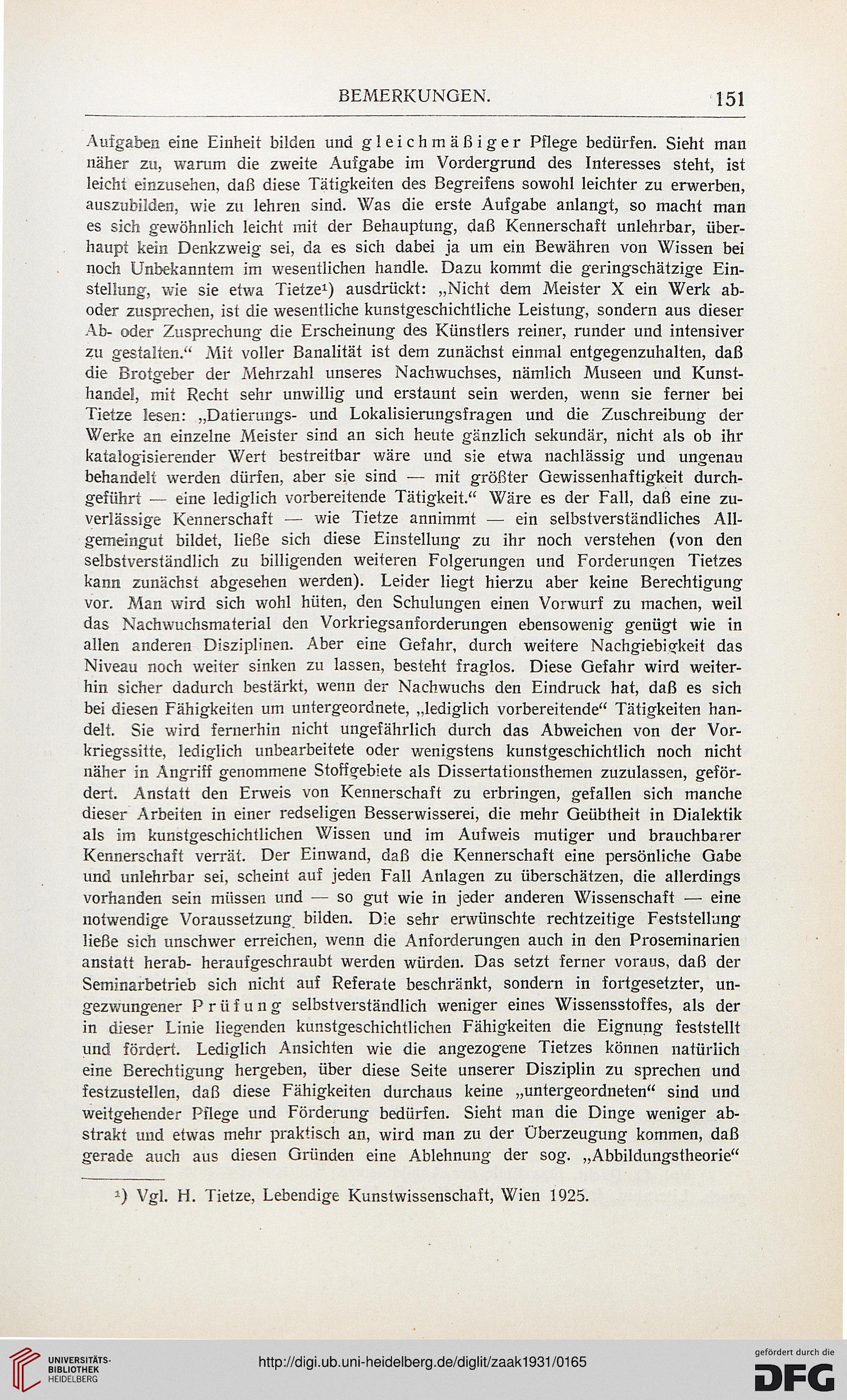BEMERKUNGEN.
151
Aufgaben eine Einheit bilden und gleichmäßiger Pflege bedürfen. Sieht man
näher zu, warum die zweite Aufgabe im Vordergrund des Interesses steht, ist
V - ..!. daß diese Tätigkeiten des Begreifens sowohl leichter zu erwerben,
auszubilden, wie zu lehren sind. Was die erste Aufgabe anlangt, so macht man
es sich gewöhnlich leicht mit der Behauptung, daß Kennerschaft uniehrbar, über-
haupt kein Denkzweig sei, da es sich dabei ja um ein Bewähren von Wissen bei
noch Unbekanntem im wesentlichen handle. Dazu kommt die geringschätzige Ein-
stellung, wie sie etwa Tietze1) ausdrückt: „Nicht dem Meister X ein Werk ab-
oder zusprechen, ist die wesentliche kunstgeschichtliche Leistung, sondern aus dieser
Ab- oder Zusprechung die Erscheinung des Künstlers reiner, runder und intensiver
zu gestalten." Mit voller Banalität ist dem zunächst einmal entgegenzuhalten, daß
die Brotgeber der Mehrzahl unseres Nachwuchses, nämlich Museen und Kunst-
handel, mit Recht sehr unwillig und erstaunt sein werden, wenn sie ferner bei
Tietze lesen: „Datierungs- und Lokalisierungsfragen und die Zuschreibung der
Werke an einzelne Meister sind an sich heute gänzlich sekundär, nicht als ob ihr
katalogisierender Wert bestreitbar wäre und sie etwa nachlässig und ungenau
behandelt werden dürfen, aber sie sind — mit größter Gewissenhaftigkeit durch-
geführt — eine lediglich vorbereitende Tätigkeit." Wäre es der Fall, daß eine zu-
verlässige Kennerschaft — wie Tietze annimmt — ein selbstverständliches All-
gemeingut bildet, ließe sich diese Einstellung zu ihr noch verstehen (von den
selbstverständlich zu billigenden weiteren Folgerungen und Forderungen Tietzes
kann zunächst abgesehen werden). Leider liegt hierzu aber keine Berechtigung
vor. Man wird sich wohl hüten, den Schulungen einen Vorwurf zu machen, weil
das Nachwuchsmaterial den Vorkriegsanforderungen ebensowenig genügt wie in
allen anderen Disziplinen. Aber eine Gefahr, durch weitere Nachgiebigkeit das
Niveau noch weiter sinken zu lassen, besteht fraglos. Diese Gefahr wird weiter-
hin sicher dadurch bestärkt, wenn der Nachwuchs den Eindruck hat, daß es sich
bei diesen Fähigkeiten um untergeordnete, ..lediglich vorbereitende" Tätigkeiten han-
delt. Sie wird fernerhin nicht ungefährlich durch das Abweichen von der Vor-
kriegssitte, lediglich unbearbeitete oder wenigstens kunstgeschichtlich noch nicht
näher in Angriff genommene Stoffgebiete als Dissertationsthemen zuzulassen, geför-
dert. Anstatt den Erweis von Kennerschaft zu erbringen, gefallen sich manche
dieser Arbeiten in einer redseligen Besserwisserei, die mehr Geübtheit in Dialektik
als im kunstgeschichtlichen Wissen und im Aufweis mutiger und brauchbarer
Kennerschaft verrät. Der Einwand, daß die Kennerschaft eine persönliche Gabe
und uniehrbar sei, scheint auf jeden Fall Anlagen zu überschätzen, die allerdings
vorhanden sein müssen und — so gut wie in jeder anderen Wissenschaft — eine
notwendige Voraussetzung bilden. Die sehr erwünschte rechtzeitige Feststellung
ließe sich unschwer erreichen, wenn die Anforderungen auch in den Proseminarien
anstatt herab- heraufgeschraubt werden würden. Das setzt ferner voraus, daß der
Seminarbetrieb sich nicht auf Referate beschränkt, sondern in fortgesetzter, un-
gezwungener Prüfung selbstverständlich weniger eines Wissensstoffes, als der
in dieser Linie liegenden kunstgeschichtlichen Fähigkeiten die Eignung feststellt
und fördert. Lediglich Ansichten wie die angezogene Tietzes können natürlich
eine Berechtigung hergeben, über diese Seite unserer Disziplin zu sprechen und
festzustellen, daß diese Fähigkeiten durchaus keine „untergeordneten" sind und
weitgehender Pflege und Förderung bedürfen. Sieht man die Dinge weniger ab-
strakt und etwas mehr praktisch an, wird man zu der Überzeugung kommen, daß
gerade auch aus diesen Gründen eine Ablehnung der sog. „Abbildungstheorie"
1) Vgl. H. Tietze, Lebendige Kunstwissenschaft, Wien 1925.
151
Aufgaben eine Einheit bilden und gleichmäßiger Pflege bedürfen. Sieht man
näher zu, warum die zweite Aufgabe im Vordergrund des Interesses steht, ist
V - ..!. daß diese Tätigkeiten des Begreifens sowohl leichter zu erwerben,
auszubilden, wie zu lehren sind. Was die erste Aufgabe anlangt, so macht man
es sich gewöhnlich leicht mit der Behauptung, daß Kennerschaft uniehrbar, über-
haupt kein Denkzweig sei, da es sich dabei ja um ein Bewähren von Wissen bei
noch Unbekanntem im wesentlichen handle. Dazu kommt die geringschätzige Ein-
stellung, wie sie etwa Tietze1) ausdrückt: „Nicht dem Meister X ein Werk ab-
oder zusprechen, ist die wesentliche kunstgeschichtliche Leistung, sondern aus dieser
Ab- oder Zusprechung die Erscheinung des Künstlers reiner, runder und intensiver
zu gestalten." Mit voller Banalität ist dem zunächst einmal entgegenzuhalten, daß
die Brotgeber der Mehrzahl unseres Nachwuchses, nämlich Museen und Kunst-
handel, mit Recht sehr unwillig und erstaunt sein werden, wenn sie ferner bei
Tietze lesen: „Datierungs- und Lokalisierungsfragen und die Zuschreibung der
Werke an einzelne Meister sind an sich heute gänzlich sekundär, nicht als ob ihr
katalogisierender Wert bestreitbar wäre und sie etwa nachlässig und ungenau
behandelt werden dürfen, aber sie sind — mit größter Gewissenhaftigkeit durch-
geführt — eine lediglich vorbereitende Tätigkeit." Wäre es der Fall, daß eine zu-
verlässige Kennerschaft — wie Tietze annimmt — ein selbstverständliches All-
gemeingut bildet, ließe sich diese Einstellung zu ihr noch verstehen (von den
selbstverständlich zu billigenden weiteren Folgerungen und Forderungen Tietzes
kann zunächst abgesehen werden). Leider liegt hierzu aber keine Berechtigung
vor. Man wird sich wohl hüten, den Schulungen einen Vorwurf zu machen, weil
das Nachwuchsmaterial den Vorkriegsanforderungen ebensowenig genügt wie in
allen anderen Disziplinen. Aber eine Gefahr, durch weitere Nachgiebigkeit das
Niveau noch weiter sinken zu lassen, besteht fraglos. Diese Gefahr wird weiter-
hin sicher dadurch bestärkt, wenn der Nachwuchs den Eindruck hat, daß es sich
bei diesen Fähigkeiten um untergeordnete, ..lediglich vorbereitende" Tätigkeiten han-
delt. Sie wird fernerhin nicht ungefährlich durch das Abweichen von der Vor-
kriegssitte, lediglich unbearbeitete oder wenigstens kunstgeschichtlich noch nicht
näher in Angriff genommene Stoffgebiete als Dissertationsthemen zuzulassen, geför-
dert. Anstatt den Erweis von Kennerschaft zu erbringen, gefallen sich manche
dieser Arbeiten in einer redseligen Besserwisserei, die mehr Geübtheit in Dialektik
als im kunstgeschichtlichen Wissen und im Aufweis mutiger und brauchbarer
Kennerschaft verrät. Der Einwand, daß die Kennerschaft eine persönliche Gabe
und uniehrbar sei, scheint auf jeden Fall Anlagen zu überschätzen, die allerdings
vorhanden sein müssen und — so gut wie in jeder anderen Wissenschaft — eine
notwendige Voraussetzung bilden. Die sehr erwünschte rechtzeitige Feststellung
ließe sich unschwer erreichen, wenn die Anforderungen auch in den Proseminarien
anstatt herab- heraufgeschraubt werden würden. Das setzt ferner voraus, daß der
Seminarbetrieb sich nicht auf Referate beschränkt, sondern in fortgesetzter, un-
gezwungener Prüfung selbstverständlich weniger eines Wissensstoffes, als der
in dieser Linie liegenden kunstgeschichtlichen Fähigkeiten die Eignung feststellt
und fördert. Lediglich Ansichten wie die angezogene Tietzes können natürlich
eine Berechtigung hergeben, über diese Seite unserer Disziplin zu sprechen und
festzustellen, daß diese Fähigkeiten durchaus keine „untergeordneten" sind und
weitgehender Pflege und Förderung bedürfen. Sieht man die Dinge weniger ab-
strakt und etwas mehr praktisch an, wird man zu der Überzeugung kommen, daß
gerade auch aus diesen Gründen eine Ablehnung der sog. „Abbildungstheorie"
1) Vgl. H. Tietze, Lebendige Kunstwissenschaft, Wien 1925.