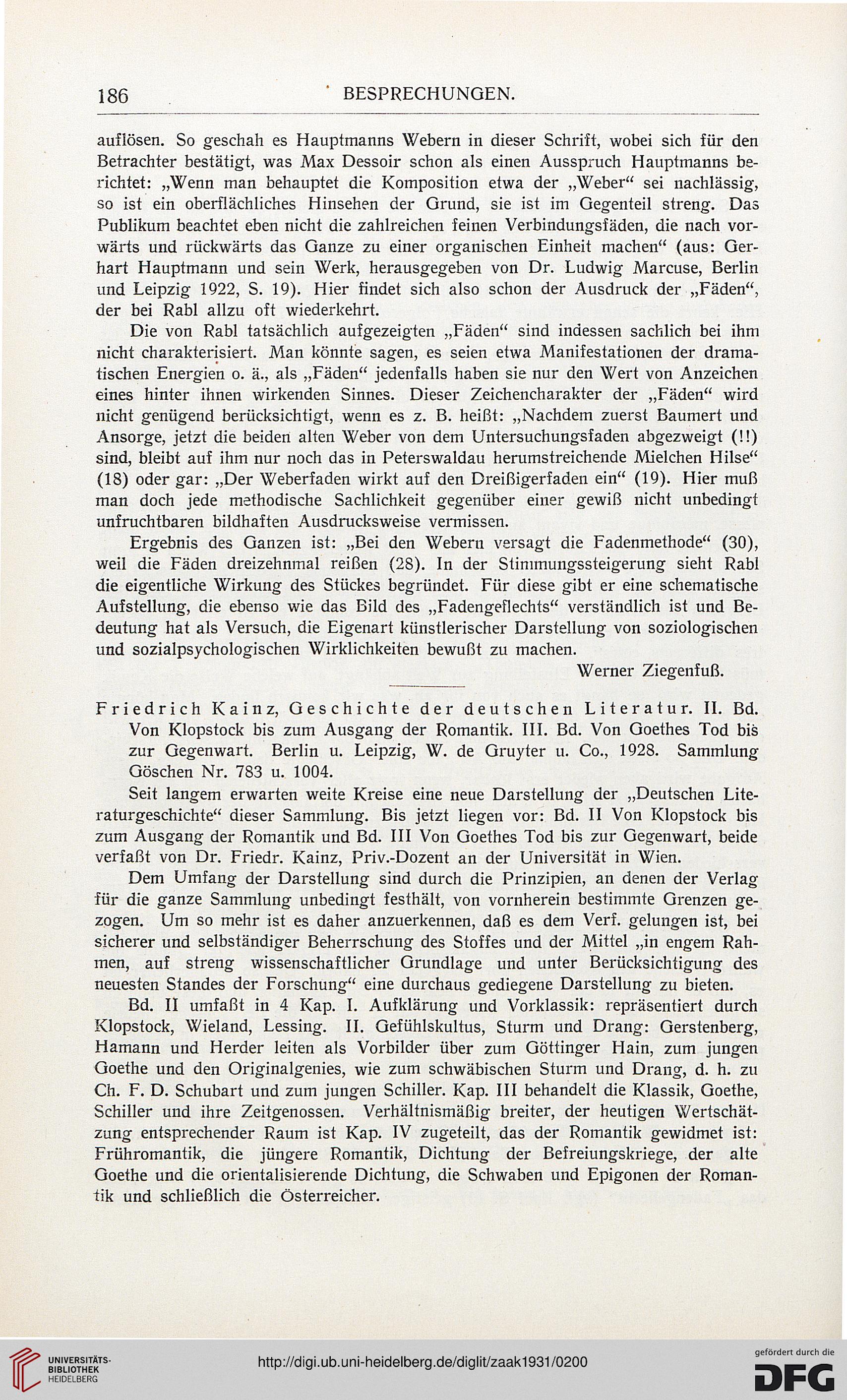186
BESPRECHUNGEN.
auflösen. So geschah es Hauptmanns Webern in dieser Schrift, wobei sich für den
Betrachter bestätigt, was Max Dessoir schon als einen Ausspruch Hauptmanns be-
richtet: „Wenn man behauptet die Komposition etwa der „Weber" sei nachlässig,
so ist ein oberflächliches Hinsehen der Grund, sie ist im Gegenteil streng. Das
Publikum beachtet eben nicht die zahlreichen feinen Verbindungsfäden, die nach vor-
wärts und rückwärts das Ganze zu einer organischen Einheit machen" (aus: Ger-
hart Hauptmann und sein Werk, herausgegeben von Dr. Ludwig Marcuse, Berlin
und Leipzig 1922, S. 19). Hier findet sich also schon der Ausdruck der „Fäden",
der bei Rabl allzu oft wiederkehrt.
Die von Rabl tatsächlich aufgezeigten „Fäden" sind indessen sachlich bei ihm
nicht charakterisiert. Man könnte sagen, es seien etwa Manifestationen der drama-
tischen Energien o. ä., als „Fäden" jedenfalls haben sie nur den Wert von Anzeichen
eines hinter ihnen wirkenden Sinnes. Dieser Zeichencharakter der „Fäden" wird
nicht genügend berücksichtigt, wenn es z. B. heißt: „Nachdem zuerst Baumert und
Ansorge, jetzt die beiden alten Weber von dem Untersuchungsfaden abgezweigt (!!)
sind, bleibt auf ihm nur noch das in Peterswaldau herumstreichende Mielchen Hilse"
(18) oder gar: „Der Weberfaden wirkt auf den Dreißigerfaden ein" (19). Hier muß
man doch jede methodische Sachlichkeit gegenüber einer gewiß nicht unbedingt
unfruchtbaren bildhaften Ausdrucksweise vermissen.
Ergebnis des Ganzen ist: „Bei den Webern versagt die Fadenmethode" (30),
weil die Fäden dreizehnmal reißen (28). In der Stimmungssteigerung sieht Rabl
die eigentliche Wirkung des Stückes begründet. Für diese gibt er eine schematische
Aufstellung, die ebenso wie das Bild des „FadengeFlechts" verständlich ist und Be-
deutung hat als Versuch, die Eigenart künstlerischer Darstellung von soziologischen
und sozialpsychologischen Wirklichkeiten bewußt zu machen.
Werner Ziegenfuß.
Friedrich Kainz, Geschichte der deutschen Literatur. II. Bd.
Von Klopstock bis zum Ausgang der Romantik. III. Bd. Von Goethes Tod bis
zur Gegenwart. Berlin u. Leipzig, W. de Gruyter u. Co., 1928. Sammlung
Göschen Nr. 783 u. 1004.
Seit langem erwarten weite Kreise eine neue Darstellung der „Deutschen Lite-
raturgeschichte" dieser Sammlung. Bis jetzt liegen vor: Bd. II Von Klopstock bis
zum Ausgang der Romantik und Bd. III Von Goethes Tod bis zur Gegenwart, beide
verfaßt von Dr. Friedr. Kainz, Priv.-Dozent an der Universität in Wien.
Dem Umfang der Darstellung sind durch die Prinzipien, an denen der Verlag
für die ganze Sammlung unbedingt festhält, von vornherein bestimmte Grenzen ge-
zogen. Um so mehr ist es daher anzuerkennen, daß es dem Verf. gelungen ist, bei
sicherer und selbständiger Beherrschung des Stoffes und der Mittel „in engem Rah-
men, auf streng wissenschaftlicher Grundlage und unter Berücksichtigung des
neuesten Standes der Forschung" eine durchaus gediegene Darstellung zu bieten.
Bd. II umfaßt in 4 Kap. I. Aufklärung und Vorklassik: repräsentiert durch
Klopstock, Wieland, Lessing. II. Gefühlskultus, Sturm und Drang: Gerstenberg,
Hamann und Herder leiten als Vorbilder über zum Göttinger Hain, zum jungen
Goethe und den Originalgenies, wie zum schwäbischen Sturm und Drang, d. h. zu
Ch. F. D. Schubart und zum jungen Schiller. Kap. III behandelt die Klassik, Goethe,
Schiller und ihre Zeitgenossen. Verhältnismäßig breiter, der heutigen Wertschät-
zung entsprechender Raum ist Kap. IV zugeteilt, das der Romantik gewidmet ist:
Frühromantik, die jüngere Romantik, Dichtung der Befreiungskriege, der alte
Goethe und die orientalisierende Dichtung, die Schwaben und Epigonen der Roman-
tik und schließlich die Österreicher.
BESPRECHUNGEN.
auflösen. So geschah es Hauptmanns Webern in dieser Schrift, wobei sich für den
Betrachter bestätigt, was Max Dessoir schon als einen Ausspruch Hauptmanns be-
richtet: „Wenn man behauptet die Komposition etwa der „Weber" sei nachlässig,
so ist ein oberflächliches Hinsehen der Grund, sie ist im Gegenteil streng. Das
Publikum beachtet eben nicht die zahlreichen feinen Verbindungsfäden, die nach vor-
wärts und rückwärts das Ganze zu einer organischen Einheit machen" (aus: Ger-
hart Hauptmann und sein Werk, herausgegeben von Dr. Ludwig Marcuse, Berlin
und Leipzig 1922, S. 19). Hier findet sich also schon der Ausdruck der „Fäden",
der bei Rabl allzu oft wiederkehrt.
Die von Rabl tatsächlich aufgezeigten „Fäden" sind indessen sachlich bei ihm
nicht charakterisiert. Man könnte sagen, es seien etwa Manifestationen der drama-
tischen Energien o. ä., als „Fäden" jedenfalls haben sie nur den Wert von Anzeichen
eines hinter ihnen wirkenden Sinnes. Dieser Zeichencharakter der „Fäden" wird
nicht genügend berücksichtigt, wenn es z. B. heißt: „Nachdem zuerst Baumert und
Ansorge, jetzt die beiden alten Weber von dem Untersuchungsfaden abgezweigt (!!)
sind, bleibt auf ihm nur noch das in Peterswaldau herumstreichende Mielchen Hilse"
(18) oder gar: „Der Weberfaden wirkt auf den Dreißigerfaden ein" (19). Hier muß
man doch jede methodische Sachlichkeit gegenüber einer gewiß nicht unbedingt
unfruchtbaren bildhaften Ausdrucksweise vermissen.
Ergebnis des Ganzen ist: „Bei den Webern versagt die Fadenmethode" (30),
weil die Fäden dreizehnmal reißen (28). In der Stimmungssteigerung sieht Rabl
die eigentliche Wirkung des Stückes begründet. Für diese gibt er eine schematische
Aufstellung, die ebenso wie das Bild des „FadengeFlechts" verständlich ist und Be-
deutung hat als Versuch, die Eigenart künstlerischer Darstellung von soziologischen
und sozialpsychologischen Wirklichkeiten bewußt zu machen.
Werner Ziegenfuß.
Friedrich Kainz, Geschichte der deutschen Literatur. II. Bd.
Von Klopstock bis zum Ausgang der Romantik. III. Bd. Von Goethes Tod bis
zur Gegenwart. Berlin u. Leipzig, W. de Gruyter u. Co., 1928. Sammlung
Göschen Nr. 783 u. 1004.
Seit langem erwarten weite Kreise eine neue Darstellung der „Deutschen Lite-
raturgeschichte" dieser Sammlung. Bis jetzt liegen vor: Bd. II Von Klopstock bis
zum Ausgang der Romantik und Bd. III Von Goethes Tod bis zur Gegenwart, beide
verfaßt von Dr. Friedr. Kainz, Priv.-Dozent an der Universität in Wien.
Dem Umfang der Darstellung sind durch die Prinzipien, an denen der Verlag
für die ganze Sammlung unbedingt festhält, von vornherein bestimmte Grenzen ge-
zogen. Um so mehr ist es daher anzuerkennen, daß es dem Verf. gelungen ist, bei
sicherer und selbständiger Beherrschung des Stoffes und der Mittel „in engem Rah-
men, auf streng wissenschaftlicher Grundlage und unter Berücksichtigung des
neuesten Standes der Forschung" eine durchaus gediegene Darstellung zu bieten.
Bd. II umfaßt in 4 Kap. I. Aufklärung und Vorklassik: repräsentiert durch
Klopstock, Wieland, Lessing. II. Gefühlskultus, Sturm und Drang: Gerstenberg,
Hamann und Herder leiten als Vorbilder über zum Göttinger Hain, zum jungen
Goethe und den Originalgenies, wie zum schwäbischen Sturm und Drang, d. h. zu
Ch. F. D. Schubart und zum jungen Schiller. Kap. III behandelt die Klassik, Goethe,
Schiller und ihre Zeitgenossen. Verhältnismäßig breiter, der heutigen Wertschät-
zung entsprechender Raum ist Kap. IV zugeteilt, das der Romantik gewidmet ist:
Frühromantik, die jüngere Romantik, Dichtung der Befreiungskriege, der alte
Goethe und die orientalisierende Dichtung, die Schwaben und Epigonen der Roman-
tik und schließlich die Österreicher.