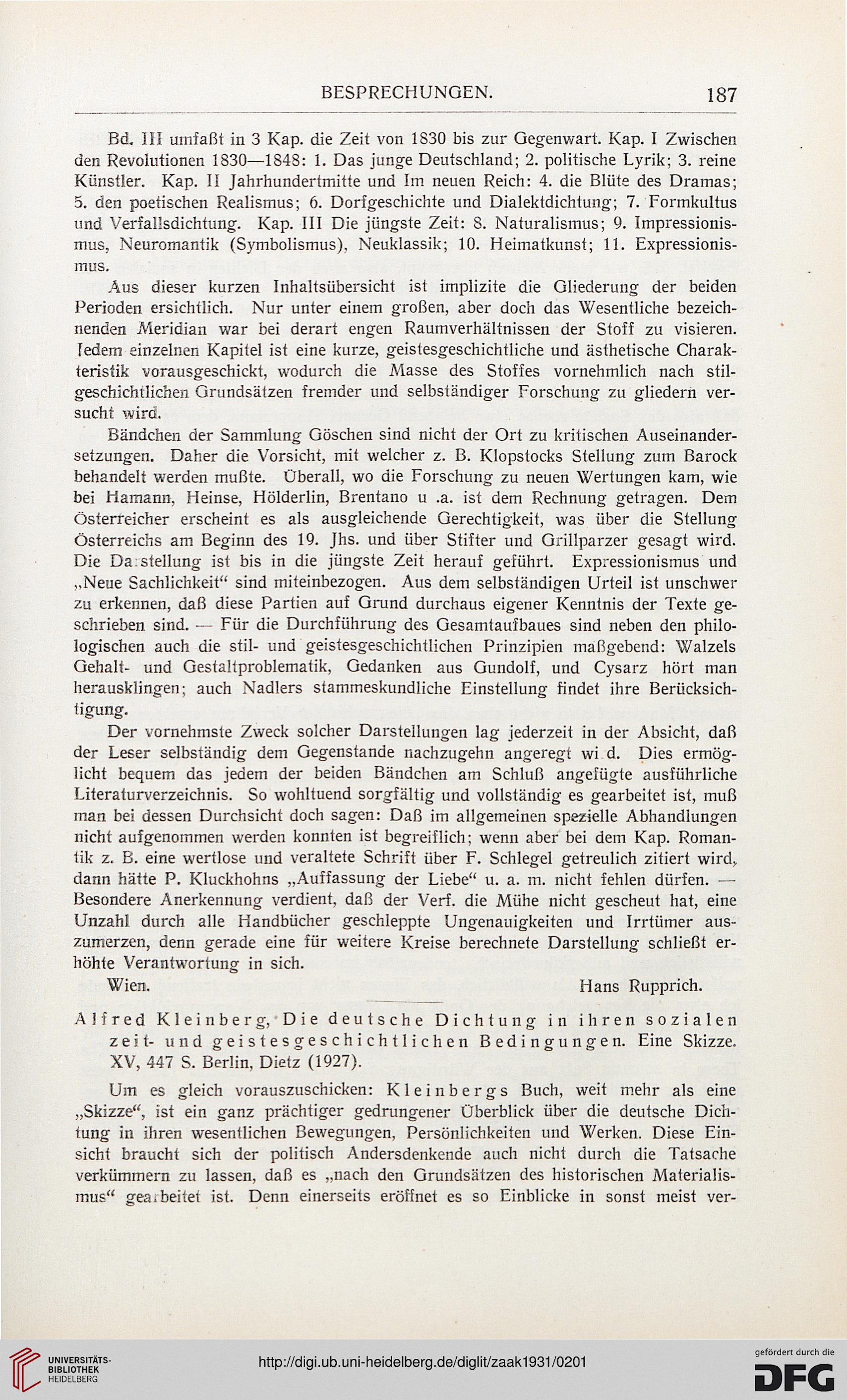187
Bd. III umfaßt in 3 Kap. die Zeit von 1830 bis zur Gegenwart. Kap. I Zwischen
den Revolutionen 1830—1848: 1. Das junge Deutschland; 2. politische Lyrik; 3. reine
Künstler. Kap. II Jahrhundertmitte und Im neuen Reich: 4. die Blüte des Dramas;
5. den poetischen Realismus; 6. Dorfgeschichte und Dialektdichtung; 7. Fonnkultus
und Verfallsdichtung. Kap. III Die jüngste Zeit: 8. Naturalismus; 9. Impressionis-
mus, Neuromantik (Symbolismus), Neuklassik; 10. Heimatkunst; 11. Expressionis-
mus.
Aus dieser kurzen Inhaltsübersicht ist implizite die Gliederung der beiden
Perioden ersichtlich. Nur unter einem großen, aber doch das Wesentliche bezeich-
nenden Meridian war bei derart engen Raumverhältnissen der Stoff zu visieren,
ledern einzelnen Kapitel ist eine kurze, geistesgeschichtliche und ästhetische Charak-
teristik vorausgeschickt, wodurch die Masse des Stoffes vornehmlich nach stil-
geschichtiichen Grundsätzen fremder und selbständiger Forschung zu gliedern ver-
sucht wird.
Bändchen der Sammlung Göschen sind nicht der Ort zu kritischen Auseinander-
setzungen. Daher die Vorsicht, mit welcher z. B. Klopstocks Stellung zum Barock
behandelt werden mußte. Überall, wo die Forschung zu neuen Wertungen kam, wie
bei Hamann. Heinse, Hölderlin, Brentano u .a. ist dem Rechnung getragen. Dem
Österreicher erscheint es als ausgleichende Gerechtigkeit, was über die Stellung
Österreichs am Beginn des 19. Jhs. und über Stifter und Grillparzer gesagt wird.
Die Da Stellung ist bis in die jüngste Zeit herauf geführt. Expressionismus und
..Neue Sachlichkeit" sind miteinbezogen. Aus dem selbständigen Urteil ist unschwer
zu erkennen, daß diese Partien auf Grund durchaus eigener Kenntnis der Texte ge-
schrieben sind. — Für die Durchführung des Gesamtaufbaues sind neben den philo-
logischen auch die stil- und geistesgeschichtlichen Prinzipien maßgebend: Watzels
Gehalt- und Gestaltproblematik, Gedanken aus Gundolf, und Cysarz hört man
herausklingen; auch Nadlers stammeskundliche Einstellung findet ihre Berücksich-
tigung.
Der vornehmste Zweck solcher Darstellungen lag jederzeit in der Absicht, daß
der Leser selbständig dem Gegenstande nachzugehn angeregt wi d. Dies ermög-
licht bequem das jedem der beiden Bändchen am Schluß angefügte ausführliche
Literaturverzeichnis. So wohltuend sorgfältig und vollständig es gearbeitet ist, muß
man bei dessen Durchsicht doch sagen: Daß im allgemeinen spezielle Abhandlungen
nicht aufgenommen werden konnten ist begreiflich; wenn aber bei dem Kap. Roman-
tik z. B. eine wertlose und veraltete Schrift über F. Schlegel getreulich zitiert wird,
dann hätte P. Kluckhohns „Auffassung der Liebe" u. a. m. nicht fehlen dürfen. —
Besondere Anerkennung verdient, daß der Verf. die Mühe nicht gescheut hat, eine
Unzahl durch alle Handbücher geschleppte Ungenauigkeiten und Irrtümer aus-
zumerzen, denn gerade eine für weitere Kreise berechnete Darstellung schließt er-
höhte Verantwortung in sich.
Wien. Hans Rupprich.
Alfred Kleinberg,'Die deutsche Dichtung in ihren sozialen
zeit- und geistesgeschichtlichen Bedingungen. Eine Skizze.
XV, 447 S. Berlin, Dietz (1927).
Um es gleich vorauszuschicken: Kleinbergs Buch, weit mehr als eine
„Skizze", ist ein ganz prächtiger gedrungener Oberblick über die deutsche Dich-
tung in ihren wesentlichen Bewegungen, Persönlichkeiten und Werken. Diese Ein-
sicht braucht sich der politisch Andersdenkende auch nicht durch die Tatsache
verkümmern zu lassen, daß es „nach den Grundsätzen des historischen Materialis-
mus" geaibeitet ist. Denn einerseits eröffnet es so Einblicke in sonst meist ver-
Bd. III umfaßt in 3 Kap. die Zeit von 1830 bis zur Gegenwart. Kap. I Zwischen
den Revolutionen 1830—1848: 1. Das junge Deutschland; 2. politische Lyrik; 3. reine
Künstler. Kap. II Jahrhundertmitte und Im neuen Reich: 4. die Blüte des Dramas;
5. den poetischen Realismus; 6. Dorfgeschichte und Dialektdichtung; 7. Fonnkultus
und Verfallsdichtung. Kap. III Die jüngste Zeit: 8. Naturalismus; 9. Impressionis-
mus, Neuromantik (Symbolismus), Neuklassik; 10. Heimatkunst; 11. Expressionis-
mus.
Aus dieser kurzen Inhaltsübersicht ist implizite die Gliederung der beiden
Perioden ersichtlich. Nur unter einem großen, aber doch das Wesentliche bezeich-
nenden Meridian war bei derart engen Raumverhältnissen der Stoff zu visieren,
ledern einzelnen Kapitel ist eine kurze, geistesgeschichtliche und ästhetische Charak-
teristik vorausgeschickt, wodurch die Masse des Stoffes vornehmlich nach stil-
geschichtiichen Grundsätzen fremder und selbständiger Forschung zu gliedern ver-
sucht wird.
Bändchen der Sammlung Göschen sind nicht der Ort zu kritischen Auseinander-
setzungen. Daher die Vorsicht, mit welcher z. B. Klopstocks Stellung zum Barock
behandelt werden mußte. Überall, wo die Forschung zu neuen Wertungen kam, wie
bei Hamann. Heinse, Hölderlin, Brentano u .a. ist dem Rechnung getragen. Dem
Österreicher erscheint es als ausgleichende Gerechtigkeit, was über die Stellung
Österreichs am Beginn des 19. Jhs. und über Stifter und Grillparzer gesagt wird.
Die Da Stellung ist bis in die jüngste Zeit herauf geführt. Expressionismus und
..Neue Sachlichkeit" sind miteinbezogen. Aus dem selbständigen Urteil ist unschwer
zu erkennen, daß diese Partien auf Grund durchaus eigener Kenntnis der Texte ge-
schrieben sind. — Für die Durchführung des Gesamtaufbaues sind neben den philo-
logischen auch die stil- und geistesgeschichtlichen Prinzipien maßgebend: Watzels
Gehalt- und Gestaltproblematik, Gedanken aus Gundolf, und Cysarz hört man
herausklingen; auch Nadlers stammeskundliche Einstellung findet ihre Berücksich-
tigung.
Der vornehmste Zweck solcher Darstellungen lag jederzeit in der Absicht, daß
der Leser selbständig dem Gegenstande nachzugehn angeregt wi d. Dies ermög-
licht bequem das jedem der beiden Bändchen am Schluß angefügte ausführliche
Literaturverzeichnis. So wohltuend sorgfältig und vollständig es gearbeitet ist, muß
man bei dessen Durchsicht doch sagen: Daß im allgemeinen spezielle Abhandlungen
nicht aufgenommen werden konnten ist begreiflich; wenn aber bei dem Kap. Roman-
tik z. B. eine wertlose und veraltete Schrift über F. Schlegel getreulich zitiert wird,
dann hätte P. Kluckhohns „Auffassung der Liebe" u. a. m. nicht fehlen dürfen. —
Besondere Anerkennung verdient, daß der Verf. die Mühe nicht gescheut hat, eine
Unzahl durch alle Handbücher geschleppte Ungenauigkeiten und Irrtümer aus-
zumerzen, denn gerade eine für weitere Kreise berechnete Darstellung schließt er-
höhte Verantwortung in sich.
Wien. Hans Rupprich.
Alfred Kleinberg,'Die deutsche Dichtung in ihren sozialen
zeit- und geistesgeschichtlichen Bedingungen. Eine Skizze.
XV, 447 S. Berlin, Dietz (1927).
Um es gleich vorauszuschicken: Kleinbergs Buch, weit mehr als eine
„Skizze", ist ein ganz prächtiger gedrungener Oberblick über die deutsche Dich-
tung in ihren wesentlichen Bewegungen, Persönlichkeiten und Werken. Diese Ein-
sicht braucht sich der politisch Andersdenkende auch nicht durch die Tatsache
verkümmern zu lassen, daß es „nach den Grundsätzen des historischen Materialis-
mus" geaibeitet ist. Denn einerseits eröffnet es so Einblicke in sonst meist ver-