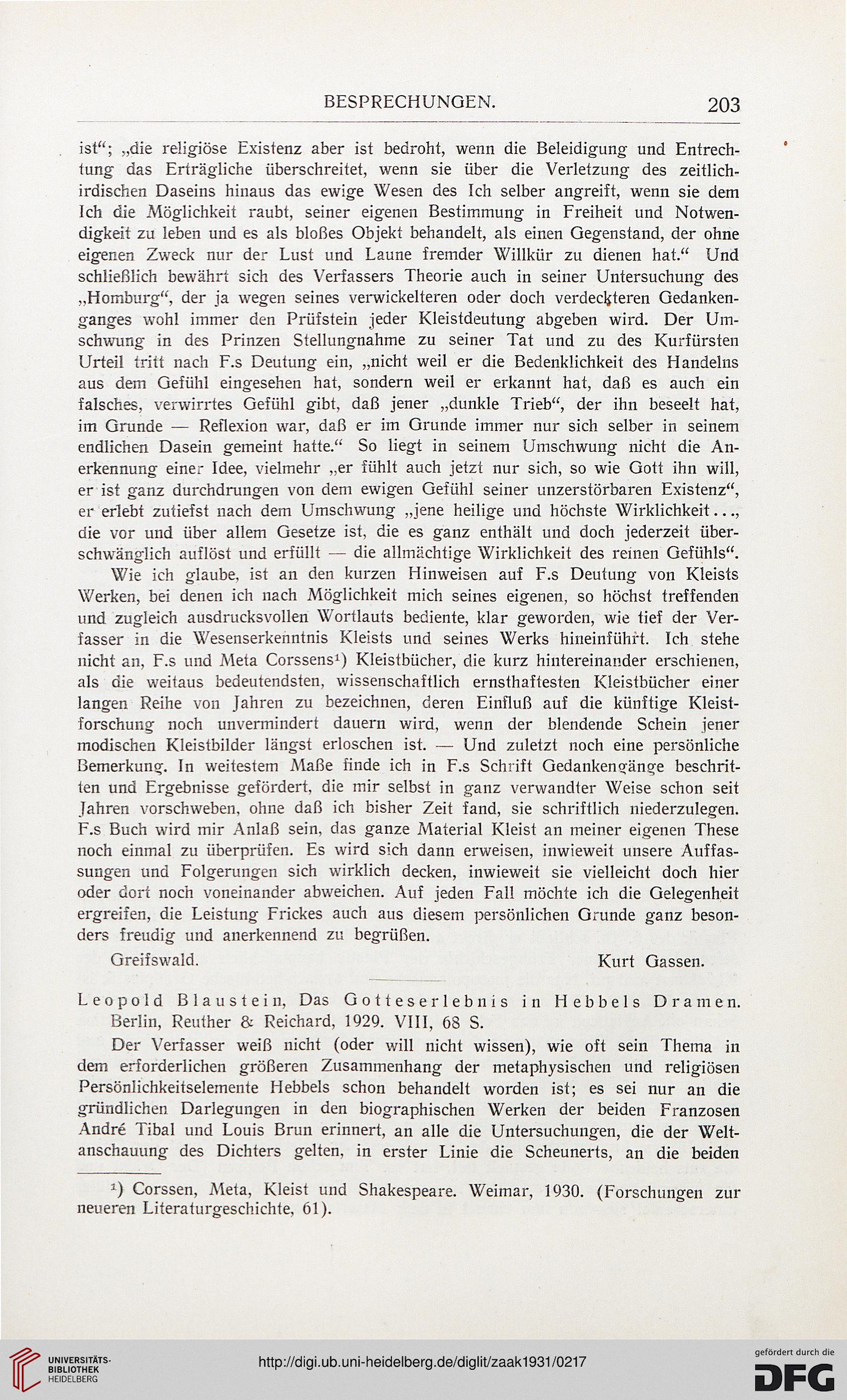BESPRECHUNGEN.
203
ist"; „die religiöse Existenz aber ist bedroht, wenn die Beleidigung und Entrech-
tung das Erträgliche überschreitet, wenn sie über die Verletzung des zeitlich-
irdischen Daseins hinaus das ewige Wesen des Ich selber angreift, wenn sie dem
Ich die Möglichkeit raubt, seiner eigenen Bestimmung in Freiheit und Notwen-
digkeit zu leben und es als bloßes Objekt behandelt, als einen Gegenstand, der ohne
eigenen Zweck nur der Lust und Laune fremder Willkür zu dienen hat." Und
schließlich bewährt sich des Verfassers Theorie auch in seiner Untersuchung des
„Homburg", der ja wegen seines verwickeiteren oder doch verdecljteren Gedanken-
ganges wohl immer den Prüfstein jeder Kleistdeutung abgeben wird. Der Um-
schwung in des Prinzen Stellungnahme zu seiner Tat und zu des Kurfürsten
Urteil tritt nach F.s Deutung ein, „nicht weil er die Bedenklichkeit des Handelns
aus dem Gefühl eingesehen hat, sondern weil er erkannt hat, daß es auch ein
falsches, verwirrtes Gefühl gibt, daß jener „dunkle Trieb", der ihn beseelt hat,
im Grunde — Reflexion war, daß er im Grunde immer nur sich selber in seinem
endlichen Dasein gemeint hatte." So liegt in seinem Umschwung nicht die An-
erkennung einer Idee, vielmehr „er fühlt auch jetzt nur sich, so wie Gott ihn will,
er ist ganz durchdrungen von dem ewigen Gefühl seiner unzerstörbaren Existenz",
er erlebt zutiefst nach dem Umschwung „jene heilige und höchste Wirklichkeit...,
die vor und über allem Gesetze ist, die es ganz enthält und doch jederzeit über-
schwänglich auflöst und erfüllt — die allmächtige Wirklichkeit des reinen Gefühls".
Wie ich glaube, ist an den kurzen Hinweisen auf F.s Deutung von Kleists
Werken, bei denen ich nach Möglichkeit mich seines eigenen, so höchst treffenden
und zugleich ausdrucksvollen Wortlauts bediente, klar geworden, wie tief der Ver-
fasser in die Wesenserkenntnis Kleists und seines Werks hineinführt. Ich stehe
nicht an, F.s und Meta Corssens1) Kleistbücher, die kurz hintereinander erschienen,
als die weitaus bedeutendsten, wissenschaftlich ernsthaftesten Kleistbücher einer
langen Reihe von Jahren zu bezeichnen, deren Einfluß auf die künftige Kleist-
forschung noch unvermindert dauern wird, wenn der blendende Schein jener
modischen Kleistbilder längst erloschen ist. — Und zuletzt noch eine persönliche
Bemerkung. In weitestem Maße finde ich in F.s Schrift Gedankengänge beschrit-
ten und Ergebnisse gefördert, die mir selbst in ganz verwandter Weise schon seit
Jahren vorschweben, ohne daß ich bisher Zeit fand, sie schriftlich niederzulegen.
F.s Buch wird mir Anlaß sein, das ganze Material Kleist an meiner eigenen These
noch einmal zu überprüfen. Es wird sich dann erweisen, inwieweit unsere Auffas-
sungen und Folgerungen sich wirklich decken, inwieweit sie vielleicht doch hier
oder dort noch voneinander abweichen. Auf jeden Fall möchte ich die Gelegenheit
ergreifen, die Leistung Frickes auch aus diesem persönlichen Grunde ganz beson-
ders freudig und anerkennend zu begrüßen.
Greifswald. Kurt Gassen.
Leopold Blaustein, Das Gotteserlebnis in Hebbels Dramen.
Berlin, Reuther & Reichard, 1929. VIII, 68 S.
Der Verfasser weiß nicht (oder will nicht wissen), wie oft sein Thema in
dem erforderlichen größeren Zusammenhang der metaphysischen und religiösen
Persönlichkeitselemente Hebbels schon behandelt worden ist; es sei nur an die
gründlichen Darlegungen in den biographischen Werken der beiden Franzosen
Andre Tibal und Louis Brun erinnert, an alle die Untersuchungen, die der Welt-
anschauung des Dichters gelten, in erster Linie die Scheunerts, an die beiden
1) Corssen, Meta, Kleist und Shakespeare. Weimar, 1930. (Forschungen zur
neueren Literaturgeschichte, 61).
203
ist"; „die religiöse Existenz aber ist bedroht, wenn die Beleidigung und Entrech-
tung das Erträgliche überschreitet, wenn sie über die Verletzung des zeitlich-
irdischen Daseins hinaus das ewige Wesen des Ich selber angreift, wenn sie dem
Ich die Möglichkeit raubt, seiner eigenen Bestimmung in Freiheit und Notwen-
digkeit zu leben und es als bloßes Objekt behandelt, als einen Gegenstand, der ohne
eigenen Zweck nur der Lust und Laune fremder Willkür zu dienen hat." Und
schließlich bewährt sich des Verfassers Theorie auch in seiner Untersuchung des
„Homburg", der ja wegen seines verwickeiteren oder doch verdecljteren Gedanken-
ganges wohl immer den Prüfstein jeder Kleistdeutung abgeben wird. Der Um-
schwung in des Prinzen Stellungnahme zu seiner Tat und zu des Kurfürsten
Urteil tritt nach F.s Deutung ein, „nicht weil er die Bedenklichkeit des Handelns
aus dem Gefühl eingesehen hat, sondern weil er erkannt hat, daß es auch ein
falsches, verwirrtes Gefühl gibt, daß jener „dunkle Trieb", der ihn beseelt hat,
im Grunde — Reflexion war, daß er im Grunde immer nur sich selber in seinem
endlichen Dasein gemeint hatte." So liegt in seinem Umschwung nicht die An-
erkennung einer Idee, vielmehr „er fühlt auch jetzt nur sich, so wie Gott ihn will,
er ist ganz durchdrungen von dem ewigen Gefühl seiner unzerstörbaren Existenz",
er erlebt zutiefst nach dem Umschwung „jene heilige und höchste Wirklichkeit...,
die vor und über allem Gesetze ist, die es ganz enthält und doch jederzeit über-
schwänglich auflöst und erfüllt — die allmächtige Wirklichkeit des reinen Gefühls".
Wie ich glaube, ist an den kurzen Hinweisen auf F.s Deutung von Kleists
Werken, bei denen ich nach Möglichkeit mich seines eigenen, so höchst treffenden
und zugleich ausdrucksvollen Wortlauts bediente, klar geworden, wie tief der Ver-
fasser in die Wesenserkenntnis Kleists und seines Werks hineinführt. Ich stehe
nicht an, F.s und Meta Corssens1) Kleistbücher, die kurz hintereinander erschienen,
als die weitaus bedeutendsten, wissenschaftlich ernsthaftesten Kleistbücher einer
langen Reihe von Jahren zu bezeichnen, deren Einfluß auf die künftige Kleist-
forschung noch unvermindert dauern wird, wenn der blendende Schein jener
modischen Kleistbilder längst erloschen ist. — Und zuletzt noch eine persönliche
Bemerkung. In weitestem Maße finde ich in F.s Schrift Gedankengänge beschrit-
ten und Ergebnisse gefördert, die mir selbst in ganz verwandter Weise schon seit
Jahren vorschweben, ohne daß ich bisher Zeit fand, sie schriftlich niederzulegen.
F.s Buch wird mir Anlaß sein, das ganze Material Kleist an meiner eigenen These
noch einmal zu überprüfen. Es wird sich dann erweisen, inwieweit unsere Auffas-
sungen und Folgerungen sich wirklich decken, inwieweit sie vielleicht doch hier
oder dort noch voneinander abweichen. Auf jeden Fall möchte ich die Gelegenheit
ergreifen, die Leistung Frickes auch aus diesem persönlichen Grunde ganz beson-
ders freudig und anerkennend zu begrüßen.
Greifswald. Kurt Gassen.
Leopold Blaustein, Das Gotteserlebnis in Hebbels Dramen.
Berlin, Reuther & Reichard, 1929. VIII, 68 S.
Der Verfasser weiß nicht (oder will nicht wissen), wie oft sein Thema in
dem erforderlichen größeren Zusammenhang der metaphysischen und religiösen
Persönlichkeitselemente Hebbels schon behandelt worden ist; es sei nur an die
gründlichen Darlegungen in den biographischen Werken der beiden Franzosen
Andre Tibal und Louis Brun erinnert, an alle die Untersuchungen, die der Welt-
anschauung des Dichters gelten, in erster Linie die Scheunerts, an die beiden
1) Corssen, Meta, Kleist und Shakespeare. Weimar, 1930. (Forschungen zur
neueren Literaturgeschichte, 61).