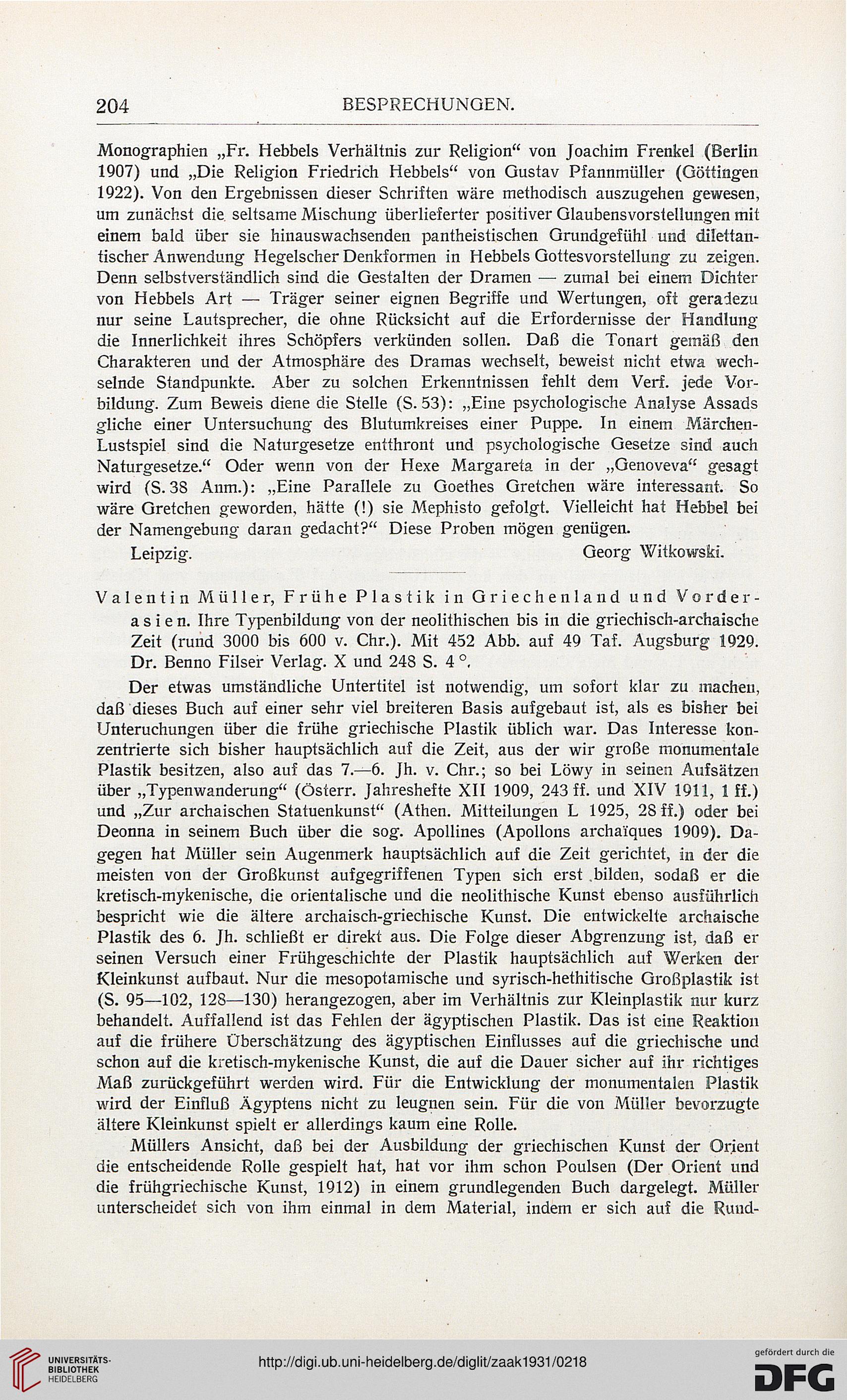204
BESPRECHUNGEN.
Monographien „Fr. Hebbels Verhältnis zur Religion" von Joachim Frenkel (Berlin
1907) und „Die Religion Friedrich Hebbels" von Gustav Pfannmüller (Göttingen
1922). Von den Ergebnissen dieser Schriften wäre methodisch auszugehen gewesen,
um zunächst die seltsame Mischung überlieferter positiver Glaubensvorstellungen mit
einem bald über sie hinauswachsenden pantheistischen Grundgefühl und dilettan-
tischer Anwendung Hegelscher Denkformen in Hebbels Gottesvorstellung zu zeigen.
Denn selbstverständlich sind die Gestalten der Dramen — zumal bei einem Dichter
von Hebbels Art — Träger seiner eignen Begriffe und Wertungen, oft geradezu
nur seine Lautsprecher, die ohne Rücksicht auf die Erfordernisse der Handlung
die Innerlichkeit ihres Schöpfers verkünden sollen. Daß die Tonart gemäß den
Charakteren und der Atmosphäre des Dramas wechselt, beweist nicht etwa wech-
selnde Standpunkte. Aber zu solchen Erkenntnissen fehlt dem Verf. jede Vor-
bildung. Zum Beweis diene die Stelle (S. 53): „Eine psychologische Analyse Assads
gliche einer Untersuchung des Blutumkreises einer Puppe. In einem Märchen-
Lustspiel sind die Naturgesetze entthront und psychologische Gesetze sind auch
Naturgesetze." Oder wenn von der Hexe Margareta in der „Genoveva" gesagt
wird (S. 38 Anm.): „Eine Parallele zu Goethes Gretchen wäre interessant. So
wäre Gretchen geworden, hätte (!) sie Mephisto gefolgt. Vielleicht hat Hebbel bei
der Namengebung daran gedacht?" Diese Proben mögen genügen.
Leipzig. Georg Witkowski.
Valentin Müller, Frühe Plastik in Griechenland und Vorder-
a s i e n. Ihre Typenbildung von der neolithischen bis in die griechisch-archaische
Zeit (rund 3000 bis 600 v. Chr.). Mit 452 Abb. auf 49 Taf. Augsburg 1929.
Dr. Benno Filser Verlag. X und 248 S. 4 °.
Der etwas umständliche Untertitel ist notwendig, um sofort klar zu machen,
daß dieses Buch auf einer sehr viel breiteren Basis aufgebaut ist, als es bisher bei
Unteruchungen über die frühe griechische Plastik üblich war. Das Interesse kon-
zentrierte sich bisher hauptsächlich auf die Zeit, aus der wir große monumentale
Plastik besitzen, also auf das 7.—6. Jh. v. Chr.; so bei Löwy in seinen Aufsätzen
über „Typenwanderung" (Österr. Jahreshefte XII 1909, 243 ff. und XIV 1911, 1 ff.)
und „Zur archaischen Statuenkunst" (Athen. Mitteilungen L 1925, 28 ff.) oder bei
Deonna in seinem Buch über die sog. Apollines (Apollons archa'iques 1909). Da-
gegen hat Müller sein Augenmerk hauptsächlich auf die Zeit gerichtet, in der die
meisten von der Großkunst aufgegriffenen Typen sich erst .bilden, sodaß er die
kretisch-mykenische, die orientalische und die neolithische Kunst ebenso ausführlich
bespricht wie die ältere archaisch-griechische Kunst. Die entwickelte archaische
Plastik des 6. Jh. schließt er direkt aus. Die Folge dieser Abgrenzung ist, daß ei-
sernen Versuch einer Frühgeschichte der Plastik hauptsächlich auf Werken der
Kleinkunst aufbaut. Nur die mesopotamische und syrisch-hethitische Großplastik ist
(S. 95—102, 128—130) herangezogen, aber im Verhältnis zur Kleinplastik nur kurz
behandelt. Auffallend ist das Fehlen der ägyptischen Plastik. Das ist eine Reaktion
auf die frühere Überschätzung des ägyptischen Einflusses auf die griechische und
schon auf die kretisch-mykenische Kunst, die auf die Dauer sicher auf ihr richtiges
Maß zurückgeführt werden wird. Für die Entwicklung der monumentalen Plastik
wird der Einfluß Ägyptens nicht zu leugnen sein. Für die von Müller bevorzugte
ältere Kleinkunst spielt er allerdings kaum eine Rolle.
Müllers Ansicht, daß bei der Ausbildung der griechischen Kunst der Orient
die entscheidende Rolle gespielt hat, hat vor ihm schon Poulsen (Der Orient und
die frühgriechische Kunst, 1912) in einem grundlegenden Buch dargelegt. Müller
unterscheidet sich von ihm einmal in dem Material, indem er sich auf die Rund-
BESPRECHUNGEN.
Monographien „Fr. Hebbels Verhältnis zur Religion" von Joachim Frenkel (Berlin
1907) und „Die Religion Friedrich Hebbels" von Gustav Pfannmüller (Göttingen
1922). Von den Ergebnissen dieser Schriften wäre methodisch auszugehen gewesen,
um zunächst die seltsame Mischung überlieferter positiver Glaubensvorstellungen mit
einem bald über sie hinauswachsenden pantheistischen Grundgefühl und dilettan-
tischer Anwendung Hegelscher Denkformen in Hebbels Gottesvorstellung zu zeigen.
Denn selbstverständlich sind die Gestalten der Dramen — zumal bei einem Dichter
von Hebbels Art — Träger seiner eignen Begriffe und Wertungen, oft geradezu
nur seine Lautsprecher, die ohne Rücksicht auf die Erfordernisse der Handlung
die Innerlichkeit ihres Schöpfers verkünden sollen. Daß die Tonart gemäß den
Charakteren und der Atmosphäre des Dramas wechselt, beweist nicht etwa wech-
selnde Standpunkte. Aber zu solchen Erkenntnissen fehlt dem Verf. jede Vor-
bildung. Zum Beweis diene die Stelle (S. 53): „Eine psychologische Analyse Assads
gliche einer Untersuchung des Blutumkreises einer Puppe. In einem Märchen-
Lustspiel sind die Naturgesetze entthront und psychologische Gesetze sind auch
Naturgesetze." Oder wenn von der Hexe Margareta in der „Genoveva" gesagt
wird (S. 38 Anm.): „Eine Parallele zu Goethes Gretchen wäre interessant. So
wäre Gretchen geworden, hätte (!) sie Mephisto gefolgt. Vielleicht hat Hebbel bei
der Namengebung daran gedacht?" Diese Proben mögen genügen.
Leipzig. Georg Witkowski.
Valentin Müller, Frühe Plastik in Griechenland und Vorder-
a s i e n. Ihre Typenbildung von der neolithischen bis in die griechisch-archaische
Zeit (rund 3000 bis 600 v. Chr.). Mit 452 Abb. auf 49 Taf. Augsburg 1929.
Dr. Benno Filser Verlag. X und 248 S. 4 °.
Der etwas umständliche Untertitel ist notwendig, um sofort klar zu machen,
daß dieses Buch auf einer sehr viel breiteren Basis aufgebaut ist, als es bisher bei
Unteruchungen über die frühe griechische Plastik üblich war. Das Interesse kon-
zentrierte sich bisher hauptsächlich auf die Zeit, aus der wir große monumentale
Plastik besitzen, also auf das 7.—6. Jh. v. Chr.; so bei Löwy in seinen Aufsätzen
über „Typenwanderung" (Österr. Jahreshefte XII 1909, 243 ff. und XIV 1911, 1 ff.)
und „Zur archaischen Statuenkunst" (Athen. Mitteilungen L 1925, 28 ff.) oder bei
Deonna in seinem Buch über die sog. Apollines (Apollons archa'iques 1909). Da-
gegen hat Müller sein Augenmerk hauptsächlich auf die Zeit gerichtet, in der die
meisten von der Großkunst aufgegriffenen Typen sich erst .bilden, sodaß er die
kretisch-mykenische, die orientalische und die neolithische Kunst ebenso ausführlich
bespricht wie die ältere archaisch-griechische Kunst. Die entwickelte archaische
Plastik des 6. Jh. schließt er direkt aus. Die Folge dieser Abgrenzung ist, daß ei-
sernen Versuch einer Frühgeschichte der Plastik hauptsächlich auf Werken der
Kleinkunst aufbaut. Nur die mesopotamische und syrisch-hethitische Großplastik ist
(S. 95—102, 128—130) herangezogen, aber im Verhältnis zur Kleinplastik nur kurz
behandelt. Auffallend ist das Fehlen der ägyptischen Plastik. Das ist eine Reaktion
auf die frühere Überschätzung des ägyptischen Einflusses auf die griechische und
schon auf die kretisch-mykenische Kunst, die auf die Dauer sicher auf ihr richtiges
Maß zurückgeführt werden wird. Für die Entwicklung der monumentalen Plastik
wird der Einfluß Ägyptens nicht zu leugnen sein. Für die von Müller bevorzugte
ältere Kleinkunst spielt er allerdings kaum eine Rolle.
Müllers Ansicht, daß bei der Ausbildung der griechischen Kunst der Orient
die entscheidende Rolle gespielt hat, hat vor ihm schon Poulsen (Der Orient und
die frühgriechische Kunst, 1912) in einem grundlegenden Buch dargelegt. Müller
unterscheidet sich von ihm einmal in dem Material, indem er sich auf die Rund-