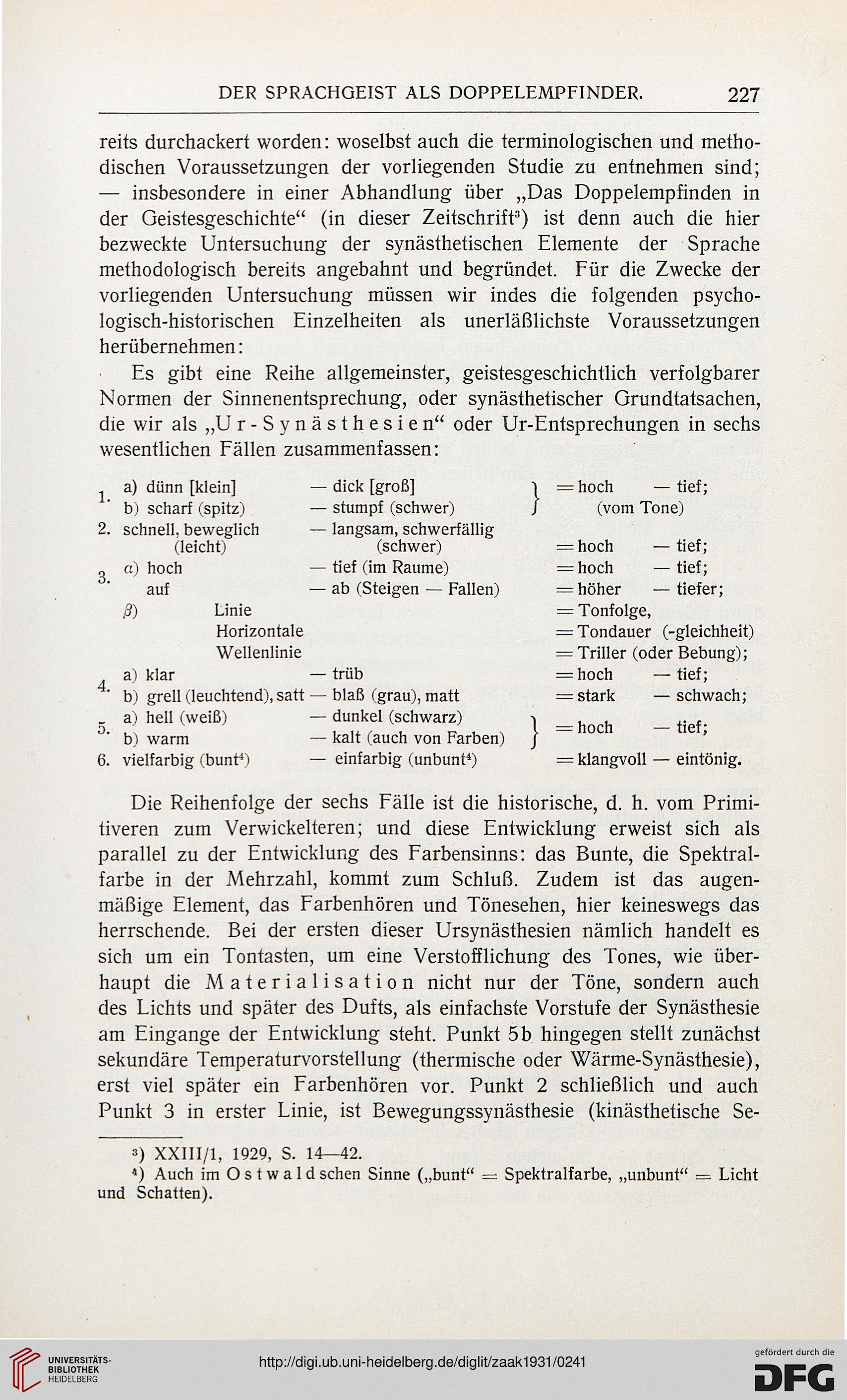DER SPRACHGEIST ALS DOPPELEMPFINDER. 227
reits durchackert worden: woselbst auch die terminologischen und metho-
dischen Voraussetzungen der vorliegenden Studie zu entnehmen sind;
— insbesondere in einer Abhandlung über „Das Doppelempfinden in
der Geistesgeschichte" (in dieser Zeitschrift3) ist denn auch die hier
bezweckte Untersuchung der synästhetischen Elemente der Sprache
methodologisch bereits angebahnt und begründet. Für die Zwecke der
vorliegenden Untersuchung müssen wir indes die folgenden psycho-
logisch-historischen Einzelheiten als unerläßlichste Voraussetzungen
herübernehmen:
Es gibt eine Reihe allgemeinster, geistesgeschichtlich verfolgbarer
Normen der Sinnenentsprechung, oder synästhetischer Grundtatsachen,
die wir als „U r - S y n ä s t h e s i e n" oder Ur-Entsprechungen in sechs
wesentlichen Fällen zusammenfassen:
j a) dünn [klein]
b) scharf (spitz)
2. schnell, beweglich
(leicht)
„ et) hoch
auf
ß) Linie
Horizontale
Wellenlinie
a) klar
b) grell (leuchtend), satt
_ a) hell (weiß)
b) warm
6. vielfarbig (bunt4)
dick [groß]
stumpf (schwer)
langsam, schwerfällig
(schwer)
tief (im Räume)
ab (Steigen — Fallen)
trüb
blaß (grau), matt
dunkel (schwarz)
kalt (auch von Farben)
einfarbig (unbunt4)
= hoch — tief;
(vom Tone)
= hoch — tief;
= hoch —tief;
= höher — tiefer;
= Tonfolge,
= Tondauer (-gleichheit)
= Triller (oder Bebung);
= hoch — tief;
= stark —schwach;
= hoch — tief;
= klangvoll — eintönig.
Die Reihenfolge der sechs Fälle ist die historische, d. h. vom Primi-
tiveren zum Verwickelteren; und diese Entwicklung erweist sich als
parallel zu der Entwicklung des Farbensinns: das Bunte, die Spektral-
farbe in der Mehrzahl, kommt zum Schluß. Zudem ist das augen-
mäßige Element, das Farbenhören und Tönesehen, hier keineswegs das
herrschende. Bei der ersten dieser Ursynästhesien nämlich handelt es
sich um ein Tontasten, um eine Verstofflichung des Tones, wie über-
haupt die Materialisation nicht nur der Töne, sondern auch
des Lichts und später des Dufts, als einfachste Vorstufe der Synästhesie
am Eingange der Entwicklung steht. Punkt 5 b hingegen stellt zunächst
sekundäre Temperaturvorstellung (thermische oder Wärme-Synästhesie),
erst viel später ein Farbenhören vor. Punkt 2 schließlich und auch
Punkt 3 in erster Linie, ist Bewegungssynästhesie (kinästhetische Se-
3) XXIII/l, 1929, S. 14—42.
*) Auch im O s t w a 1 d sehen Sinne („bunt" = Spektralfarbe, „unbunt" = Licht
und Schatten).
reits durchackert worden: woselbst auch die terminologischen und metho-
dischen Voraussetzungen der vorliegenden Studie zu entnehmen sind;
— insbesondere in einer Abhandlung über „Das Doppelempfinden in
der Geistesgeschichte" (in dieser Zeitschrift3) ist denn auch die hier
bezweckte Untersuchung der synästhetischen Elemente der Sprache
methodologisch bereits angebahnt und begründet. Für die Zwecke der
vorliegenden Untersuchung müssen wir indes die folgenden psycho-
logisch-historischen Einzelheiten als unerläßlichste Voraussetzungen
herübernehmen:
Es gibt eine Reihe allgemeinster, geistesgeschichtlich verfolgbarer
Normen der Sinnenentsprechung, oder synästhetischer Grundtatsachen,
die wir als „U r - S y n ä s t h e s i e n" oder Ur-Entsprechungen in sechs
wesentlichen Fällen zusammenfassen:
j a) dünn [klein]
b) scharf (spitz)
2. schnell, beweglich
(leicht)
„ et) hoch
auf
ß) Linie
Horizontale
Wellenlinie
a) klar
b) grell (leuchtend), satt
_ a) hell (weiß)
b) warm
6. vielfarbig (bunt4)
dick [groß]
stumpf (schwer)
langsam, schwerfällig
(schwer)
tief (im Räume)
ab (Steigen — Fallen)
trüb
blaß (grau), matt
dunkel (schwarz)
kalt (auch von Farben)
einfarbig (unbunt4)
= hoch — tief;
(vom Tone)
= hoch — tief;
= hoch —tief;
= höher — tiefer;
= Tonfolge,
= Tondauer (-gleichheit)
= Triller (oder Bebung);
= hoch — tief;
= stark —schwach;
= hoch — tief;
= klangvoll — eintönig.
Die Reihenfolge der sechs Fälle ist die historische, d. h. vom Primi-
tiveren zum Verwickelteren; und diese Entwicklung erweist sich als
parallel zu der Entwicklung des Farbensinns: das Bunte, die Spektral-
farbe in der Mehrzahl, kommt zum Schluß. Zudem ist das augen-
mäßige Element, das Farbenhören und Tönesehen, hier keineswegs das
herrschende. Bei der ersten dieser Ursynästhesien nämlich handelt es
sich um ein Tontasten, um eine Verstofflichung des Tones, wie über-
haupt die Materialisation nicht nur der Töne, sondern auch
des Lichts und später des Dufts, als einfachste Vorstufe der Synästhesie
am Eingange der Entwicklung steht. Punkt 5 b hingegen stellt zunächst
sekundäre Temperaturvorstellung (thermische oder Wärme-Synästhesie),
erst viel später ein Farbenhören vor. Punkt 2 schließlich und auch
Punkt 3 in erster Linie, ist Bewegungssynästhesie (kinästhetische Se-
3) XXIII/l, 1929, S. 14—42.
*) Auch im O s t w a 1 d sehen Sinne („bunt" = Spektralfarbe, „unbunt" = Licht
und Schatten).