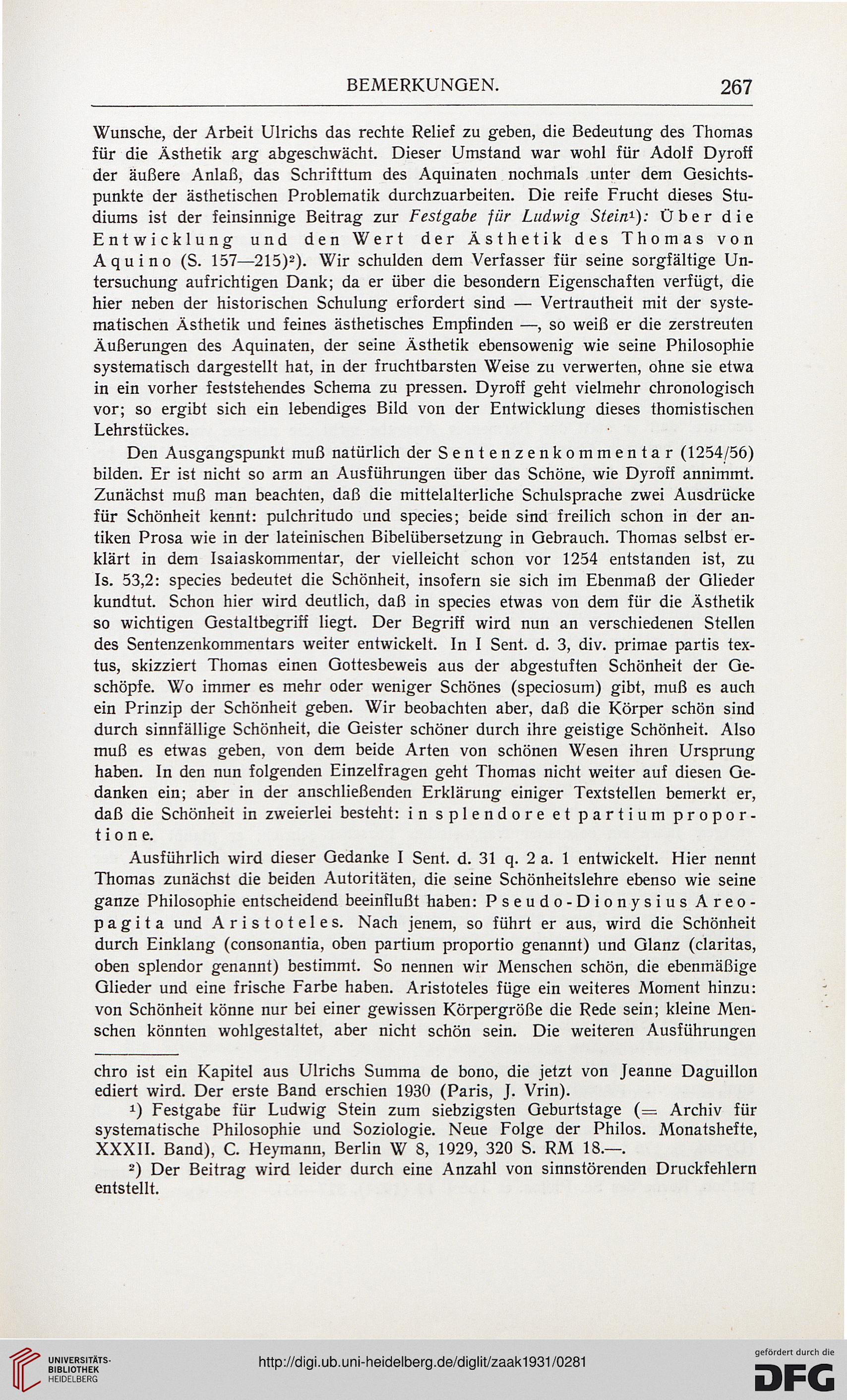BEMERKUNGEN.
267
Wunsche, der Arbeit Ulrichs das rechte Relief zu geben, die Bedeutung- des Thomas
für die Ästhetik arg abgeschwächt. Dieser Umstand war wohl für Adolf Dyroff
der äußere Anlaß, das Schrifttum des Aquinaten nochmals unter dem Gesichts-
punkte der ästhetischen Problematik durchzuarbeiten. Die reife Frucht dieses Stu-
diums ist der feinsinnige Beitrag zur Festgabe für Ludwig Stein1): Über die
Entwicklung und den Wert der Ästhetik des Thomas von
Aquino (S. 157—215)2). Wir schulden dem Verfasser für seine sorgfältige Un-
tersuchung aufrichtigen Dank; da er über die besondern Eigenschaften verfügt, die
hier neben der historischen Schulung erfordert sind — Vertrautheit mit der syste-
matischen Ästhetik und feines ästhetisches Empfinden —, so weiß er die zerstreuten
Äußerungen des Aquinaten, der seine Ästhetik ebensowenig wie seine Philosophie
systematisch dargestellt hat, in der fruchtbarsten Weise zu verwerten, ohne sie etwa
in ein vorher feststehendes Schema zu pressen. Dyroff geht vielmehr chronologisch
vor; so ergibt sich ein lebendiges Bild von der Entwicklung dieses thomistischen
Lehrstückes.
Den Ausgangspunkt muß natürlich der Sentenzenkommentar (1254/56)
bilden. Er ist nicht so arm an Ausführungen über das Schöne, wie Dyroff annimmt.
Zunächst muß man beachten, daß die mittelalterliche Schulsprache zwei Ausdrücke
für Schönheit kennt: pulchritudo und species; beide sind freilich schon in der an-
tiken Prosa wie in der lateinischen Bibelübersetzung in Gebrauch. Thomas selbst er-
klärt in dem Isaiaskommentar, der vielleicht schon vor 1254 entstanden ist, zu
Is. 53,2: species bedeutet die Schönheit, insofern sie sich im Ebenmaß der Glieder
kundtut. Schon hier wird deutlich, daß in species etwas von dem für die Ästhetik
so wichtigen Gestaltbegriff liegt. Der Begriff wird nun an verschiedenen Stellen
des Sentenzenkommentars weiter entwickelt. In I Sent. d. 3, div. primae partis tex-
tus, skizziert Thomas einen Gottesbeweis aus der abgestuften Schönheit der Ge-
schöpfe. Wo immer es mehr oder weniger Schönes (speciosum) gibt, muß es auch
ein Prinzip der Schönheit geben. Wir beobachten aber, daß die Körper schön sind
durch sinnfällige Schönheit, die Geister schöner durch ihre geistige Schönheit. Also
muß es etwas geben, von dem beide Arten von schönen Wesen ihren Ursprung
haben. In den nun folgenden Einzelfragen geht Thomas nicht weiter auf diesen Ge-
danken ein; aber in der anschließenden Erklärung einiger Textstellen bemerkt er,
daß die Schönheit in zweierlei besteht: in splendore et partium Propor-
tion e.
Ausführlich wird dieser Gedanke I Sent. d. 31 q. 2 a. 1 entwickelt. Hier nennt
Thomas zunächst die beiden Autoritäten, die seine Schönheitslehre ebenso wie seine
ganze Philosophie entscheidend beeinflußt haben: Pseudo-Dionysius Areo-
p a g i t a und Aristoteles. Nach jenem, so führt er aus, wird die Schönheit
durch Einklang (consonantia, oben partium proportio genannt) und Glanz (claritas,
oben splendor genannt) bestimmt. So nennen wir Menschen schön, die ebenmäßige
Glieder und eine frische Farbe haben. Aristoteles füge ein weiteres Moment hinzu:
von Schönheit könne nur bei einer gewissen Körpergröße die Rede sein; kleine Men-
schen könnten wohlgestaltet, aber nicht schön sein. Die weiteren Ausführungen
chro ist ein Kapitel aus Ulrichs Summa de bono, die jetzt von Jeanne Daguillon
ediert wird. Der erste Band erschien 1930 (Paris, J. Vrin).
*) Festgabe für Ludwig Stein zum siebzigsten Geburtstage (= Archiv für
systematische Philosophie und Soziologie. Neue Folge der Philos. Monatshefte,
XXXII. Band), C. Heymann, Berlin W 8, 1929, 320 S. RM 18.—.
-') Der Beitrag wird leider durch eine Anzahl von sinnstörenden Druckfehlern
entstellt.
267
Wunsche, der Arbeit Ulrichs das rechte Relief zu geben, die Bedeutung- des Thomas
für die Ästhetik arg abgeschwächt. Dieser Umstand war wohl für Adolf Dyroff
der äußere Anlaß, das Schrifttum des Aquinaten nochmals unter dem Gesichts-
punkte der ästhetischen Problematik durchzuarbeiten. Die reife Frucht dieses Stu-
diums ist der feinsinnige Beitrag zur Festgabe für Ludwig Stein1): Über die
Entwicklung und den Wert der Ästhetik des Thomas von
Aquino (S. 157—215)2). Wir schulden dem Verfasser für seine sorgfältige Un-
tersuchung aufrichtigen Dank; da er über die besondern Eigenschaften verfügt, die
hier neben der historischen Schulung erfordert sind — Vertrautheit mit der syste-
matischen Ästhetik und feines ästhetisches Empfinden —, so weiß er die zerstreuten
Äußerungen des Aquinaten, der seine Ästhetik ebensowenig wie seine Philosophie
systematisch dargestellt hat, in der fruchtbarsten Weise zu verwerten, ohne sie etwa
in ein vorher feststehendes Schema zu pressen. Dyroff geht vielmehr chronologisch
vor; so ergibt sich ein lebendiges Bild von der Entwicklung dieses thomistischen
Lehrstückes.
Den Ausgangspunkt muß natürlich der Sentenzenkommentar (1254/56)
bilden. Er ist nicht so arm an Ausführungen über das Schöne, wie Dyroff annimmt.
Zunächst muß man beachten, daß die mittelalterliche Schulsprache zwei Ausdrücke
für Schönheit kennt: pulchritudo und species; beide sind freilich schon in der an-
tiken Prosa wie in der lateinischen Bibelübersetzung in Gebrauch. Thomas selbst er-
klärt in dem Isaiaskommentar, der vielleicht schon vor 1254 entstanden ist, zu
Is. 53,2: species bedeutet die Schönheit, insofern sie sich im Ebenmaß der Glieder
kundtut. Schon hier wird deutlich, daß in species etwas von dem für die Ästhetik
so wichtigen Gestaltbegriff liegt. Der Begriff wird nun an verschiedenen Stellen
des Sentenzenkommentars weiter entwickelt. In I Sent. d. 3, div. primae partis tex-
tus, skizziert Thomas einen Gottesbeweis aus der abgestuften Schönheit der Ge-
schöpfe. Wo immer es mehr oder weniger Schönes (speciosum) gibt, muß es auch
ein Prinzip der Schönheit geben. Wir beobachten aber, daß die Körper schön sind
durch sinnfällige Schönheit, die Geister schöner durch ihre geistige Schönheit. Also
muß es etwas geben, von dem beide Arten von schönen Wesen ihren Ursprung
haben. In den nun folgenden Einzelfragen geht Thomas nicht weiter auf diesen Ge-
danken ein; aber in der anschließenden Erklärung einiger Textstellen bemerkt er,
daß die Schönheit in zweierlei besteht: in splendore et partium Propor-
tion e.
Ausführlich wird dieser Gedanke I Sent. d. 31 q. 2 a. 1 entwickelt. Hier nennt
Thomas zunächst die beiden Autoritäten, die seine Schönheitslehre ebenso wie seine
ganze Philosophie entscheidend beeinflußt haben: Pseudo-Dionysius Areo-
p a g i t a und Aristoteles. Nach jenem, so führt er aus, wird die Schönheit
durch Einklang (consonantia, oben partium proportio genannt) und Glanz (claritas,
oben splendor genannt) bestimmt. So nennen wir Menschen schön, die ebenmäßige
Glieder und eine frische Farbe haben. Aristoteles füge ein weiteres Moment hinzu:
von Schönheit könne nur bei einer gewissen Körpergröße die Rede sein; kleine Men-
schen könnten wohlgestaltet, aber nicht schön sein. Die weiteren Ausführungen
chro ist ein Kapitel aus Ulrichs Summa de bono, die jetzt von Jeanne Daguillon
ediert wird. Der erste Band erschien 1930 (Paris, J. Vrin).
*) Festgabe für Ludwig Stein zum siebzigsten Geburtstage (= Archiv für
systematische Philosophie und Soziologie. Neue Folge der Philos. Monatshefte,
XXXII. Band), C. Heymann, Berlin W 8, 1929, 320 S. RM 18.—.
-') Der Beitrag wird leider durch eine Anzahl von sinnstörenden Druckfehlern
entstellt.