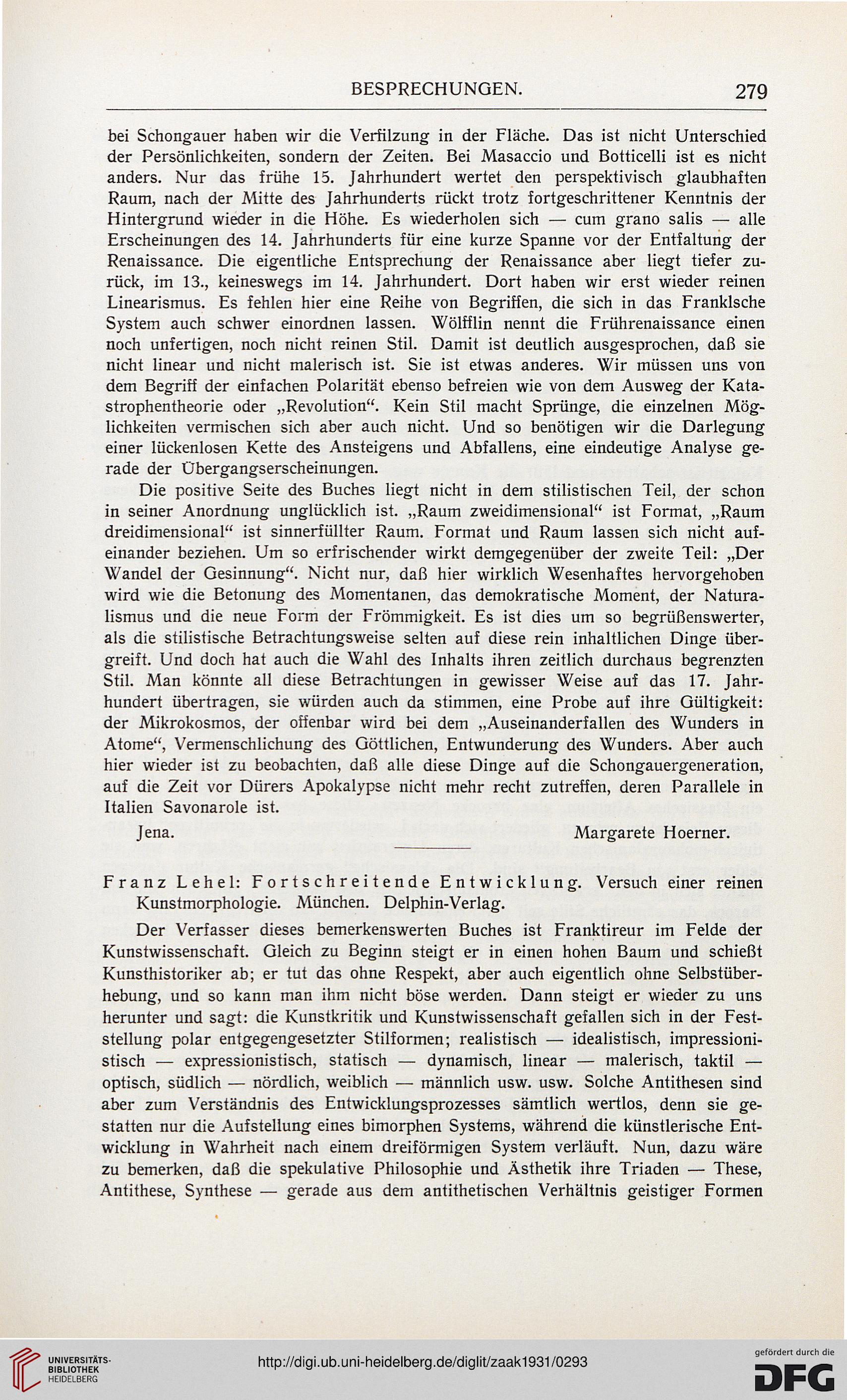BESPRECHUNGEN.
279
bei Schongauer haben wir die Verfilzung in der Fläche. Das ist nicht Unterschied
der Persönlichkeiten, sondern der Zeiten. Bei Masaccio und Botticelli ist es nicht
anders. Nur das frühe 15. Jahrhundert wertet den perspektivisch glaubhaften
Raum, nach der Mitte des Jahrhunderts rückt trotz fortgeschrittener Kenntnis der
Hintergrund wieder in die Höhe. Es wiederholen sich — cum grano salis — alle
Erscheinungen des 14. Jahrhunderts für eine kurze Spanne vor der Entfaltung der
Renaissance. Die eigentliche Entsprechung der Renaissance aber liegt tiefer zu-
rück, im 13., keineswegs im 14. Jahrhundert. Dort haben wir erst wieder reinen
Linearismus. Es fehlen hier eine Reihe von Begriffen, die sich in das Frankische
System auch schwer einordnen lassen. Wölfflin nennt die Frührenaissance einen
noch unfertigen, noch nicht reinen Stil. Damit ist deutlich ausgesprochen, daß sie
nicht linear und nicht malerisch ist. Sie ist etwas anderes. Wir müssen uns von
dem Begriff der einfachen Polarität ebenso befreien wie von dem Ausweg der Kata-
strophentheorie oder „Revolution". Kein Stil macht Sprünge, die einzelnen Mög-
lichkeiten vermischen sich aber auch nicht. Und so benötigen wir die Darlegung
einer lückenlosen Kette des Ansteigens und Abfallens, eine eindeutige Analyse ge-
rade der Übergangserscheinungen.
Die positive Seite des Buches liegt nicht in dem stilistischen Teil, der schon
in seiner Anordnung unglücklich ist. „Raum zweidimensional" ist Format, „Raum
dreidimensional" ist sinnerfüllter Raum. Format und Raum lassen sich nicht auf-
einander beziehen. Um so erfrischender wirkt demgegenüber der zweite Teil: „Der
Wandel der Gesinnung". Nicht nur, daß hier wirklich Wesenhaftes hervorgehoben
wird wie die Betonung des Momentanen, das demokratische Moment, der Natura-
lismus und die neue Form der Frömmigkeit. Es ist dies um so begrüßenswerter,
als die stilistische Betrachtungsweise selten auf diese rein inhaltlichen Dinge über-
greift. Und doch hat auch die Wahl des Inhalts ihren zeitlich durchaus begrenzten
Stil. Man könnte all diese Betrachtungen in gewisser Weise auf das 17. Jahr-
hundert übertragen, sie würden auch da stimmen, eine Probe auf ihre Gültigkeit:
der Mikrokosmos, der offenbar wird bei dem „Auseinanderfallen des Wunders in
Atome", Vermenschlichung des Göttlichen, Entwunderung des Wunders. Aber auch
hier wieder ist zu beobachten, daß alle diese Dinge auf die Schongauergeneration,
auf die Zeit vor Dürers Apokalypse nicht mehr recht zutreffen, deren Parallele in
Italien Savonarole ist.
Jena. Margarete Hoerner.
Franz Lehel: Fortschreitende Entwicklung. Versuch einer reinen
Kunstmorphologie. München. Delphin-Verlag.
Der Verfasser dieses bemerkenswerten Buches ist Franktireur im Felde der
Kunstwissenschaft. Gleich zu Beginn steigt er in einen hohen Baum und schießt
Kunsthistoriker ab; er tut das ohne Respekt, aber auch eigentlich ohne Selbstüber-
hebung, und so kann man ihm nicht böse werden. Dann steigt er wieder zu uns
herunter und sagt: die Kunstkritik und Kunstwissenschaft gefallen sich in der Fest-
stellung polar entgegengesetzter Stilformen; realistisch — idealistisch, impressioni-
stisch — expressionistisch, statisch — dynamisch, linear — malerisch, taktil —
optisch, südlich — nördlich, weiblich — männlich usw. usw. Solche Antithesen sind
aber zum Verständnis des Entwicklungsprozesses sämtlich wertlos, denn sie ge-
statten nur die Aufstellung eines bimorphen Systems, während die künstlerische Ent-
wicklung in Wahrheit nach einem dreiförmigen System verläuft. Nun, dazu wäre
zu bemerken, daß die spekulative Philosophie und Ästhetik ihre Triaden — These,
Antithese, Synthese — gerade aus dem antithetischen Verhältnis geistiger Formen
279
bei Schongauer haben wir die Verfilzung in der Fläche. Das ist nicht Unterschied
der Persönlichkeiten, sondern der Zeiten. Bei Masaccio und Botticelli ist es nicht
anders. Nur das frühe 15. Jahrhundert wertet den perspektivisch glaubhaften
Raum, nach der Mitte des Jahrhunderts rückt trotz fortgeschrittener Kenntnis der
Hintergrund wieder in die Höhe. Es wiederholen sich — cum grano salis — alle
Erscheinungen des 14. Jahrhunderts für eine kurze Spanne vor der Entfaltung der
Renaissance. Die eigentliche Entsprechung der Renaissance aber liegt tiefer zu-
rück, im 13., keineswegs im 14. Jahrhundert. Dort haben wir erst wieder reinen
Linearismus. Es fehlen hier eine Reihe von Begriffen, die sich in das Frankische
System auch schwer einordnen lassen. Wölfflin nennt die Frührenaissance einen
noch unfertigen, noch nicht reinen Stil. Damit ist deutlich ausgesprochen, daß sie
nicht linear und nicht malerisch ist. Sie ist etwas anderes. Wir müssen uns von
dem Begriff der einfachen Polarität ebenso befreien wie von dem Ausweg der Kata-
strophentheorie oder „Revolution". Kein Stil macht Sprünge, die einzelnen Mög-
lichkeiten vermischen sich aber auch nicht. Und so benötigen wir die Darlegung
einer lückenlosen Kette des Ansteigens und Abfallens, eine eindeutige Analyse ge-
rade der Übergangserscheinungen.
Die positive Seite des Buches liegt nicht in dem stilistischen Teil, der schon
in seiner Anordnung unglücklich ist. „Raum zweidimensional" ist Format, „Raum
dreidimensional" ist sinnerfüllter Raum. Format und Raum lassen sich nicht auf-
einander beziehen. Um so erfrischender wirkt demgegenüber der zweite Teil: „Der
Wandel der Gesinnung". Nicht nur, daß hier wirklich Wesenhaftes hervorgehoben
wird wie die Betonung des Momentanen, das demokratische Moment, der Natura-
lismus und die neue Form der Frömmigkeit. Es ist dies um so begrüßenswerter,
als die stilistische Betrachtungsweise selten auf diese rein inhaltlichen Dinge über-
greift. Und doch hat auch die Wahl des Inhalts ihren zeitlich durchaus begrenzten
Stil. Man könnte all diese Betrachtungen in gewisser Weise auf das 17. Jahr-
hundert übertragen, sie würden auch da stimmen, eine Probe auf ihre Gültigkeit:
der Mikrokosmos, der offenbar wird bei dem „Auseinanderfallen des Wunders in
Atome", Vermenschlichung des Göttlichen, Entwunderung des Wunders. Aber auch
hier wieder ist zu beobachten, daß alle diese Dinge auf die Schongauergeneration,
auf die Zeit vor Dürers Apokalypse nicht mehr recht zutreffen, deren Parallele in
Italien Savonarole ist.
Jena. Margarete Hoerner.
Franz Lehel: Fortschreitende Entwicklung. Versuch einer reinen
Kunstmorphologie. München. Delphin-Verlag.
Der Verfasser dieses bemerkenswerten Buches ist Franktireur im Felde der
Kunstwissenschaft. Gleich zu Beginn steigt er in einen hohen Baum und schießt
Kunsthistoriker ab; er tut das ohne Respekt, aber auch eigentlich ohne Selbstüber-
hebung, und so kann man ihm nicht böse werden. Dann steigt er wieder zu uns
herunter und sagt: die Kunstkritik und Kunstwissenschaft gefallen sich in der Fest-
stellung polar entgegengesetzter Stilformen; realistisch — idealistisch, impressioni-
stisch — expressionistisch, statisch — dynamisch, linear — malerisch, taktil —
optisch, südlich — nördlich, weiblich — männlich usw. usw. Solche Antithesen sind
aber zum Verständnis des Entwicklungsprozesses sämtlich wertlos, denn sie ge-
statten nur die Aufstellung eines bimorphen Systems, während die künstlerische Ent-
wicklung in Wahrheit nach einem dreiförmigen System verläuft. Nun, dazu wäre
zu bemerken, daß die spekulative Philosophie und Ästhetik ihre Triaden — These,
Antithese, Synthese — gerade aus dem antithetischen Verhältnis geistiger Formen