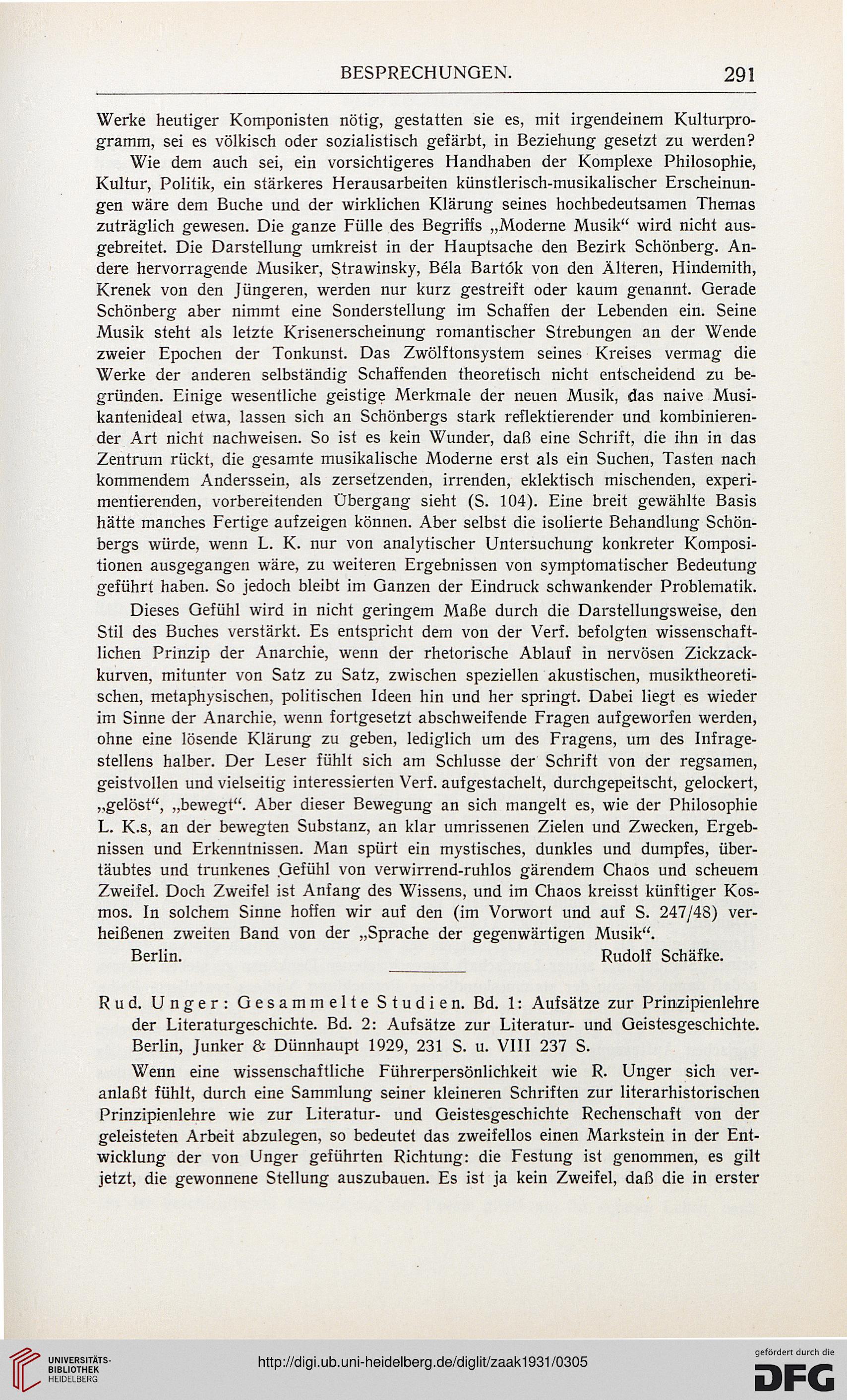BESPRECHUNGEN.
291
Werke heutiger Komponisten nötig, gestatten sie es, mit irgendeinem Kulturpro-
gramm, sei es völkisch oder sozialistisch gefärbt, in Beziehung gesetzt zu werden?
Wie dem auch sei, ein vorsichtigeres Handhaben der Komplexe Philosophie,
Kultur, Politik, ein stärkeres Herausarbeiten künstlerisch-musikalischer Erscheinun-
gen wäre dem Buche und der wirklichen Klärung seines hochbedeutsamen Themas
zuträglich gewesen. Die ganze Fülle des Begriffs „Moderne Musik" wird nicht aus-
gebreitet. Die Darstellung umkreist in der Hauptsache den Bezirk Schönberg. An-
dere hervorragende Musiker, Strawinsky, Bela Bartök von den Älteren, Hindemith,
Krenek von den Jüngeren, werden nur kurz gestreift oder kaum genannt. Gerade
Schönberg aber nimmt eine Sonderstellung im Schaffen der Lebenden ein. Seine
Musik steht als letzte Krisenerscheinung romantischer Strebungen an der Wende
zweier Epochen der Tonkunst. Das Zwölftonsystem seines Kreises vermag die
Werke der anderen selbständig Schaffenden theoretisch nicht entscheidend zu be-
gründen. Einige wesentliche geistige Merkmale der neuen Musik, das naive Musi-
kantenideal etwa, lassen sich an Schönbergs stark reflektierender und kombinieren-
der Art nicht nachweisen. So ist es kein Wunder, daß eine Schrift, die ihn in das
Zentrum rückt, die gesamte musikalische Moderne erst als ein Suchen, Tasten nach
kommendem Anderssein, als zersetzenden, irrenden, eklektisch mischenden, experi-
mentierenden, vorbereitenden Übergang sieht (S. 104). Eine breit gewählte Basis
hätte manches Fertige aufzeigen können. Aber selbst die isolierte Behandlung Schön-
bergs würde, wenn L. K. nur von analytischer Untersuchung konkreter Komposi-
tionen ausgegangen wäre, zu weiteren Ergebnissen von symptomatischer Bedeutung
geführt haben. So jedoch bleibt im Ganzen der Eindruck schwankender Problematik.
Dieses Gefühl wird in nicht geringem Maße durch die Darstellungsweise, den
Stil des Buches verstärkt. Es entspricht dem von der Verf. befolgten wissenschaft-
lichen Prinzip der Anarchie, wenn der rhetorische Ablauf in nervösen Zickzack-
kurven, mitunter von Satz zu Satz, zwischen speziellen akustischen, musiktheoreti-
schen, metaphysischen, politischen Ideen hin und her springt. Dabei liegt es wieder
im Sinne der Anarchie, wenn fortgesetzt abschweifende Fragen aufgeworfen werden,
ohne eine lösende Klärung zu geben, lediglich um des Fragens, um des Infrage-
stellens halber. Der Leser fühlt sich am Schlüsse der Schrift von der regsamen,
geistvollen und vielseitig interessierten Verf. aufgestachelt, durchgepeitscht, gelockert,
„gelöst", „bewegt". Aber dieser Bewegung an sich mangelt es, wie der Philosophie
L. K.s, an der bewegten Substanz, an klar umrissenen Zielen und Zwecken, Ergeb-
nissen und Erkenntnissen. Man spürt ein mystisches, dunkles und dumpfes, über-
täubtes und trunkenes Gefühl von verwirrend-ruhlos gärendem Chaos und scheuem
Zweifel. Doch Zweifel ist Anfang des Wissens, und im Chaos kreisst künftiger Kos-
mos. In solchem Sinne hoffen wir auf den (im Vorwort und auf S. 247/48) ver-
heißenen zweiten Band von der „Sprache der gegenwärtigen Musik".
Berlin. Rudolf Schäfke.
Rud. Unger: Gesammelte Studien. Bd. 1: Aufsätze zur Prinzipienlehre
der Literaturgeschichte. Bd. 2: Aufsätze zur Literatur- und Geistesgeschichte.
Berlin, Junker & Dünnhaupt 1929, 231 S. u. VIII 237 S.
Wenn eine wissenschaftliche Führerpersönlichkeit wie R. Unger sich ver-
anlaßt fühlt, durch eine Sammlung seiner kleineren Schriften zur literarhistorischen
Prinzipienlehre wie zur Literatur- und Geistesgeschichte Rechenschaft von der
geleisteten Arbeit abzulegen, so bedeutet das zweifellos einen Markstein in der Ent-
wicklung der von Unger geführten Richtung: die Festung ist genommen, es gilt
jetzt, die gewonnene Stellung auszubauen. Es ist ja kein Zweifel, daß die in erster
291
Werke heutiger Komponisten nötig, gestatten sie es, mit irgendeinem Kulturpro-
gramm, sei es völkisch oder sozialistisch gefärbt, in Beziehung gesetzt zu werden?
Wie dem auch sei, ein vorsichtigeres Handhaben der Komplexe Philosophie,
Kultur, Politik, ein stärkeres Herausarbeiten künstlerisch-musikalischer Erscheinun-
gen wäre dem Buche und der wirklichen Klärung seines hochbedeutsamen Themas
zuträglich gewesen. Die ganze Fülle des Begriffs „Moderne Musik" wird nicht aus-
gebreitet. Die Darstellung umkreist in der Hauptsache den Bezirk Schönberg. An-
dere hervorragende Musiker, Strawinsky, Bela Bartök von den Älteren, Hindemith,
Krenek von den Jüngeren, werden nur kurz gestreift oder kaum genannt. Gerade
Schönberg aber nimmt eine Sonderstellung im Schaffen der Lebenden ein. Seine
Musik steht als letzte Krisenerscheinung romantischer Strebungen an der Wende
zweier Epochen der Tonkunst. Das Zwölftonsystem seines Kreises vermag die
Werke der anderen selbständig Schaffenden theoretisch nicht entscheidend zu be-
gründen. Einige wesentliche geistige Merkmale der neuen Musik, das naive Musi-
kantenideal etwa, lassen sich an Schönbergs stark reflektierender und kombinieren-
der Art nicht nachweisen. So ist es kein Wunder, daß eine Schrift, die ihn in das
Zentrum rückt, die gesamte musikalische Moderne erst als ein Suchen, Tasten nach
kommendem Anderssein, als zersetzenden, irrenden, eklektisch mischenden, experi-
mentierenden, vorbereitenden Übergang sieht (S. 104). Eine breit gewählte Basis
hätte manches Fertige aufzeigen können. Aber selbst die isolierte Behandlung Schön-
bergs würde, wenn L. K. nur von analytischer Untersuchung konkreter Komposi-
tionen ausgegangen wäre, zu weiteren Ergebnissen von symptomatischer Bedeutung
geführt haben. So jedoch bleibt im Ganzen der Eindruck schwankender Problematik.
Dieses Gefühl wird in nicht geringem Maße durch die Darstellungsweise, den
Stil des Buches verstärkt. Es entspricht dem von der Verf. befolgten wissenschaft-
lichen Prinzip der Anarchie, wenn der rhetorische Ablauf in nervösen Zickzack-
kurven, mitunter von Satz zu Satz, zwischen speziellen akustischen, musiktheoreti-
schen, metaphysischen, politischen Ideen hin und her springt. Dabei liegt es wieder
im Sinne der Anarchie, wenn fortgesetzt abschweifende Fragen aufgeworfen werden,
ohne eine lösende Klärung zu geben, lediglich um des Fragens, um des Infrage-
stellens halber. Der Leser fühlt sich am Schlüsse der Schrift von der regsamen,
geistvollen und vielseitig interessierten Verf. aufgestachelt, durchgepeitscht, gelockert,
„gelöst", „bewegt". Aber dieser Bewegung an sich mangelt es, wie der Philosophie
L. K.s, an der bewegten Substanz, an klar umrissenen Zielen und Zwecken, Ergeb-
nissen und Erkenntnissen. Man spürt ein mystisches, dunkles und dumpfes, über-
täubtes und trunkenes Gefühl von verwirrend-ruhlos gärendem Chaos und scheuem
Zweifel. Doch Zweifel ist Anfang des Wissens, und im Chaos kreisst künftiger Kos-
mos. In solchem Sinne hoffen wir auf den (im Vorwort und auf S. 247/48) ver-
heißenen zweiten Band von der „Sprache der gegenwärtigen Musik".
Berlin. Rudolf Schäfke.
Rud. Unger: Gesammelte Studien. Bd. 1: Aufsätze zur Prinzipienlehre
der Literaturgeschichte. Bd. 2: Aufsätze zur Literatur- und Geistesgeschichte.
Berlin, Junker & Dünnhaupt 1929, 231 S. u. VIII 237 S.
Wenn eine wissenschaftliche Führerpersönlichkeit wie R. Unger sich ver-
anlaßt fühlt, durch eine Sammlung seiner kleineren Schriften zur literarhistorischen
Prinzipienlehre wie zur Literatur- und Geistesgeschichte Rechenschaft von der
geleisteten Arbeit abzulegen, so bedeutet das zweifellos einen Markstein in der Ent-
wicklung der von Unger geführten Richtung: die Festung ist genommen, es gilt
jetzt, die gewonnene Stellung auszubauen. Es ist ja kein Zweifel, daß die in erster