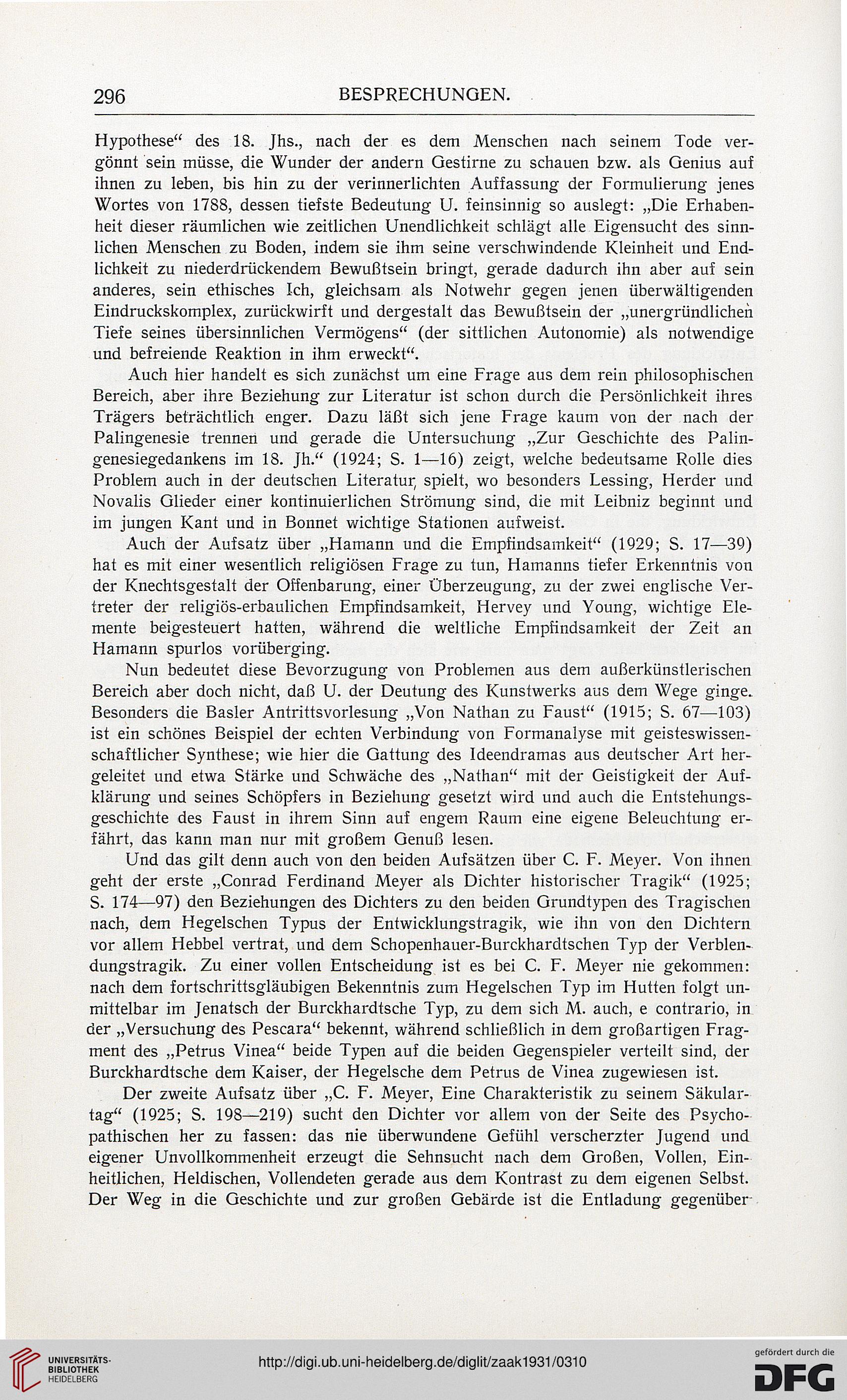296
BESPRECHUNGEN.
Hypothese" des 18. Jhs., nach der es dem Menschen nach seinem Tode ver-
gönnt sein müsse, die Wunder der andern Gestirne zu schauen bzw. als Genius auf
ihnen zu leben, bis hin zu der verinnerlichten Auffassung der Formulierung jenes
Wortes von 1788, dessen tiefste Bedeutung U. feinsinnig so auslegt: „Die Erhaben-
heit dieser räumlichen wie zeitlichen Unendlichkeit schlägt alle Eigensucht des sinn-
lichen Menschen zu Boden, indem sie ihm seine verschwindende Kleinheit und End-
lichkeit zu niederdrückendem Bewußtsein bringt, gerade dadurch ihn aber auf sein
anderes, sein ethisches Ich, gleichsam als Notwehr gegen jenen überwältigenden
Eindruckskomplex, zurückwirft und dergestalt das Bewußtsein der „unergründlichen
Tiefe seines übersinnlichen Vermögens" (der sittlichen Autonomie) als notwendige
und befreiende Reaktion in ihm erweckt".
Auch hier handelt es sich zunächst um eine Frage aus dem rein philosophischen
Bereich, aber ihre Beziehung zur Literatur ist schon durch die Persönlichkeit ihres
Trägers beträchtlich enger. Dazu läßt sich jene Frage kaum von der nach der
Palingenesie trennen und gerade die Untersuchung „Zur Geschichte des Palin-
genesiegedankens im 18. Jh." (1924; S. 1—16) zeigt, welche bedeutsame Rolle dies
Problem auch in der deutschen Literatur, spielt, wo besonders Lessing, Herder und
Novalis Glieder einer kontinuierlichen Strömung sind, die mit Leibniz beginnt und
im jungen Kant und in Bonnet wichtige Stationen aufweist.
Auch der Aufsatz über „Hamann und die Empfindsamkeit" (1929; S. 17—39)
hat es mit einer wesentlich religiösen Frage zu tun, Hamanns tiefer Erkenntnis von
der Knechtsgestalt der Offenbarung, einer Oberzeugung, zu der zwei englische Ver-
treter der religiös-erbaulichen Empfindsamkeit, Hervey und Young, wichtige Ele-
mente beigesteuert hatten, während die weltliche Empfindsamkeit der Zeit an
Hamann spurlos vorüberging.
Nun bedeutet diese Bevorzugung von Problemen aus dem außerkünstlerischen
Bereich aber doch nicht, daß U. der Deutung des Kunstwerks aus dem Wege ginge.
Besonders die Basler Antrittsvorlesung „Von Nathan zu Faust" (1915; S. 67—103)
ist ein schönes Beispiel der echten Verbindung von Formanalyse mit geisteswissen-
schaftlicher Synthese; wie hier die Gattung des Ideendramas aus deutscher Art her-
geleitet und etwa Stärke und Schwäche des „Nathan" mit der Geistigkeit der Auf-
klärung und seines Schöpfers in Beziehung gesetzt wird und auch die Entstehungs-
geschichte des Faust in ihrem Sinn auf engem Raum eine eigene Beleuchtung er-
fährt, das kann man nur mit großem Genuß lesen.
Und das gilt denn auch von den beiden Aufsätzen über C. F. Meyer. Von ihnen
geht der erste „Conrad Ferdinand Meyer als Dichter historischer Tragik" (1925;
S. 174—97) den Beziehungen des Dichters zu den beiden Grundtypen des Tragischen
nach, dem Hegeischen Typus der Entwicklungstragik, wie ihn von den Dichtern
vor allem Hebbel vertrat, und dem Schopenhauer-Burckhardtschen Typ der Verblen-
dungstragik. Zu einer vollen Entscheidung ist es bei C. F. Meyer nie gekommen:
nach dem fortschrittsgläubigen Bekenntnis zum Hegeischen Typ im Hutten folgt un-
mittelbar im Jenatsch der Burckhardtsche Typ, zu dem sich M. auch, e contrario, in
der „Versuchung des Pescara" bekennt, während schließlich in dem großartigen Frag-
ment des „Petrus Vinea" beide Typen auf die beiden Gegenspieler verteilt sind, der
Burckhardtsche dem Kaiser, der Hegeische dem Petrus de Vinea zugewiesen ist.
Der zweite Aufsatz über ,,C. F. Meyer, Eine Charakteristik zu seinem Säkular-
tag" (1925; S. 198—219) sucht den Dichter vor allem von der Seite des Psycho-
pathischen her zu fassen: das nie überwundene Gefühl verscherzter Jugend und
eigener Unvollkommenheit erzeugt die Sehnsucht nach dem Großen, Vollen, Ein-
heitlichen, Heldischen, Vollendeten gerade aus dem Kontrast zu dem eigenen Selbst.
Der Weg in die Geschichte und zur großen Gebärde ist die Entladung gegenüber
BESPRECHUNGEN.
Hypothese" des 18. Jhs., nach der es dem Menschen nach seinem Tode ver-
gönnt sein müsse, die Wunder der andern Gestirne zu schauen bzw. als Genius auf
ihnen zu leben, bis hin zu der verinnerlichten Auffassung der Formulierung jenes
Wortes von 1788, dessen tiefste Bedeutung U. feinsinnig so auslegt: „Die Erhaben-
heit dieser räumlichen wie zeitlichen Unendlichkeit schlägt alle Eigensucht des sinn-
lichen Menschen zu Boden, indem sie ihm seine verschwindende Kleinheit und End-
lichkeit zu niederdrückendem Bewußtsein bringt, gerade dadurch ihn aber auf sein
anderes, sein ethisches Ich, gleichsam als Notwehr gegen jenen überwältigenden
Eindruckskomplex, zurückwirft und dergestalt das Bewußtsein der „unergründlichen
Tiefe seines übersinnlichen Vermögens" (der sittlichen Autonomie) als notwendige
und befreiende Reaktion in ihm erweckt".
Auch hier handelt es sich zunächst um eine Frage aus dem rein philosophischen
Bereich, aber ihre Beziehung zur Literatur ist schon durch die Persönlichkeit ihres
Trägers beträchtlich enger. Dazu läßt sich jene Frage kaum von der nach der
Palingenesie trennen und gerade die Untersuchung „Zur Geschichte des Palin-
genesiegedankens im 18. Jh." (1924; S. 1—16) zeigt, welche bedeutsame Rolle dies
Problem auch in der deutschen Literatur, spielt, wo besonders Lessing, Herder und
Novalis Glieder einer kontinuierlichen Strömung sind, die mit Leibniz beginnt und
im jungen Kant und in Bonnet wichtige Stationen aufweist.
Auch der Aufsatz über „Hamann und die Empfindsamkeit" (1929; S. 17—39)
hat es mit einer wesentlich religiösen Frage zu tun, Hamanns tiefer Erkenntnis von
der Knechtsgestalt der Offenbarung, einer Oberzeugung, zu der zwei englische Ver-
treter der religiös-erbaulichen Empfindsamkeit, Hervey und Young, wichtige Ele-
mente beigesteuert hatten, während die weltliche Empfindsamkeit der Zeit an
Hamann spurlos vorüberging.
Nun bedeutet diese Bevorzugung von Problemen aus dem außerkünstlerischen
Bereich aber doch nicht, daß U. der Deutung des Kunstwerks aus dem Wege ginge.
Besonders die Basler Antrittsvorlesung „Von Nathan zu Faust" (1915; S. 67—103)
ist ein schönes Beispiel der echten Verbindung von Formanalyse mit geisteswissen-
schaftlicher Synthese; wie hier die Gattung des Ideendramas aus deutscher Art her-
geleitet und etwa Stärke und Schwäche des „Nathan" mit der Geistigkeit der Auf-
klärung und seines Schöpfers in Beziehung gesetzt wird und auch die Entstehungs-
geschichte des Faust in ihrem Sinn auf engem Raum eine eigene Beleuchtung er-
fährt, das kann man nur mit großem Genuß lesen.
Und das gilt denn auch von den beiden Aufsätzen über C. F. Meyer. Von ihnen
geht der erste „Conrad Ferdinand Meyer als Dichter historischer Tragik" (1925;
S. 174—97) den Beziehungen des Dichters zu den beiden Grundtypen des Tragischen
nach, dem Hegeischen Typus der Entwicklungstragik, wie ihn von den Dichtern
vor allem Hebbel vertrat, und dem Schopenhauer-Burckhardtschen Typ der Verblen-
dungstragik. Zu einer vollen Entscheidung ist es bei C. F. Meyer nie gekommen:
nach dem fortschrittsgläubigen Bekenntnis zum Hegeischen Typ im Hutten folgt un-
mittelbar im Jenatsch der Burckhardtsche Typ, zu dem sich M. auch, e contrario, in
der „Versuchung des Pescara" bekennt, während schließlich in dem großartigen Frag-
ment des „Petrus Vinea" beide Typen auf die beiden Gegenspieler verteilt sind, der
Burckhardtsche dem Kaiser, der Hegeische dem Petrus de Vinea zugewiesen ist.
Der zweite Aufsatz über ,,C. F. Meyer, Eine Charakteristik zu seinem Säkular-
tag" (1925; S. 198—219) sucht den Dichter vor allem von der Seite des Psycho-
pathischen her zu fassen: das nie überwundene Gefühl verscherzter Jugend und
eigener Unvollkommenheit erzeugt die Sehnsucht nach dem Großen, Vollen, Ein-
heitlichen, Heldischen, Vollendeten gerade aus dem Kontrast zu dem eigenen Selbst.
Der Weg in die Geschichte und zur großen Gebärde ist die Entladung gegenüber