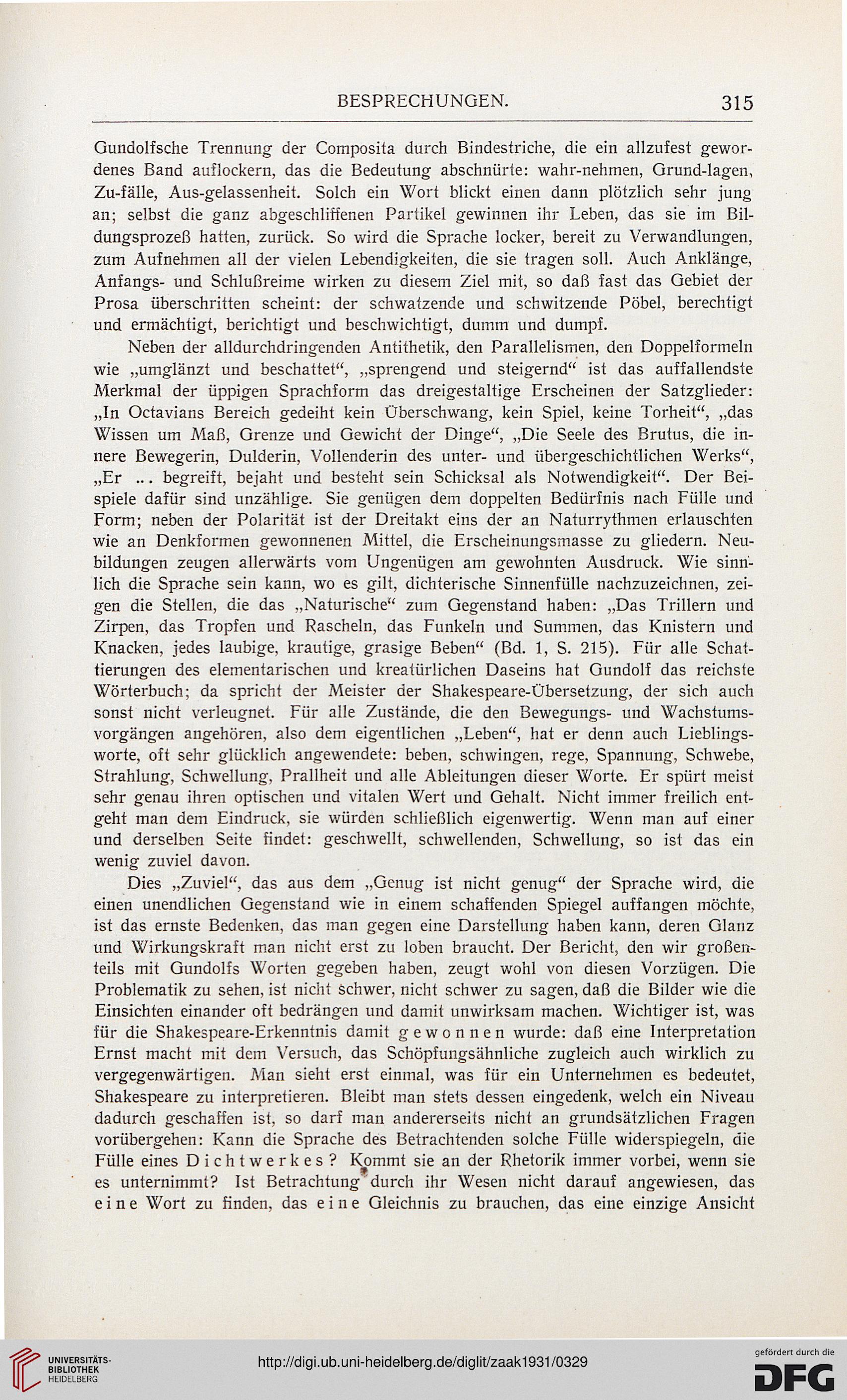BESPRECHUNGEN.
315
Gundolfsche Trennung der Composita durch Bindestriche, die ein allzufest gewor-
denes Band auflockern, das die Bedeutung abschnürte: wahr-nehmen, Grund-lagen,
Zu-fälle, Aus-gelassenheit. Solch ein Wort blickt einen dann plötzlich sehr jung
an; selbst die ganz abgeschliffenen Partikel gewinnen ihr Leben, das sie im Bil-
dungsprozeß hatten, zurück. So wird die Sprache locker, bereit zu Verwandlungen,
zum Aufnehmen all der vielen Lebendigkeiten, die sie tragen soll. Auch Anklänge,
Anfangs- und Schlußreime wirken zu diesem Ziel mit, so daß fast das Gebiet der
Prosa überschritten scheint: der schwatzende und schwitzende Pöbel, berechtigt
und ermächtigt, berichtigt und beschwichtigt, dumm und dumpf.
Neben der alldurchdringenden Antithetik, den Parallelismen, den Doppelformeln
wie „umglänzt und beschattet", „sprengend und steigernd" ist das auffallendste
Merkmal der üppigen Sprachform das dreigestaltige Erscheinen der Satzglieder:
„In Octavians Bereich gedeiht kein Überschwang, kein Spiel, keine Torheit", „das
Wissen um Maß, Grenze und Gewicht der Dinge", „Die Seele des Brutus, die in-
nere Bewegerin, Dulderin, Vollenderin des unter- und übergeschichtlichen Werks",
„Er ... begreift, bejaht und besteht sein Schicksal als Notwendigkeit". Der Bei-
spiele dafür sind unzählige. Sie genügen dem doppelten Bedürfnis nach Fülle und
Form; neben der Polarität ist der Dreitakt eins der an Naturrythmen erlauschten
wie an Denkformen gewonnenen Mittel, die Erscheinungsmasse zu gliedern. Neu-
bildungen zeugen allerwärts vom Ungenügen am gewohnten Ausdruck. Wie sinn-
lich die Sprache sein kann, wo es gilt, dichterische Sinnenfülle nachzuzeichnen, zei-
gen die Stellen, die das „Naturische" zum Gegenstand haben: „Das Trillern und
Zirpen, das Tropfen und Rascheln, das Funkeln und Summen, das Knistern und
Knacken, jedes laubige, krautige, grasige Beben" (Bd. 1, S. 215). Für alle Schat-
tierungen des elementarischen und kreatürlichen Daseins hat Gundolf das reichste
Wörterbuch; da spricht der Meister der Shakespeare-Übersetzung, der sich auch
sonst nicht verleugnet. Für alle Zustände, die den Bewegungs- und Wachstums-
vorgängen angehören, also dem eigentlichen „Leben", hat er denn auch Lieblings-
worte, oft sehr glücklich angewendete: beben, schwingen, rege, Spannung, Schwebe,
Strahlung, Schwellung, Prallheit und alle Ableitungen dieser Worte. Er spürt meist
sehr genau ihren optischen und vitalen Wert und Gehalt. Nicht immer freilich ent-
geht man dem Eindruck, sie würden schließlich eigenwertig. Wenn man auf einer
und derselben Seite findet: geschwellt, schwellenden, Schwellung, so ist das ein
wenig zuviel davon.
Dies „Zuviel", das aus dem „Genug ist nicht genug" der Sprache wird, die
einen unendlichen Gegenstand wie in einem schaffenden Spiegel auffangen möchte,
ist das ernste Bedenken, das man gegen eine Darstellung haben kann, deren Glanz
und Wirkungskraft man nicht erst zu loben braucht. Der Bericht, den wir großen-
teils mit Gundolfs Worten gegeben haben, zeugt wohl von diesen Vorzügen. Die
Problematik zu sehen, ist nicht Schwer, nicht schwer zu sagen, daß die Bilder wie die
Einsichten einander oft bedrängen und damit unwirksam machen. Wichtiger ist, was
für die Shakespeare-Erkenntnis damit gewonnen wurde: daß eine Interpretation
Ernst macht mit dem Versuch, das Schöpfungsähnliche zugleich auch wirklich zu
vergegenwärtigen. Man sieht erst einmal, was für ein Unternehmen es bedeutet,
Shakespeare zu interpretieren. Bleibt man stets dessen eingedenk, welch ein Niveau
dadurch geschaffen ist, so darf man andererseits nicht an grundsätzlichen Fragen
vorübergehen: Kann die Sprache des Betrachtenden solche Fülle widerspiegeln, die
Fülle eines Dichtwerkes ? Kommt sie an der Rhetorik immer vorbei, wenn sie
es unternimmt? Ist Betrachtung' durch ihr Wesen nicht darauf angewiesen, das
eine Wort zu finden, das eine Gleichnis zu brauchen, das eine einzige Ansicht
315
Gundolfsche Trennung der Composita durch Bindestriche, die ein allzufest gewor-
denes Band auflockern, das die Bedeutung abschnürte: wahr-nehmen, Grund-lagen,
Zu-fälle, Aus-gelassenheit. Solch ein Wort blickt einen dann plötzlich sehr jung
an; selbst die ganz abgeschliffenen Partikel gewinnen ihr Leben, das sie im Bil-
dungsprozeß hatten, zurück. So wird die Sprache locker, bereit zu Verwandlungen,
zum Aufnehmen all der vielen Lebendigkeiten, die sie tragen soll. Auch Anklänge,
Anfangs- und Schlußreime wirken zu diesem Ziel mit, so daß fast das Gebiet der
Prosa überschritten scheint: der schwatzende und schwitzende Pöbel, berechtigt
und ermächtigt, berichtigt und beschwichtigt, dumm und dumpf.
Neben der alldurchdringenden Antithetik, den Parallelismen, den Doppelformeln
wie „umglänzt und beschattet", „sprengend und steigernd" ist das auffallendste
Merkmal der üppigen Sprachform das dreigestaltige Erscheinen der Satzglieder:
„In Octavians Bereich gedeiht kein Überschwang, kein Spiel, keine Torheit", „das
Wissen um Maß, Grenze und Gewicht der Dinge", „Die Seele des Brutus, die in-
nere Bewegerin, Dulderin, Vollenderin des unter- und übergeschichtlichen Werks",
„Er ... begreift, bejaht und besteht sein Schicksal als Notwendigkeit". Der Bei-
spiele dafür sind unzählige. Sie genügen dem doppelten Bedürfnis nach Fülle und
Form; neben der Polarität ist der Dreitakt eins der an Naturrythmen erlauschten
wie an Denkformen gewonnenen Mittel, die Erscheinungsmasse zu gliedern. Neu-
bildungen zeugen allerwärts vom Ungenügen am gewohnten Ausdruck. Wie sinn-
lich die Sprache sein kann, wo es gilt, dichterische Sinnenfülle nachzuzeichnen, zei-
gen die Stellen, die das „Naturische" zum Gegenstand haben: „Das Trillern und
Zirpen, das Tropfen und Rascheln, das Funkeln und Summen, das Knistern und
Knacken, jedes laubige, krautige, grasige Beben" (Bd. 1, S. 215). Für alle Schat-
tierungen des elementarischen und kreatürlichen Daseins hat Gundolf das reichste
Wörterbuch; da spricht der Meister der Shakespeare-Übersetzung, der sich auch
sonst nicht verleugnet. Für alle Zustände, die den Bewegungs- und Wachstums-
vorgängen angehören, also dem eigentlichen „Leben", hat er denn auch Lieblings-
worte, oft sehr glücklich angewendete: beben, schwingen, rege, Spannung, Schwebe,
Strahlung, Schwellung, Prallheit und alle Ableitungen dieser Worte. Er spürt meist
sehr genau ihren optischen und vitalen Wert und Gehalt. Nicht immer freilich ent-
geht man dem Eindruck, sie würden schließlich eigenwertig. Wenn man auf einer
und derselben Seite findet: geschwellt, schwellenden, Schwellung, so ist das ein
wenig zuviel davon.
Dies „Zuviel", das aus dem „Genug ist nicht genug" der Sprache wird, die
einen unendlichen Gegenstand wie in einem schaffenden Spiegel auffangen möchte,
ist das ernste Bedenken, das man gegen eine Darstellung haben kann, deren Glanz
und Wirkungskraft man nicht erst zu loben braucht. Der Bericht, den wir großen-
teils mit Gundolfs Worten gegeben haben, zeugt wohl von diesen Vorzügen. Die
Problematik zu sehen, ist nicht Schwer, nicht schwer zu sagen, daß die Bilder wie die
Einsichten einander oft bedrängen und damit unwirksam machen. Wichtiger ist, was
für die Shakespeare-Erkenntnis damit gewonnen wurde: daß eine Interpretation
Ernst macht mit dem Versuch, das Schöpfungsähnliche zugleich auch wirklich zu
vergegenwärtigen. Man sieht erst einmal, was für ein Unternehmen es bedeutet,
Shakespeare zu interpretieren. Bleibt man stets dessen eingedenk, welch ein Niveau
dadurch geschaffen ist, so darf man andererseits nicht an grundsätzlichen Fragen
vorübergehen: Kann die Sprache des Betrachtenden solche Fülle widerspiegeln, die
Fülle eines Dichtwerkes ? Kommt sie an der Rhetorik immer vorbei, wenn sie
es unternimmt? Ist Betrachtung' durch ihr Wesen nicht darauf angewiesen, das
eine Wort zu finden, das eine Gleichnis zu brauchen, das eine einzige Ansicht