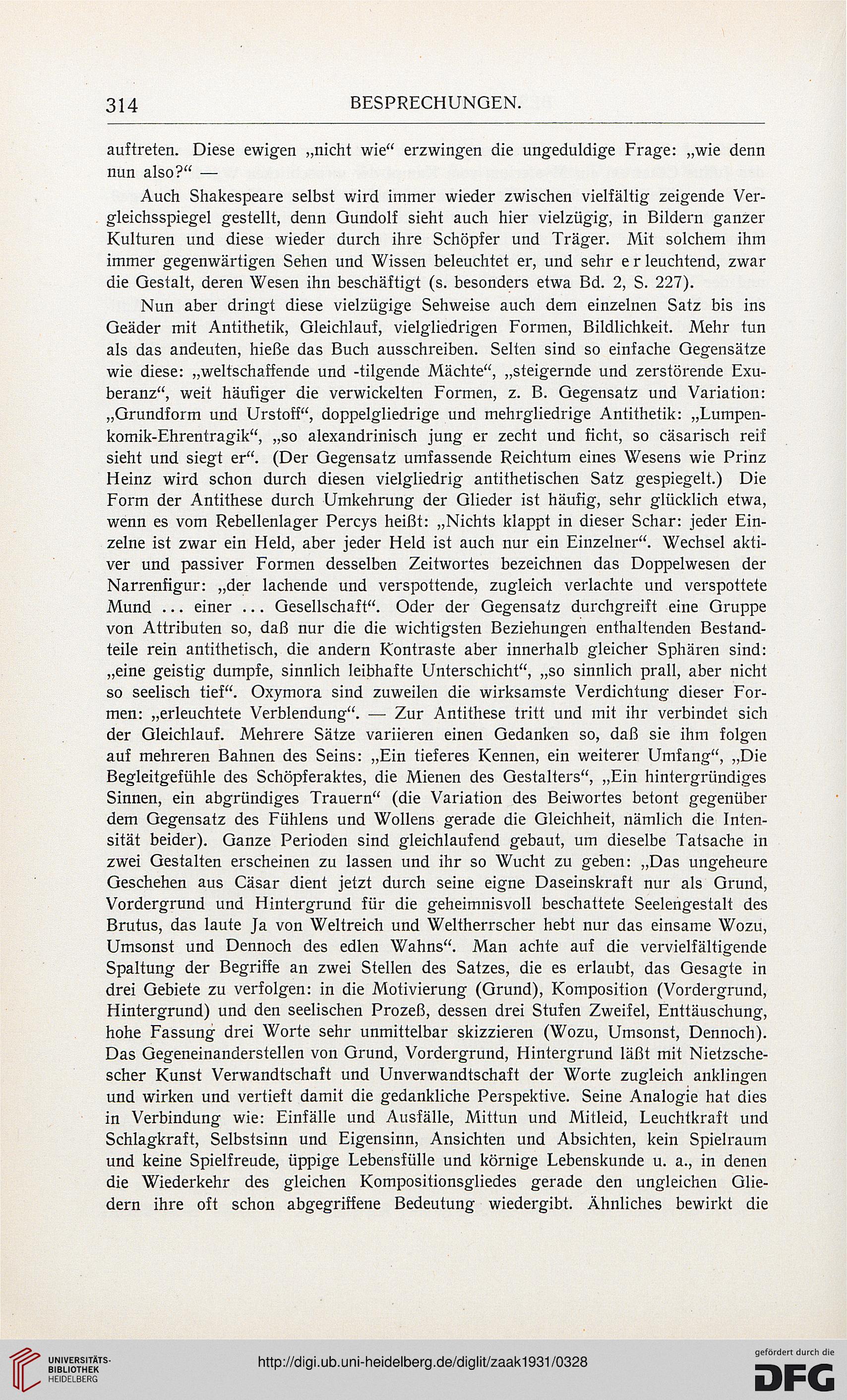314
BESPRECHUNGEN.
auftreten. Diese ewigen „nicht wie" erzwingen die ungeduldige Frage: „wie denn
nun also?" —
Auch Shakespeare selbst wird immer wieder zwischen vielfältig zeigende Ver-
gleichsspiegel gestellt, denn Gundolf sieht auch hier vielzügig, in Bildern ganzer
Kulturen und diese wieder durch ihre Schöpfer und Träger. Mit solchem ihm
immer gegenwärtigen Sehen und Wissen beleuchtet er, und sehr erleuchtend, zwar
die Gestalt, deren Wesen ihn beschäftigt (s. besonders etwa Bd. 2, S. 227).
Nun aber dringt diese vielzügige Sehweise auch dem einzelnen Satz bis ins
Geäder mit Antithetik, Gleichlauf, vielgliedrigen Formen, Bildlichkeit. Mehr tun
als das andeuten, hieße das Buch ausschreiben. Selten sind so einfache Gegensätze
wie diese: „weltscharfende und -tilgende Mächte", „steigernde und zerstörende Exu-
beranz", weit häufiger die verwickelten Formen, z. B. Gegensatz und Variation:
„Grundform und Urstoff", doppelgliedrige und mehrgliedrige Antithetik: „Lumpen-
komik-Ehrentragik", „so alexandrinisch jung er zecht und ficht, so cäsarisch reif
sieht und siegt er". (Der Gegensatz umfassende Reichtum eines Wesens wie Prinz
Heinz wird schon durch diesen vielgliedrig antithetischen Satz gespiegelt.) Die
Form der Antithese durch Umkehrung der Glieder ist häufig, sehr glücklich etwa,
wenn es vom Rebellenlager Percys heißt: „Nichts klappt in dieser Schar: jeder Ein-
zelne ist zwar ein Held, aber jeder Held ist auch nur ein Einzelner". Wechsel akti-
ver und passiver Formen desselben Zeitwortes bezeichnen das Doppelwesen der
Narrenfigur: „der lachende und verspottende, zugleich verlachte und verspottete
Mund ... einer ... Gesellschaft". Oder der Gegensatz durchgreift eine Gruppe
von Attributen so, daß nur die die wichtigsten Beziehungen enthaltenden Bestand-
teile rein antithetisch, die andern Kontraste aber innerhalb gleicher Sphären sind:
„eine geistig dumpfe, sinnlich leibhafte Unterschicht", „so sinnlich prall, aber nicht
so seelisch tief". Oxymora sind zuweilen die wirksamste Verdichtung dieser For-
men: „erleuchtete Verblendung". — Zur Antithese tritt und mit ihr verbindet sich
der Gleichlauf. Mehrere Sätze variieren einen Gedanken so, daß sie ihm folgen
auf mehreren Bahnen des Seins: „Ein tieferes Kennen, ein weiterer Umfang", „Die
Begleitgefühle des Schöpferaktes, die Mienen des Gestalters", „Ein hintergründiges
Sinnen, ein abgründiges Trauern" (die Variation des Beiwortes betont gegenüber
dem Gegensatz des Fühlens und Wollens gerade die Gleichheit, nämlich die Inten-
sität beider). Ganze Perioden sind gleichlaufend gebaut, um dieselbe Tatsache in
zwei Gestalten erscheinen zu lassen und ihr so Wucht zu geben: „Das ungeheure
Geschehen aus Cäsar dient jetzt durch seine eigne Daseinskraft nur als Grund,
Vordergrund und Hintergrund für die geheimnisvoll beschattete Seelengestalt des
Brutus, das laute Ja von Weltreich und Weltherrscher hebt nur das einsame Wozu,
Umsonst und Dennoch des edlen Wahns". Man achte auf die vervielfältigende
Spaltung der Begriffe an zwei Stellen des Satzes, die es erlaubt, das Gesagte in
drei Gebiete zu verfolgen: in die Motivierung (Grund), Komposition (Vordergrund,
Hintergrund) und den seelischen Prozeß, dessen drei Stufen Zweifel, Enttäuschung,
hohe Fassung drei Worte sehr unmittelbar skizzieren (Wozu, Umsonst, Dennoch).
Das Gegeneinanderstellen von Grund, Vordergrund, Hintergrund läßt mit Nietzsche-
scher Kunst Verwandtschaft und Unverwandtschaft der Worte zugleich anklingen
und wirken und vertieft damit die gedankliche Perspektive. Seine Analogie hat dies
in Verbindung wie: Einfälle und Ausfälle, Mittun und Mitleid, Leuchtkraft und
Schlagkraft, Selbstsinn und Eigensinn, Ansichten und Absichten, kein Spielraum
und keine Spielfreude, üppige Lebensfülle und körnige Lebenskunde u. a., in denen
die Wiederkehr des gleichen Kompositionsgliedes gerade den ungleichen Glie-
dern ihre oft schon abgegriffene Bedeutung wiedergibt. Ähnliches bewirkt die
BESPRECHUNGEN.
auftreten. Diese ewigen „nicht wie" erzwingen die ungeduldige Frage: „wie denn
nun also?" —
Auch Shakespeare selbst wird immer wieder zwischen vielfältig zeigende Ver-
gleichsspiegel gestellt, denn Gundolf sieht auch hier vielzügig, in Bildern ganzer
Kulturen und diese wieder durch ihre Schöpfer und Träger. Mit solchem ihm
immer gegenwärtigen Sehen und Wissen beleuchtet er, und sehr erleuchtend, zwar
die Gestalt, deren Wesen ihn beschäftigt (s. besonders etwa Bd. 2, S. 227).
Nun aber dringt diese vielzügige Sehweise auch dem einzelnen Satz bis ins
Geäder mit Antithetik, Gleichlauf, vielgliedrigen Formen, Bildlichkeit. Mehr tun
als das andeuten, hieße das Buch ausschreiben. Selten sind so einfache Gegensätze
wie diese: „weltscharfende und -tilgende Mächte", „steigernde und zerstörende Exu-
beranz", weit häufiger die verwickelten Formen, z. B. Gegensatz und Variation:
„Grundform und Urstoff", doppelgliedrige und mehrgliedrige Antithetik: „Lumpen-
komik-Ehrentragik", „so alexandrinisch jung er zecht und ficht, so cäsarisch reif
sieht und siegt er". (Der Gegensatz umfassende Reichtum eines Wesens wie Prinz
Heinz wird schon durch diesen vielgliedrig antithetischen Satz gespiegelt.) Die
Form der Antithese durch Umkehrung der Glieder ist häufig, sehr glücklich etwa,
wenn es vom Rebellenlager Percys heißt: „Nichts klappt in dieser Schar: jeder Ein-
zelne ist zwar ein Held, aber jeder Held ist auch nur ein Einzelner". Wechsel akti-
ver und passiver Formen desselben Zeitwortes bezeichnen das Doppelwesen der
Narrenfigur: „der lachende und verspottende, zugleich verlachte und verspottete
Mund ... einer ... Gesellschaft". Oder der Gegensatz durchgreift eine Gruppe
von Attributen so, daß nur die die wichtigsten Beziehungen enthaltenden Bestand-
teile rein antithetisch, die andern Kontraste aber innerhalb gleicher Sphären sind:
„eine geistig dumpfe, sinnlich leibhafte Unterschicht", „so sinnlich prall, aber nicht
so seelisch tief". Oxymora sind zuweilen die wirksamste Verdichtung dieser For-
men: „erleuchtete Verblendung". — Zur Antithese tritt und mit ihr verbindet sich
der Gleichlauf. Mehrere Sätze variieren einen Gedanken so, daß sie ihm folgen
auf mehreren Bahnen des Seins: „Ein tieferes Kennen, ein weiterer Umfang", „Die
Begleitgefühle des Schöpferaktes, die Mienen des Gestalters", „Ein hintergründiges
Sinnen, ein abgründiges Trauern" (die Variation des Beiwortes betont gegenüber
dem Gegensatz des Fühlens und Wollens gerade die Gleichheit, nämlich die Inten-
sität beider). Ganze Perioden sind gleichlaufend gebaut, um dieselbe Tatsache in
zwei Gestalten erscheinen zu lassen und ihr so Wucht zu geben: „Das ungeheure
Geschehen aus Cäsar dient jetzt durch seine eigne Daseinskraft nur als Grund,
Vordergrund und Hintergrund für die geheimnisvoll beschattete Seelengestalt des
Brutus, das laute Ja von Weltreich und Weltherrscher hebt nur das einsame Wozu,
Umsonst und Dennoch des edlen Wahns". Man achte auf die vervielfältigende
Spaltung der Begriffe an zwei Stellen des Satzes, die es erlaubt, das Gesagte in
drei Gebiete zu verfolgen: in die Motivierung (Grund), Komposition (Vordergrund,
Hintergrund) und den seelischen Prozeß, dessen drei Stufen Zweifel, Enttäuschung,
hohe Fassung drei Worte sehr unmittelbar skizzieren (Wozu, Umsonst, Dennoch).
Das Gegeneinanderstellen von Grund, Vordergrund, Hintergrund läßt mit Nietzsche-
scher Kunst Verwandtschaft und Unverwandtschaft der Worte zugleich anklingen
und wirken und vertieft damit die gedankliche Perspektive. Seine Analogie hat dies
in Verbindung wie: Einfälle und Ausfälle, Mittun und Mitleid, Leuchtkraft und
Schlagkraft, Selbstsinn und Eigensinn, Ansichten und Absichten, kein Spielraum
und keine Spielfreude, üppige Lebensfülle und körnige Lebenskunde u. a., in denen
die Wiederkehr des gleichen Kompositionsgliedes gerade den ungleichen Glie-
dern ihre oft schon abgegriffene Bedeutung wiedergibt. Ähnliches bewirkt die