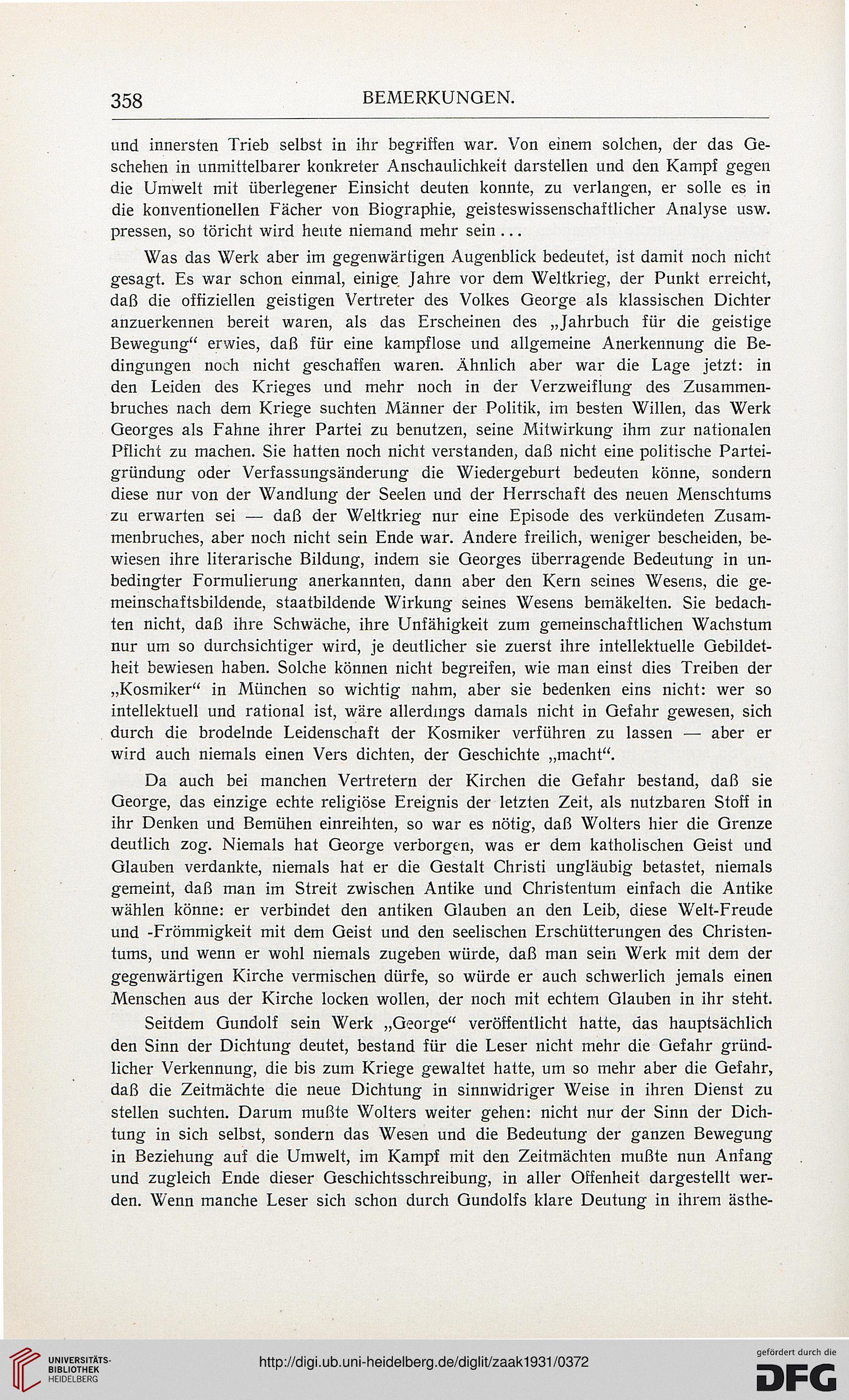358
BEMERKUNGEN.
und innersten Trieb selbst in ihr begriffen war. Von einem solchen, der das Ge-
schehen in unmittelbarer konkreter Anschaulichkeit darstellen und den Kampf gegen
die Umwelt mit überlegener Einsicht deuten konnte, zu verlangen, er solle es in
die konventionellen Fächer von Biographie, geisteswissenschaftlicher Analyse usw.
pressen, so töricht wird heute niemand mehr sein ...
Was das Werk aber im gegenwärtigen Augenblick bedeutet, ist damit noch nicht
gesagt. Es war schon einmal, einige Jahre vor dem Weltkrieg, der Punkt erreicht,
daß die offiziellen geistigen Vertreter des Volkes George als klassischen Dichter
anzuerkennen bereit waren, als das Erscheinen des „Jahrbuch für die geistige
Bewegung" erwies, daß für eine kampflose und allgemeine Anerkennung die Be-
dingungen noch nicht geschaffen waren. Ähnlich aber war die Lage jetzt: in
den Leiden des Krieges und mehr noch in der Verzweiflung des Zusammen-
bruches nach dem Kriege suchten Männer der Politik, im besten Willen, das Werk
Georges als Fahne ihrer Partei zu benutzen, seine Mitwirkung ihm zur nationalen
Pflicht zu machen. Sie hatten noch nicht verstanden, daß nicht eine politische Partei-
gründung oder Verfassungsänderung die Wiedergeburt bedeuten könne, sondern
diese nur von der Wandlung der Seelen und der Herrschaft des neuen Menschtums
zu erwarten sei — daß der Weltkrieg nur eine Episode des verkündeten Zusam-
menbruches, aber noch nicht sein Ende war. Andere freilich, weniger bescheiden, be-
wiesen ihre literarische Bildung, indem sie Georges überragende Bedeutung in un-
bedingter Formulierung anerkannten, dann aber den Kern seines Wesens, die ge-
meinschaftsbildende, staatbildende Wirkung seines Wesens bemäkelten. Sie bedach-
ten nicht, daß ihre Schwäche, ihre Unfähigkeit zum gemeinschaftlichen Wachstum
nur um so durchsichtiger wird, je deutlicher sie zuerst ihre intellektuelle Gebildet-
heit bewiesen haben. Solche können nicht begreifen, wie man einst dies Treiben der
„Kosmiker" in München so wichtig nahm, aber sie bedenken eins nicht: wer so
intellektuell und rational ist, wäre allerdings damals nicht in Gefahr gewesen, sich
durch die brodelnde Leidenschaft der Kosmiker verführen zu lassen — aber er
wird auch niemals einen Vers dichten, der Geschichte „macht".
Da auch bei manchen Vertretern der Kirchen die Gefahr bestand, daß sie
George, das einzige echte religiöse Ereignis der letzten Zeit, als nutzbaren Stoff in
ihr Denken und Bemühen einreihten, so war es nötig, daß Wolters hier die Grenze
deutlich zog. Niemals hat George verborgen, was er dem katholischen Geist und
Glauben verdankte, niemals hat er die Gestalt Christi ungläubig betastet, niemals
gemeint, daß man im Streit zwischen Antike und Christentum einfach die Antike
wählen könne: er verbindet den antiken Glauben an den Leib, diese Welt-Freude
und -Frömmigkeit mit dem Geist und den seelischen Erschütterungen des Christen-
tums, und wenn er wohl niemals zugeben würde, daß man sein Werk mit dem der
gegenwärtigen Kirche vermischen dürfe, so würde er auch schwerlich jemals einen
Menschen aus der Kirche locken wollen, der noch mit echtem Glauben in ihr steht.
Seitdem Gundolf sein Werk „George" veröffentlicht hatte, das hauptsächlich
den Sinn der Dichtung deutet, bestand für die Leser nicht mehr die Gefahr gründ-
licher Verkennung, die bis zum Kriege gewaltet hatte, um so mehr aber die Gefahr,
daß die Zeitmächte die neue Dichtung in sinnwidriger Weise in ihren Dienst zu
stellen suchten. Darum mußte Wolters weiter gehen: nicht nur der Sinn der Dich-
tung in sich selbst, sondern das Wesen und die Bedeutung der ganzen Bewegung
in Beziehung auf die Umwelt, im Kampf mit den Zeitmächten mußte nun Anfang
und zugleich Ende dieser Geschichtsschreibung, in aller Offenheit dargestellt wer-
den. Wenn manche Leser sich schon durch Gundolfs klare Deutung in ihrem ästhe-
BEMERKUNGEN.
und innersten Trieb selbst in ihr begriffen war. Von einem solchen, der das Ge-
schehen in unmittelbarer konkreter Anschaulichkeit darstellen und den Kampf gegen
die Umwelt mit überlegener Einsicht deuten konnte, zu verlangen, er solle es in
die konventionellen Fächer von Biographie, geisteswissenschaftlicher Analyse usw.
pressen, so töricht wird heute niemand mehr sein ...
Was das Werk aber im gegenwärtigen Augenblick bedeutet, ist damit noch nicht
gesagt. Es war schon einmal, einige Jahre vor dem Weltkrieg, der Punkt erreicht,
daß die offiziellen geistigen Vertreter des Volkes George als klassischen Dichter
anzuerkennen bereit waren, als das Erscheinen des „Jahrbuch für die geistige
Bewegung" erwies, daß für eine kampflose und allgemeine Anerkennung die Be-
dingungen noch nicht geschaffen waren. Ähnlich aber war die Lage jetzt: in
den Leiden des Krieges und mehr noch in der Verzweiflung des Zusammen-
bruches nach dem Kriege suchten Männer der Politik, im besten Willen, das Werk
Georges als Fahne ihrer Partei zu benutzen, seine Mitwirkung ihm zur nationalen
Pflicht zu machen. Sie hatten noch nicht verstanden, daß nicht eine politische Partei-
gründung oder Verfassungsänderung die Wiedergeburt bedeuten könne, sondern
diese nur von der Wandlung der Seelen und der Herrschaft des neuen Menschtums
zu erwarten sei — daß der Weltkrieg nur eine Episode des verkündeten Zusam-
menbruches, aber noch nicht sein Ende war. Andere freilich, weniger bescheiden, be-
wiesen ihre literarische Bildung, indem sie Georges überragende Bedeutung in un-
bedingter Formulierung anerkannten, dann aber den Kern seines Wesens, die ge-
meinschaftsbildende, staatbildende Wirkung seines Wesens bemäkelten. Sie bedach-
ten nicht, daß ihre Schwäche, ihre Unfähigkeit zum gemeinschaftlichen Wachstum
nur um so durchsichtiger wird, je deutlicher sie zuerst ihre intellektuelle Gebildet-
heit bewiesen haben. Solche können nicht begreifen, wie man einst dies Treiben der
„Kosmiker" in München so wichtig nahm, aber sie bedenken eins nicht: wer so
intellektuell und rational ist, wäre allerdings damals nicht in Gefahr gewesen, sich
durch die brodelnde Leidenschaft der Kosmiker verführen zu lassen — aber er
wird auch niemals einen Vers dichten, der Geschichte „macht".
Da auch bei manchen Vertretern der Kirchen die Gefahr bestand, daß sie
George, das einzige echte religiöse Ereignis der letzten Zeit, als nutzbaren Stoff in
ihr Denken und Bemühen einreihten, so war es nötig, daß Wolters hier die Grenze
deutlich zog. Niemals hat George verborgen, was er dem katholischen Geist und
Glauben verdankte, niemals hat er die Gestalt Christi ungläubig betastet, niemals
gemeint, daß man im Streit zwischen Antike und Christentum einfach die Antike
wählen könne: er verbindet den antiken Glauben an den Leib, diese Welt-Freude
und -Frömmigkeit mit dem Geist und den seelischen Erschütterungen des Christen-
tums, und wenn er wohl niemals zugeben würde, daß man sein Werk mit dem der
gegenwärtigen Kirche vermischen dürfe, so würde er auch schwerlich jemals einen
Menschen aus der Kirche locken wollen, der noch mit echtem Glauben in ihr steht.
Seitdem Gundolf sein Werk „George" veröffentlicht hatte, das hauptsächlich
den Sinn der Dichtung deutet, bestand für die Leser nicht mehr die Gefahr gründ-
licher Verkennung, die bis zum Kriege gewaltet hatte, um so mehr aber die Gefahr,
daß die Zeitmächte die neue Dichtung in sinnwidriger Weise in ihren Dienst zu
stellen suchten. Darum mußte Wolters weiter gehen: nicht nur der Sinn der Dich-
tung in sich selbst, sondern das Wesen und die Bedeutung der ganzen Bewegung
in Beziehung auf die Umwelt, im Kampf mit den Zeitmächten mußte nun Anfang
und zugleich Ende dieser Geschichtsschreibung, in aller Offenheit dargestellt wer-
den. Wenn manche Leser sich schon durch Gundolfs klare Deutung in ihrem ästhe-