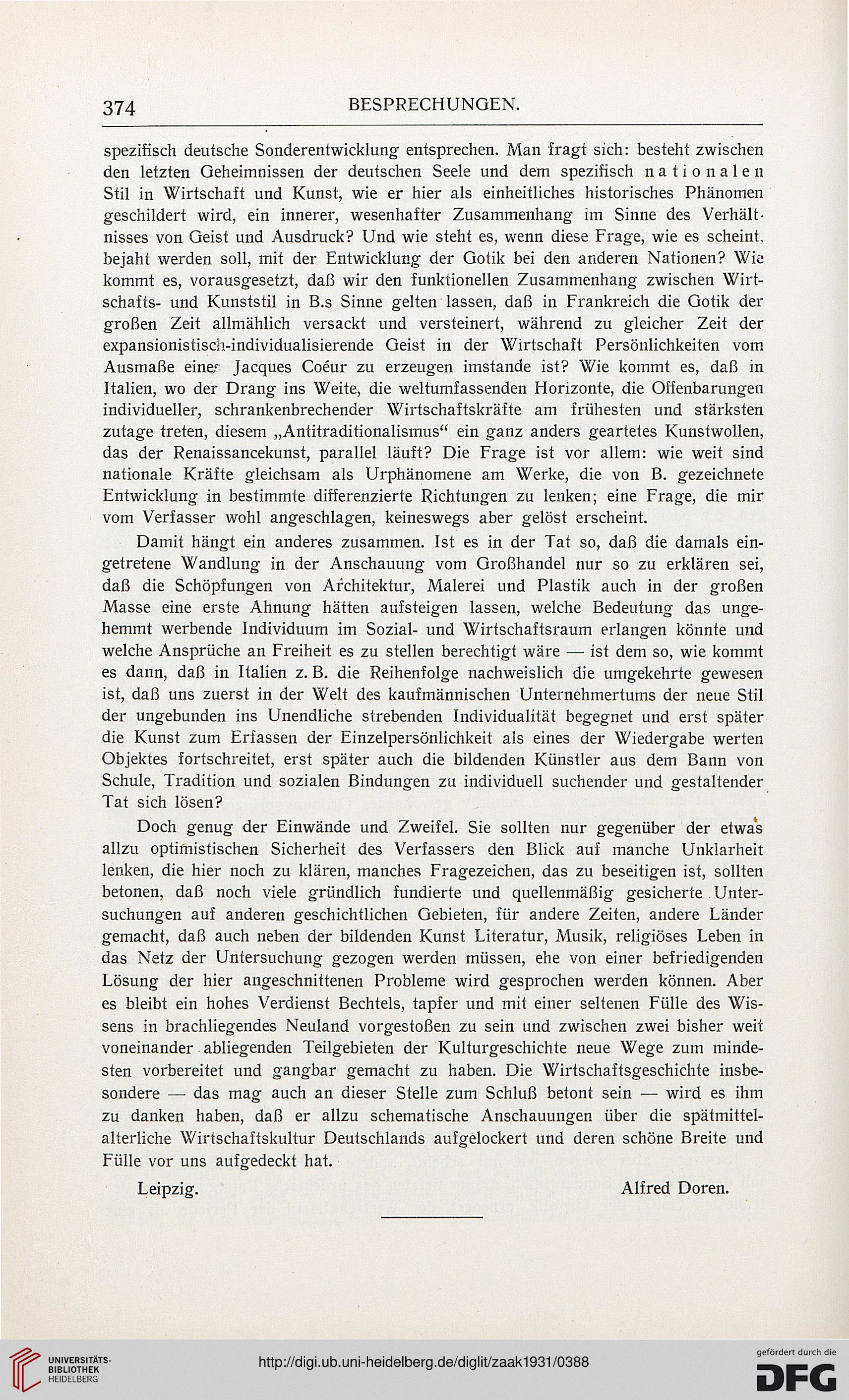374
BESPRECHUNGEN.
spezifisch deutsche Sonderentwicklung entsprechen. Man fragt sich: besteht zwischen
den letzten Geheimnissen der deutschen Seele und dem spezifisch nationalen
Stil in Wirtschaft und Kunst, wie er hier als einheitliches historisches Phänomen
geschildert wird, ein innerer, wesenhafter Zusammenhang im Sinne des Verhält-
nisses von Geist und Ausdruck? Und wie steht es, wenn diese Frage, wie es scheint,
bejaht werden soll, mit der Entwicklung der Gotik bei den anderen Nationen? Wie
kommt es, vorausgesetzt, daß wir den funktionellen Zusammenhang zwischen Wirt-
schafts- und Kunststil in B.s Sinne gelten lassen, daß in Frankreich die Gotik der
großen Zeit allmählich versackt und versteinert, während zu gleicher Zeit der
expansionistisch-individualisierende Geist in der Wirtschaft Persönlichkeiten vom
Ausmaße einer Jacques Coeur zu erzeugen imstande ist? Wie kommt es, daß in
Italien, wo der Drang ins Weite, die weltumfassenden Horizonte, die Offenbarungen
individueller, schrankenbrechender Wirtschaftskräfte am frühesten und stärksten
zutage treten, diesem „Antitraditionalismus" ein ganz anders geartetes Kunstwollen,
das der Renaissancekunst, parallel läuft? Die Frage ist vor allem: wie weit sind
nationale Kräfte gleichsam als Urphänomene am Werke, die von B. gezeichnete
Entwicklung in bestimmte differenzierte Richtungen zu lenken; eine Frage, die mir
vom Verfasser wohl angeschlagen, keineswegs aber gelöst erscheint.
Damit hängt ein anderes zusammen. Ist es in der Tat so, daß die damals ein-
getretene Wandlung in der Anschauung vom Großhandel nur so zu erklären sei,
daß die Schöpfungen von Architektur, Malerei und Plastik auch in der großen
Masse eine erste Ahnung hätten aufsteigen lassen, welche Bedeutung das unge-
hemmt werbende Individuum im Sozial- und Wirtschaftsraum erlangen könnte und
welche Ansprüche an Freiheit es zu stellen berechtigt wäre — ist dem so, wie kommt
es dann, daß in Italien z. B. die Reihenfolge nachweislich die umgekehrte gewesen
ist, daß uns zuerst in der Welt des kaufmännischen Unternehmertums der neue Stil
der ungebunden ins Unendliche strebenden Individualität begegnet und erst später
die Kunst zum Erfasseil der Einzelpersönlichkeit als eines der Wiedergabe werten
Objektes fortschreitet, erst später auch die bildenden Künstler aus dem Bann von
Schule, Tradition und sozialen Bindungen zu individuell suchender und gestaltender
Tat sich lösen?
Doch genug der Einwände und Zweifel. Sie sollten nur gegenüber der etwas
allzu optimistischen Sicherheit des Verfassers den Blick auf manche Unklarheit
lenken, die hier noch zu klären, manches Fragezeichen, das zu beseitigen ist, sollten
betonen, daß noch viele gründlich fundierte und quellenmäßig gesicherte Unter-
suchungen auf anderen geschichtlichen Gebieten, für andere Zeiten, andere Länder
gemacht, daß auch neben der bildenden Kunst Literatur, Musik, religiöses Leben in
das Netz der Untersuchung gezogen werden müssen, ehe von einer befriedigenden
Lösung der hier angeschnittenen Probleme wird gesprochen werden können. Aber
es bleibt ein hohes Verdienst Bechtels, tapfer und mit einer seltenen Fülle des Wis-
sens in brachliegendes Neuland vorgestoßen zu sein und zwischen zwei bisher weit
voneinander abliegenden Teilgebieten der Kulturgeschichte neue Wege zum minde-
sten vorbereitet und gangbar gemacht zu haben. Die Wirtschaftsgeschichte insbe-
sondere — das mag auch an dieser Stelle zum Schluß betont sein — wird es ihm
zu danken haben, daß er allzu schematische Anschauungen über die spätmittel-
alterliche Wirtschaftskultur Deutschlands aufgelockert und deren schöne Breite und
Fülle vor uns aufgedeckt hat.
Leipzig. Alfred Dören.
BESPRECHUNGEN.
spezifisch deutsche Sonderentwicklung entsprechen. Man fragt sich: besteht zwischen
den letzten Geheimnissen der deutschen Seele und dem spezifisch nationalen
Stil in Wirtschaft und Kunst, wie er hier als einheitliches historisches Phänomen
geschildert wird, ein innerer, wesenhafter Zusammenhang im Sinne des Verhält-
nisses von Geist und Ausdruck? Und wie steht es, wenn diese Frage, wie es scheint,
bejaht werden soll, mit der Entwicklung der Gotik bei den anderen Nationen? Wie
kommt es, vorausgesetzt, daß wir den funktionellen Zusammenhang zwischen Wirt-
schafts- und Kunststil in B.s Sinne gelten lassen, daß in Frankreich die Gotik der
großen Zeit allmählich versackt und versteinert, während zu gleicher Zeit der
expansionistisch-individualisierende Geist in der Wirtschaft Persönlichkeiten vom
Ausmaße einer Jacques Coeur zu erzeugen imstande ist? Wie kommt es, daß in
Italien, wo der Drang ins Weite, die weltumfassenden Horizonte, die Offenbarungen
individueller, schrankenbrechender Wirtschaftskräfte am frühesten und stärksten
zutage treten, diesem „Antitraditionalismus" ein ganz anders geartetes Kunstwollen,
das der Renaissancekunst, parallel läuft? Die Frage ist vor allem: wie weit sind
nationale Kräfte gleichsam als Urphänomene am Werke, die von B. gezeichnete
Entwicklung in bestimmte differenzierte Richtungen zu lenken; eine Frage, die mir
vom Verfasser wohl angeschlagen, keineswegs aber gelöst erscheint.
Damit hängt ein anderes zusammen. Ist es in der Tat so, daß die damals ein-
getretene Wandlung in der Anschauung vom Großhandel nur so zu erklären sei,
daß die Schöpfungen von Architektur, Malerei und Plastik auch in der großen
Masse eine erste Ahnung hätten aufsteigen lassen, welche Bedeutung das unge-
hemmt werbende Individuum im Sozial- und Wirtschaftsraum erlangen könnte und
welche Ansprüche an Freiheit es zu stellen berechtigt wäre — ist dem so, wie kommt
es dann, daß in Italien z. B. die Reihenfolge nachweislich die umgekehrte gewesen
ist, daß uns zuerst in der Welt des kaufmännischen Unternehmertums der neue Stil
der ungebunden ins Unendliche strebenden Individualität begegnet und erst später
die Kunst zum Erfasseil der Einzelpersönlichkeit als eines der Wiedergabe werten
Objektes fortschreitet, erst später auch die bildenden Künstler aus dem Bann von
Schule, Tradition und sozialen Bindungen zu individuell suchender und gestaltender
Tat sich lösen?
Doch genug der Einwände und Zweifel. Sie sollten nur gegenüber der etwas
allzu optimistischen Sicherheit des Verfassers den Blick auf manche Unklarheit
lenken, die hier noch zu klären, manches Fragezeichen, das zu beseitigen ist, sollten
betonen, daß noch viele gründlich fundierte und quellenmäßig gesicherte Unter-
suchungen auf anderen geschichtlichen Gebieten, für andere Zeiten, andere Länder
gemacht, daß auch neben der bildenden Kunst Literatur, Musik, religiöses Leben in
das Netz der Untersuchung gezogen werden müssen, ehe von einer befriedigenden
Lösung der hier angeschnittenen Probleme wird gesprochen werden können. Aber
es bleibt ein hohes Verdienst Bechtels, tapfer und mit einer seltenen Fülle des Wis-
sens in brachliegendes Neuland vorgestoßen zu sein und zwischen zwei bisher weit
voneinander abliegenden Teilgebieten der Kulturgeschichte neue Wege zum minde-
sten vorbereitet und gangbar gemacht zu haben. Die Wirtschaftsgeschichte insbe-
sondere — das mag auch an dieser Stelle zum Schluß betont sein — wird es ihm
zu danken haben, daß er allzu schematische Anschauungen über die spätmittel-
alterliche Wirtschaftskultur Deutschlands aufgelockert und deren schöne Breite und
Fülle vor uns aufgedeckt hat.
Leipzig. Alfred Dören.