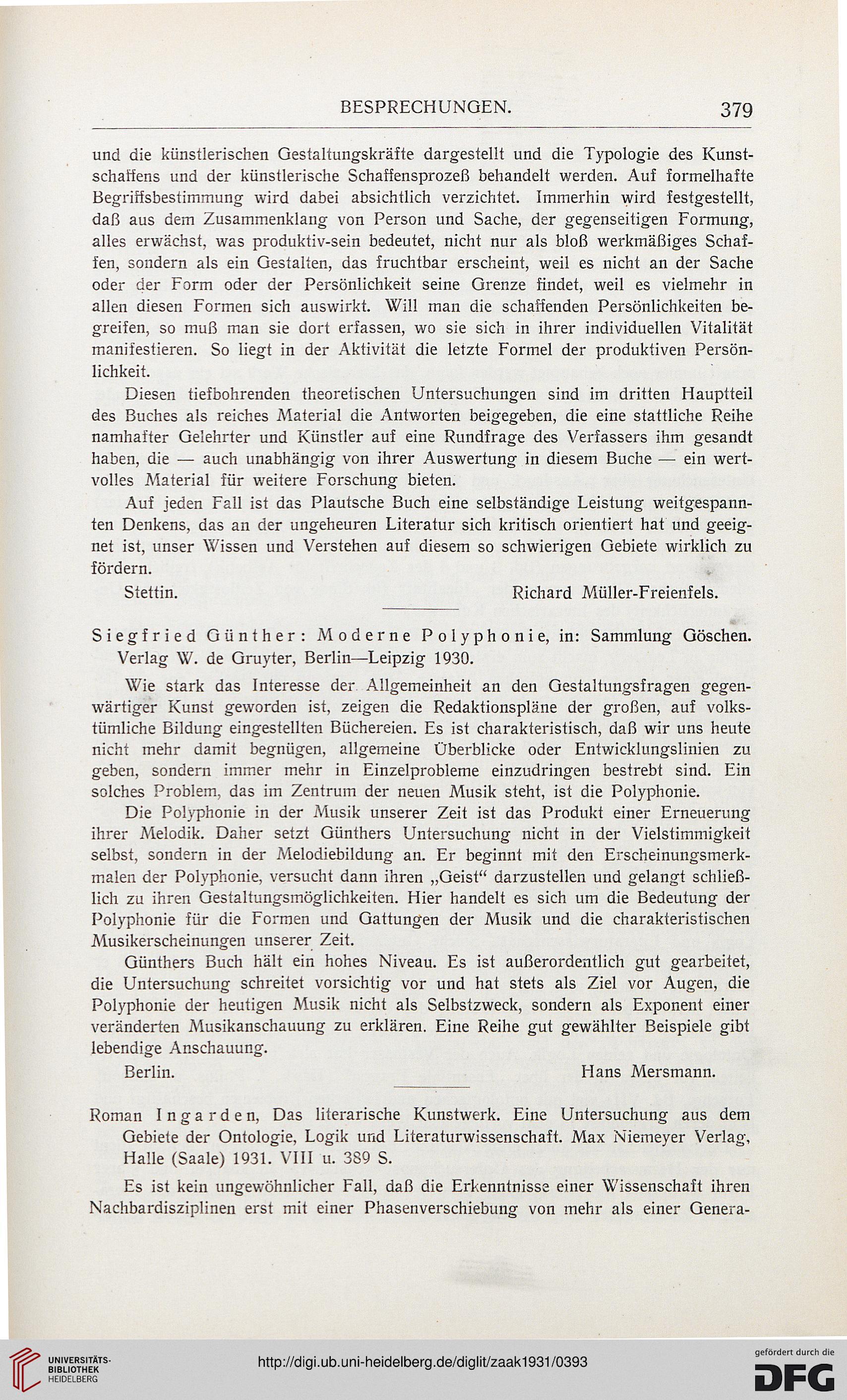BESPRECHUNGEN.
379
und die künstlerischen Gestaltungskräfte dargestellt und die Typologie cles Kunst-
schaffens und der künstlerische Schaffensprozeß behandelt werden. Auf formelhafte
Begriffsbestimmung wird dabei absichtlich verzichtet. Immerhin wird festgestellt,
daß aus dem Zusammenklang von Person und Sache, der gegenseitigen Formung,
alles erwächst, was produktiv-sein bedeutet, nicht nur als bloß werkmäßiges Schaf-
fen, sondern als ein Gestalten, das fruchtbar erscheint, weil es nicht an der Sache
oder der Form oder der Persönlichkeit seine Grenze findet, weil es vielmehr in
allen diesen Formen sich auswirkt. Will man die schaffenden Persönlichkeiten be-
greifen, so muß man sie dort erfassen, wo sie sich in ihrer individuellen Vitalität
manifestieren. So liegt in der Aktivität die letzte Formel der produktiven Persön-
lichkeit.
Diesen tiefbohrenden theoretischen Untersuchungen sind im dritten Hauptteil
des Buches als reiches Material die Antworten beigegeben, die eine stattliche Reihe
namhafter Gelehrter und Künstler auf eine Rundfrage des Verfassers ihm gesandt
haben, die — auch unabhängig von ihrer Auswertung in diesem Buche — ein wert-
volles Material für weitere Forschung bieten.
Auf jeden Fall ist das Plautsche Buch eine selbständige Leistung weitgespann-
ten Denkens, das an der ungeheuren Literatur sich kritisch orientiert hat und geeig-
net ist, unser Wissen und Verstehen auf diesem so schwierigen Gebiete wirklich zu
fördern.
Stettin. Richard Müller-Freienfels.
Siegfried Günther: Moderne Polyphonie, in: Sammlung Göschen.
Verlag W. de Gruyter, Berlin—Leipzig 1930.
Wie stark das Interesse der Allgemeinheit an den Gestaltungsfragen gegen-
wärtiger Kunst geworden ist, zeigen die Redaktionspläne der großen, auf volks-
tümliche Bildung eingestellten Büchereien. Es ist charakteristisch, daß wir uns heute
nicht mehr damit begnügen, allgemeine Überblicke oder Entwicklungslinien zu
geben, sondern immer mehr in Einzelprobleme einzudringen bestrebt sind. Ein
solches Problem, das im Zentrum der neuen Musik steht, ist die Polyphonie.
Die Polyphonie in der Musik unserer Zeit ist das Produkt einer Erneuerung
ihrer Melodik. Daher setzt Günthers Untersuchung nicht in der Vielstimmigkeit
selbst, sondern in der Melodiebildung an. Er beginnt mit den Erscheinungsmerk-
malen der Polyphonie, versucht dann ihren „Geist" darzustellen und gelangt schließ-
lich zu ihren Gestaltungsmöglichkeiten. Hier handelt es sich um die Bedeutung der
Polyphonie für die Formen und Gattungen der Musik und die charakteristischen
Musikerscheinungen unserer Zeit.
Günthers Buch hält ein hohes Niveau. Es ist außerordentlich gut gearbeitet,
die Untersuchung schreitet vorsichtig vor und hat stets als Ziel vor Augen, die
Polyphonie der heutigen Musik nicht als Selbstzweck, sondern als Exponent einer
veränderten Musikanschauung zu erklären. Eine Reihe gut gewählter Beispiele gibt
lebendige Anschauung.
Berlin. Hans Mersmann.
Roman I n g a r d e n, Das literarische Kunstwerk. Eine Untersuchung aus dem
Gebiete der Ontologie, Logik und Literaturwissenschaft. Max Niemeyer Verlag,
Halle (Saale) 1931. VIII u. 389 S.
Es ist kein ungewöhnlicher Fall, daß die Erkenntnisse einer Wissenschaft ihren
Nachbardisziplinen erst mit einer Phasenverschiebung von mehr als einer Genera-
379
und die künstlerischen Gestaltungskräfte dargestellt und die Typologie cles Kunst-
schaffens und der künstlerische Schaffensprozeß behandelt werden. Auf formelhafte
Begriffsbestimmung wird dabei absichtlich verzichtet. Immerhin wird festgestellt,
daß aus dem Zusammenklang von Person und Sache, der gegenseitigen Formung,
alles erwächst, was produktiv-sein bedeutet, nicht nur als bloß werkmäßiges Schaf-
fen, sondern als ein Gestalten, das fruchtbar erscheint, weil es nicht an der Sache
oder der Form oder der Persönlichkeit seine Grenze findet, weil es vielmehr in
allen diesen Formen sich auswirkt. Will man die schaffenden Persönlichkeiten be-
greifen, so muß man sie dort erfassen, wo sie sich in ihrer individuellen Vitalität
manifestieren. So liegt in der Aktivität die letzte Formel der produktiven Persön-
lichkeit.
Diesen tiefbohrenden theoretischen Untersuchungen sind im dritten Hauptteil
des Buches als reiches Material die Antworten beigegeben, die eine stattliche Reihe
namhafter Gelehrter und Künstler auf eine Rundfrage des Verfassers ihm gesandt
haben, die — auch unabhängig von ihrer Auswertung in diesem Buche — ein wert-
volles Material für weitere Forschung bieten.
Auf jeden Fall ist das Plautsche Buch eine selbständige Leistung weitgespann-
ten Denkens, das an der ungeheuren Literatur sich kritisch orientiert hat und geeig-
net ist, unser Wissen und Verstehen auf diesem so schwierigen Gebiete wirklich zu
fördern.
Stettin. Richard Müller-Freienfels.
Siegfried Günther: Moderne Polyphonie, in: Sammlung Göschen.
Verlag W. de Gruyter, Berlin—Leipzig 1930.
Wie stark das Interesse der Allgemeinheit an den Gestaltungsfragen gegen-
wärtiger Kunst geworden ist, zeigen die Redaktionspläne der großen, auf volks-
tümliche Bildung eingestellten Büchereien. Es ist charakteristisch, daß wir uns heute
nicht mehr damit begnügen, allgemeine Überblicke oder Entwicklungslinien zu
geben, sondern immer mehr in Einzelprobleme einzudringen bestrebt sind. Ein
solches Problem, das im Zentrum der neuen Musik steht, ist die Polyphonie.
Die Polyphonie in der Musik unserer Zeit ist das Produkt einer Erneuerung
ihrer Melodik. Daher setzt Günthers Untersuchung nicht in der Vielstimmigkeit
selbst, sondern in der Melodiebildung an. Er beginnt mit den Erscheinungsmerk-
malen der Polyphonie, versucht dann ihren „Geist" darzustellen und gelangt schließ-
lich zu ihren Gestaltungsmöglichkeiten. Hier handelt es sich um die Bedeutung der
Polyphonie für die Formen und Gattungen der Musik und die charakteristischen
Musikerscheinungen unserer Zeit.
Günthers Buch hält ein hohes Niveau. Es ist außerordentlich gut gearbeitet,
die Untersuchung schreitet vorsichtig vor und hat stets als Ziel vor Augen, die
Polyphonie der heutigen Musik nicht als Selbstzweck, sondern als Exponent einer
veränderten Musikanschauung zu erklären. Eine Reihe gut gewählter Beispiele gibt
lebendige Anschauung.
Berlin. Hans Mersmann.
Roman I n g a r d e n, Das literarische Kunstwerk. Eine Untersuchung aus dem
Gebiete der Ontologie, Logik und Literaturwissenschaft. Max Niemeyer Verlag,
Halle (Saale) 1931. VIII u. 389 S.
Es ist kein ungewöhnlicher Fall, daß die Erkenntnisse einer Wissenschaft ihren
Nachbardisziplinen erst mit einer Phasenverschiebung von mehr als einer Genera-