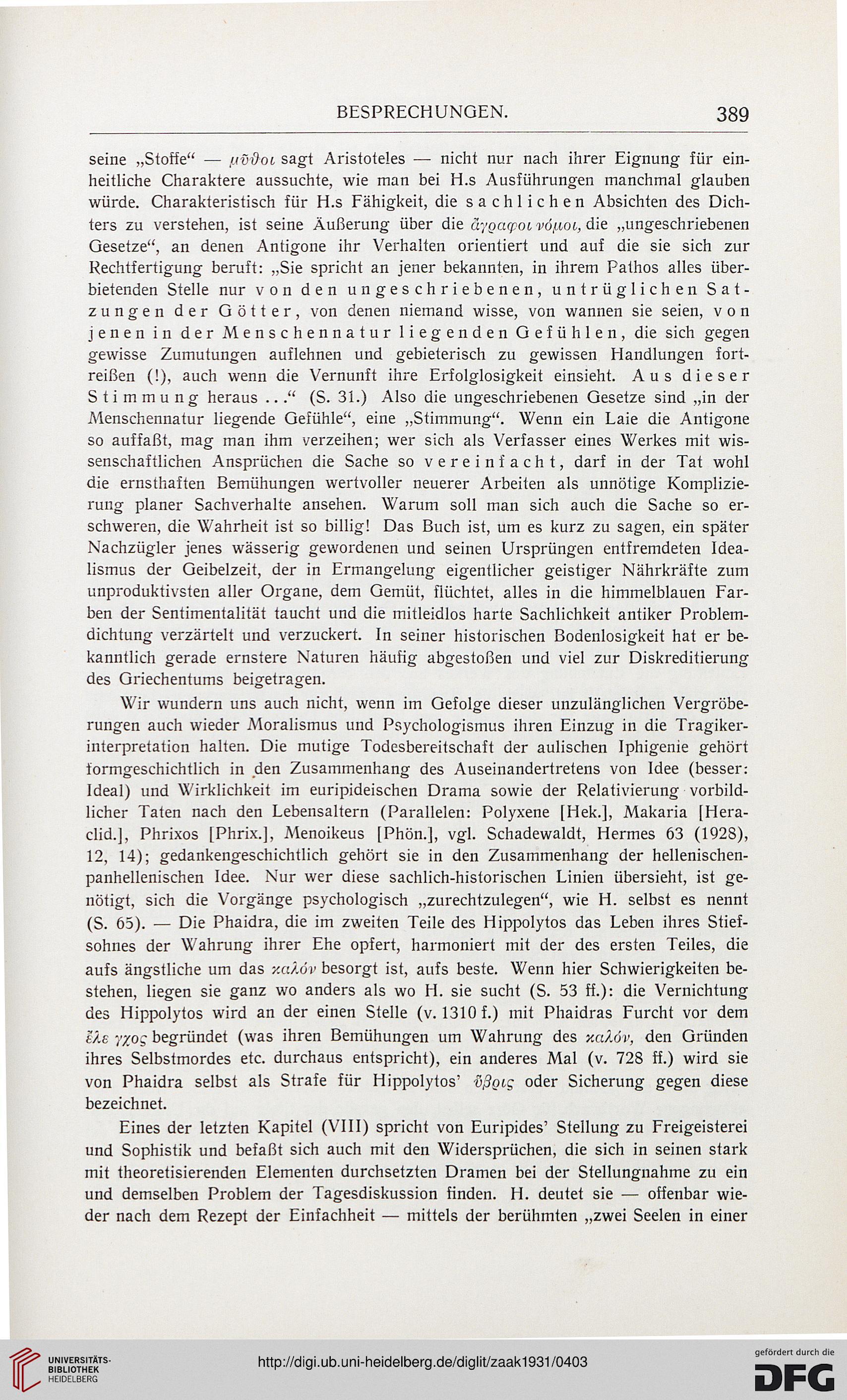BESPRECHUNGEN.
389
seine „Stoffe" — iavOol sagt Aristoteles — nicht nur nach ihrer Eignung für ein-
heitliche Charaktere aussuchte, wie man bei H.s Ausführungen manchmal glauben
würde. Charakteristisch für H.s Fähigkeit, die sachlichen Absichten des Dich-
ters zu verstehen, ist seine Äußerung über die äyoacpoi vd/ioi, die „ungeschriebenen
Gesetze", an denen Antigone ihr Verhalten orientiert und auf die sie sich zur
Rechtfertigung beruft: „Sie spricht an jener bekannten, in ihrem Pathos alles über-
bietenden Stelle nur von den ungeschriebenen, untrüglichen Sat-
zungen der Götter, von denen niemand wisse, von wannen sie seien, von
jenen in der Menschennatur liegenden Gefühlen, die sich gegen
gewisse Zumutungen auflehnen und gebieterisch zu gewissen Handlungen fort-
reißen (!), auch wenn die Vernunft ihre Erfolglosigkeit einsieht. Aus dieser
Stimmung heraus .. ." (S. 31.) Also die ungeschriebenen Gesetze sind „in der
Menschennatur liegende Gefühle", eine „Stimmung". Wenn ein Laie die Antigone
so auffaßt, mag man ihm verzeihen; wer sich als Verfasser eines Werkes mit wis-
senschaftlichen Ansprüchen die Sache so vereinfacht, darf in der Tat wohl
die ernsthaften Bemühungen wertvoller neuerer Arbeilen als unnötige Komplizie-
rung planer Sachverhalte ansehen. Warum soll man sich auch die Sache so er-
schweren, die Wahrheit ist so billig! Das Buch ist, um es kurz zu sagen, ein später
Nachzügler jenes wässerig gewordenen und seinen Ursprüngen entfremdeten Idea-
lismus der Geibelzeit, der in Ermangelung eigentlicher geistiger Nährkräfte zum
unproduktivsten aller Organe, dem Gemüt, flüchtet, alles in die himmelblauen Far-
ben der Sentimentalität taucht und die mitleidlos harte Sachlichkeit antiker Problem-
dichtung verzärtelt und verzuckert. In seiner historischen Bodenlosigkeit hat er be-
kanntlich gerade ernstere Naturen häufig abgestoßen und viel zur Diskreditierung
des Griechentums beigetragen.
Wir wundern uns auch nicht, wenn im Gefolge dieser unzulänglichen Vergröbe-
rungen auch wieder Moralismus und Psychologismus ihren Einzug in die Tragiker-
interpretation halten. Die mutige Todesbereitschaft der aulischen Iphigenie gehört
formgeschichtlich in _den Zusammenhang des Auseinandertretens von Idee (besser:
Ideal) und Wirklichkeit im euripideischen Drama sowie der Relativierung vorbild-
licher Taten nach den Lebensaltern (Parallelen: Polyxene [Hek.], Makaria [Hera-
clid.], Phrixos [Phrix.], Menoikeus [Phön.], vgl. Schadewaldt, Hermes 63 (1928),
12, 14); gedankengeschichtlich gehört sie in den Zusammenhang der hellenischen-
panhellenischen Idee. Nur wer diese sachlich-historischen Linien übersieht, ist ge-
nötigt, sich die Vorgänge psychologisch „zurechtzulegen", wie H. selbst es nennt
(S. 65). — Die Phaidra, die im zweiten Teile des Hippolytos das Leben ihres Stief-
sohnes der Wahrung ihrer Ehe opfert, harmoniert mit der des ersten Teiles, die
aufs ängstliche um das y.a/.öv besorgt ist, aufs beste. Wenn hier Schwierigkeiten be-
stehen, liegen sie ganz wo anders als wo H. sie sucht (S. 53 ff.): die Vernichtung
des Hippolytos wird an der einen Stelle (v. 1310 f.) mit Phaidras Furcht vor dem
lle -/-/o; begründet (was ihren Bemühungen um Wahrung des xcdöv, den Gründen
ihres Selbstmordes etc. durchaus entspricht), ein anderes Mal (v. 728 ff.) wird sie
von Phaidra selbst als Strafe für Hippolytos' vßoLg oder Sicherung gegen diese
bezeichnet.
Eines der letzten Kapitel (VIII) spricht von Euripides' Stellung zu Freigeisterei
und Sophistik und befaßt sich auch mit den Widersprüchen, die sich in seinen stark
mit theoretisierenden Elementen durchsetzten Dramen bei der Stellungnahme zu ein
und demselben Problem der Tagesdiskussion finden. H. deutet sie — offenbar wie-
der nach dem Rezept der Einfachheit — mittels der berühmten „zwei Seelen in einer
389
seine „Stoffe" — iavOol sagt Aristoteles — nicht nur nach ihrer Eignung für ein-
heitliche Charaktere aussuchte, wie man bei H.s Ausführungen manchmal glauben
würde. Charakteristisch für H.s Fähigkeit, die sachlichen Absichten des Dich-
ters zu verstehen, ist seine Äußerung über die äyoacpoi vd/ioi, die „ungeschriebenen
Gesetze", an denen Antigone ihr Verhalten orientiert und auf die sie sich zur
Rechtfertigung beruft: „Sie spricht an jener bekannten, in ihrem Pathos alles über-
bietenden Stelle nur von den ungeschriebenen, untrüglichen Sat-
zungen der Götter, von denen niemand wisse, von wannen sie seien, von
jenen in der Menschennatur liegenden Gefühlen, die sich gegen
gewisse Zumutungen auflehnen und gebieterisch zu gewissen Handlungen fort-
reißen (!), auch wenn die Vernunft ihre Erfolglosigkeit einsieht. Aus dieser
Stimmung heraus .. ." (S. 31.) Also die ungeschriebenen Gesetze sind „in der
Menschennatur liegende Gefühle", eine „Stimmung". Wenn ein Laie die Antigone
so auffaßt, mag man ihm verzeihen; wer sich als Verfasser eines Werkes mit wis-
senschaftlichen Ansprüchen die Sache so vereinfacht, darf in der Tat wohl
die ernsthaften Bemühungen wertvoller neuerer Arbeilen als unnötige Komplizie-
rung planer Sachverhalte ansehen. Warum soll man sich auch die Sache so er-
schweren, die Wahrheit ist so billig! Das Buch ist, um es kurz zu sagen, ein später
Nachzügler jenes wässerig gewordenen und seinen Ursprüngen entfremdeten Idea-
lismus der Geibelzeit, der in Ermangelung eigentlicher geistiger Nährkräfte zum
unproduktivsten aller Organe, dem Gemüt, flüchtet, alles in die himmelblauen Far-
ben der Sentimentalität taucht und die mitleidlos harte Sachlichkeit antiker Problem-
dichtung verzärtelt und verzuckert. In seiner historischen Bodenlosigkeit hat er be-
kanntlich gerade ernstere Naturen häufig abgestoßen und viel zur Diskreditierung
des Griechentums beigetragen.
Wir wundern uns auch nicht, wenn im Gefolge dieser unzulänglichen Vergröbe-
rungen auch wieder Moralismus und Psychologismus ihren Einzug in die Tragiker-
interpretation halten. Die mutige Todesbereitschaft der aulischen Iphigenie gehört
formgeschichtlich in _den Zusammenhang des Auseinandertretens von Idee (besser:
Ideal) und Wirklichkeit im euripideischen Drama sowie der Relativierung vorbild-
licher Taten nach den Lebensaltern (Parallelen: Polyxene [Hek.], Makaria [Hera-
clid.], Phrixos [Phrix.], Menoikeus [Phön.], vgl. Schadewaldt, Hermes 63 (1928),
12, 14); gedankengeschichtlich gehört sie in den Zusammenhang der hellenischen-
panhellenischen Idee. Nur wer diese sachlich-historischen Linien übersieht, ist ge-
nötigt, sich die Vorgänge psychologisch „zurechtzulegen", wie H. selbst es nennt
(S. 65). — Die Phaidra, die im zweiten Teile des Hippolytos das Leben ihres Stief-
sohnes der Wahrung ihrer Ehe opfert, harmoniert mit der des ersten Teiles, die
aufs ängstliche um das y.a/.öv besorgt ist, aufs beste. Wenn hier Schwierigkeiten be-
stehen, liegen sie ganz wo anders als wo H. sie sucht (S. 53 ff.): die Vernichtung
des Hippolytos wird an der einen Stelle (v. 1310 f.) mit Phaidras Furcht vor dem
lle -/-/o; begründet (was ihren Bemühungen um Wahrung des xcdöv, den Gründen
ihres Selbstmordes etc. durchaus entspricht), ein anderes Mal (v. 728 ff.) wird sie
von Phaidra selbst als Strafe für Hippolytos' vßoLg oder Sicherung gegen diese
bezeichnet.
Eines der letzten Kapitel (VIII) spricht von Euripides' Stellung zu Freigeisterei
und Sophistik und befaßt sich auch mit den Widersprüchen, die sich in seinen stark
mit theoretisierenden Elementen durchsetzten Dramen bei der Stellungnahme zu ein
und demselben Problem der Tagesdiskussion finden. H. deutet sie — offenbar wie-
der nach dem Rezept der Einfachheit — mittels der berühmten „zwei Seelen in einer