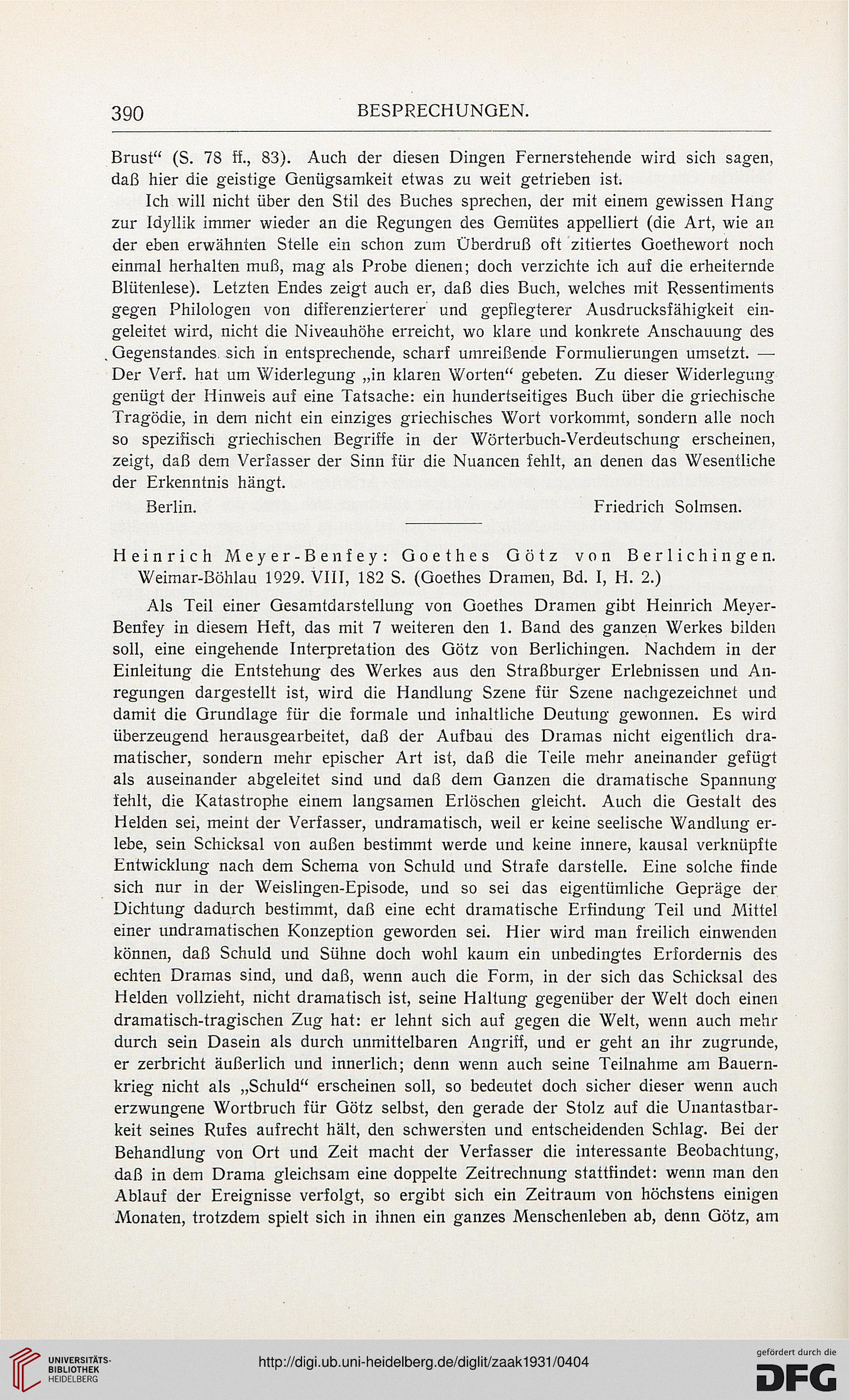390
BESPRECHUNGEN.
Brust" (S. 78 ff., 83). Auch der diesen Dingen Fernerstehende wird sich sagen,
daß hier die geistige Genügsamkeit etwas zu weit getrieben ist.
Ich will nicht über den Stil des Buches sprechen, der mit einem gewissen Hang
zur Idyllik immer wieder an die Regungen des Gemütes appelliert (die Art, wie an
der eben erwähnten Stelle ein schon zum Überdruß oft zitiertes Goethewort noch
einmal herhalten muß, mag als Probe dienen; doch verzichte ich auf die erheiternde
Blütenlese). Letzten Endes zeigt auch er, daß dies Buch, welches mit Ressentiments
gegen Philologen von differenzierterer und gepflegterer Ausdrucksfähigkeit ein-
geleitet wird, nicht die Niveauhöhe erreicht, wo klare und konkrete Anschauung des
Gegenstandes sich in entsprechende, scharf umreißende Formulierungen umsetzt. —
Der Verf. hat um Widerlegung „in klaren Worten" gebeten. Zu dieser Widerlegung
genügt der Hinweis auf eine Tatsache: ein hundertseitiges Buch über die griechische
Tragödie, in dem nicht ein einziges griechisches Wort vorkommt, sondern alle noch
so spezifisch griechischen Begriffe in der Wörterbuch-Verdeutschung erscheinen,
zeigt, daß dem Verfasser der Sinn für die Nuancen fehlt, an denen das Wesentliche
der Erkenntnis hängt.
Berlin. Friedrich Solmsen.
Heinrich Meyer-Ben fey: Goethes Götz von Berlichingen.
Weimar-Böhlau 1929. VIII, 182 S. (Goethes Dramen, Bd. I, H. 2.)
Als Teil einer Gesamtdarstellung von Goethes Dramen gibt Heinrich Meyer-
Benfey in diesem Heft, das mit 7 weiteren den 1. Band des ganzen Werkes bilden
soll, eine eingehende Interpretation des Götz von Berlichingen. Nachdem in der
Einleitung die Entstehung des Werkes aus den Straßburger Erlebnissen und An-
regungen dargestellt ist, wird die Handlung Szene für Szene nachgezeichnet und
damit die Grundlage für die formale und inhaltliche Deutung gewonnen. Es wird
überzeugend herausgearbeitet, daß der Aufbau des Dramas nicht eigentlich dra-
matischer, sondern mehr epischer Art ist, daß die Teile mehr aneinander gefügt
als auseinander abgeleitet sind und daß dem Ganzen die dramatische Spannung
fehlt, die Katastrophe einem langsamen Erlöschen gleicht. Auch die Gestalt des
Helden sei, meint der Verfasser, undramatisch, weil er keine seelische Wandlung er-
lebe, sein Schicksal von außen bestimmt werde und keine innere, kausal verknüpfte
Entwicklung nach dem Schema von Schuld und Strafe darstelle. Eine solche finde
sich nur in der Weislingen-Episode, und so sei das eigentümliche Gepräge der
Dichtung dadurch bestimmt, daß eine echt dramatische Erfindung Teil und Mittel
einer undramatischen Konzeption geworden sei. Hier wird man freilich einwenden
können, daß Schuld und Sühne doch wohl kaum ein unbedingtes Erfordernis des
echten Dramas sind, und daß, wenn auch die Form, in der sich das Schicksal des
Helden vollzieht, nicht dramatisch ist, seine Haltung gegenüber der Welt doch einen
dramatisch-tragischen Zug hat: er lehnt sich auf gegen die Welt, wenn auch mehr
durch sein Dasein als durch unmittelbaren Angriff, und er geht an ihr zugrunde,
er zerbricht äußerlich und innerlich; denn wenn auch seine Teilnahme am Bauern-
krieg nicht als „Schuld" erscheinen soll, so bedeutet doch sicher dieser wenn auch
erzwungene Wortbruch für Götz selbst, den gerade der Stolz auf die Unantastbar-
keit seines Rufes aufrecht hält, den schwersten und entscheidenden Schlag. Bei der
Behandlung von Ort und Zeit macht der Verfasser die interessante Beobachtung,
daß in dem Drama gleichsam eine doppelte Zeitrechnung stattfindet: wenn man den
Ablauf der Ereignisse verfolgt, so ergibt sich ein Zeitraum von höchstens einigen
Monaten, trotzdem spielt sich in ihnen ein ganzes Menschenleben ab, denn Götz, am
BESPRECHUNGEN.
Brust" (S. 78 ff., 83). Auch der diesen Dingen Fernerstehende wird sich sagen,
daß hier die geistige Genügsamkeit etwas zu weit getrieben ist.
Ich will nicht über den Stil des Buches sprechen, der mit einem gewissen Hang
zur Idyllik immer wieder an die Regungen des Gemütes appelliert (die Art, wie an
der eben erwähnten Stelle ein schon zum Überdruß oft zitiertes Goethewort noch
einmal herhalten muß, mag als Probe dienen; doch verzichte ich auf die erheiternde
Blütenlese). Letzten Endes zeigt auch er, daß dies Buch, welches mit Ressentiments
gegen Philologen von differenzierterer und gepflegterer Ausdrucksfähigkeit ein-
geleitet wird, nicht die Niveauhöhe erreicht, wo klare und konkrete Anschauung des
Gegenstandes sich in entsprechende, scharf umreißende Formulierungen umsetzt. —
Der Verf. hat um Widerlegung „in klaren Worten" gebeten. Zu dieser Widerlegung
genügt der Hinweis auf eine Tatsache: ein hundertseitiges Buch über die griechische
Tragödie, in dem nicht ein einziges griechisches Wort vorkommt, sondern alle noch
so spezifisch griechischen Begriffe in der Wörterbuch-Verdeutschung erscheinen,
zeigt, daß dem Verfasser der Sinn für die Nuancen fehlt, an denen das Wesentliche
der Erkenntnis hängt.
Berlin. Friedrich Solmsen.
Heinrich Meyer-Ben fey: Goethes Götz von Berlichingen.
Weimar-Böhlau 1929. VIII, 182 S. (Goethes Dramen, Bd. I, H. 2.)
Als Teil einer Gesamtdarstellung von Goethes Dramen gibt Heinrich Meyer-
Benfey in diesem Heft, das mit 7 weiteren den 1. Band des ganzen Werkes bilden
soll, eine eingehende Interpretation des Götz von Berlichingen. Nachdem in der
Einleitung die Entstehung des Werkes aus den Straßburger Erlebnissen und An-
regungen dargestellt ist, wird die Handlung Szene für Szene nachgezeichnet und
damit die Grundlage für die formale und inhaltliche Deutung gewonnen. Es wird
überzeugend herausgearbeitet, daß der Aufbau des Dramas nicht eigentlich dra-
matischer, sondern mehr epischer Art ist, daß die Teile mehr aneinander gefügt
als auseinander abgeleitet sind und daß dem Ganzen die dramatische Spannung
fehlt, die Katastrophe einem langsamen Erlöschen gleicht. Auch die Gestalt des
Helden sei, meint der Verfasser, undramatisch, weil er keine seelische Wandlung er-
lebe, sein Schicksal von außen bestimmt werde und keine innere, kausal verknüpfte
Entwicklung nach dem Schema von Schuld und Strafe darstelle. Eine solche finde
sich nur in der Weislingen-Episode, und so sei das eigentümliche Gepräge der
Dichtung dadurch bestimmt, daß eine echt dramatische Erfindung Teil und Mittel
einer undramatischen Konzeption geworden sei. Hier wird man freilich einwenden
können, daß Schuld und Sühne doch wohl kaum ein unbedingtes Erfordernis des
echten Dramas sind, und daß, wenn auch die Form, in der sich das Schicksal des
Helden vollzieht, nicht dramatisch ist, seine Haltung gegenüber der Welt doch einen
dramatisch-tragischen Zug hat: er lehnt sich auf gegen die Welt, wenn auch mehr
durch sein Dasein als durch unmittelbaren Angriff, und er geht an ihr zugrunde,
er zerbricht äußerlich und innerlich; denn wenn auch seine Teilnahme am Bauern-
krieg nicht als „Schuld" erscheinen soll, so bedeutet doch sicher dieser wenn auch
erzwungene Wortbruch für Götz selbst, den gerade der Stolz auf die Unantastbar-
keit seines Rufes aufrecht hält, den schwersten und entscheidenden Schlag. Bei der
Behandlung von Ort und Zeit macht der Verfasser die interessante Beobachtung,
daß in dem Drama gleichsam eine doppelte Zeitrechnung stattfindet: wenn man den
Ablauf der Ereignisse verfolgt, so ergibt sich ein Zeitraum von höchstens einigen
Monaten, trotzdem spielt sich in ihnen ein ganzes Menschenleben ab, denn Götz, am