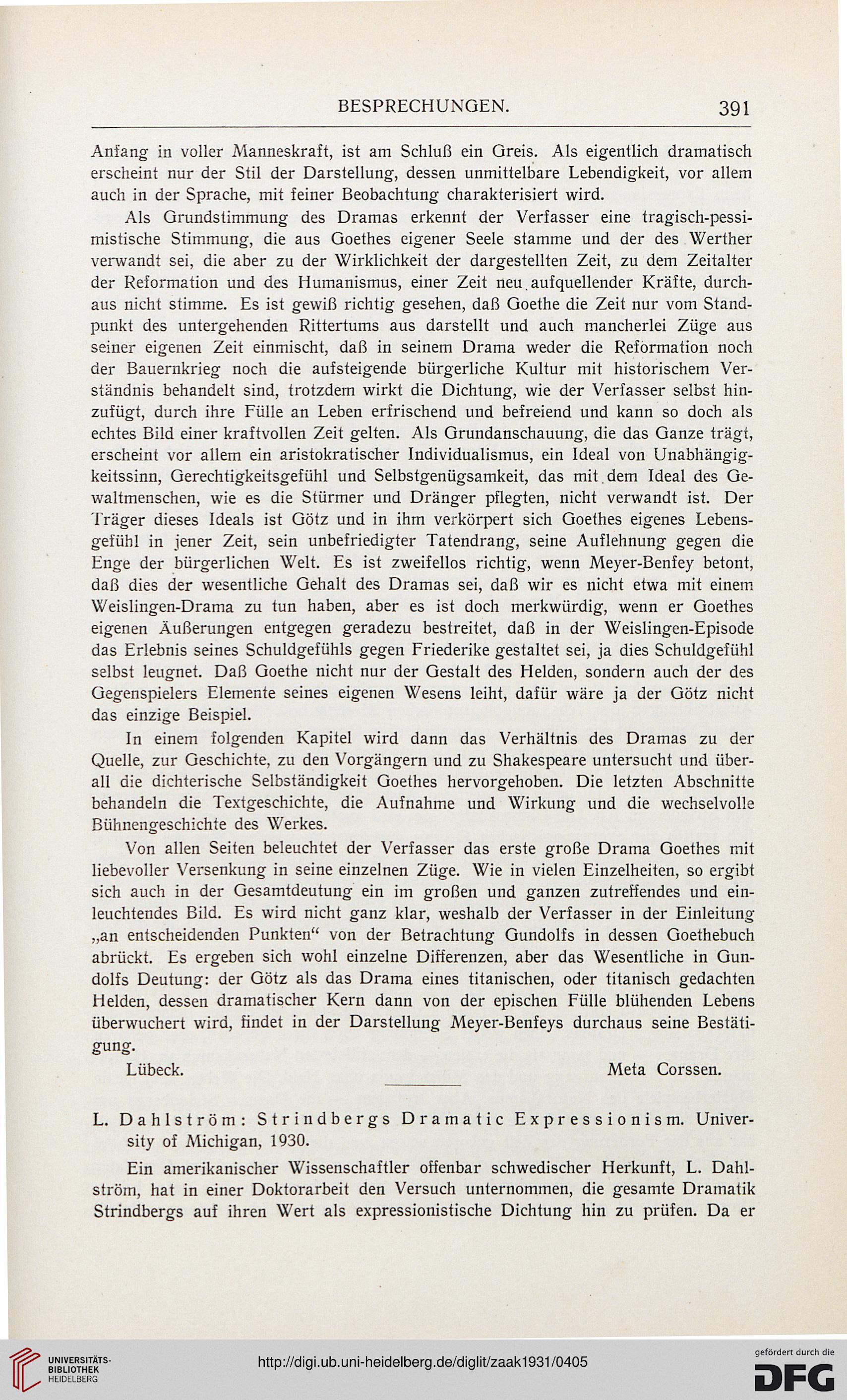BESPRECHUNGEN.
391
Anfang in voller Manneskraft, ist am Schluß ein Greis. Als eigentlich dramatisch
erscheint nur der Stil der Darstellung, dessen unmittelbare Lebendigkeit, vor allem
auch in der Sprache, mit feiner Beobachtung charakterisiert wird.
Als Grundstimmung des Dramas erkennt der Verfasser eine tragisch-pessi-
mistische Stimmung, die aus Goethes eigener Seele stamme und der des Werther
verwandt sei, die aber zu der Wirklichkeit der dargestellten Zeit, zu dem Zeitalter
der Reformation und des Humanismus, einer Zeit neu. aufquellender Kräfte, durch-
aus nicht stimme. Es ist gewiß richtig gesehen, daß Goethe die Zeit nur vom Stand-
punkt des untergehenden Rittertums aus darstellt und auch mancherlei Züge aus
seiner eigenen Zeit einmischt, daß in seinem Drama weder die Reformation noch
der Bauernkrieg noch die aufsteigende bürgerliche Kultur mit historischem Ver-
ständnis behandelt sind, trotzdem wirkt die Dichtung, wie der Verfasser selbst hin-
zufügt, durch ihre Fülle an Leben erfrischend und befreiend und kann so doch als
echtes Bild einer kraftvollen Zeit gelten. Als Grundanschauung, die das Ganze trägt,
erscheint vor allem ein aristokratischer Individualismus, ein Ideal von Unabhängig-
keitssinn, Gerechtigkeitsgefühl und Selbstgenügsamkeit, das mit. dem Ideal des Ge-
waltmenschen, wie es die Stürmer und Dränger pflegten, nicht verwandt ist. Der
Träger dieses Ideals ist Götz und in ihm verkörpert sich Goethes eigenes Lebens-
gefühl in jener Zeit, sein unbefriedigter Tatendrang, seine Auflehnung gegen die
Enge der bürgerlichen Welt. Es ist zweifellos richtig, wenn Meyer-Benfey betont,
daß dies der wesentliche Gehalt des Dramas sei, daß wir es nicht etwa mit einem
Weislingen-Drama zu tun haben, aber es ist doch merkwürdig, wenn er Goethes
eigenen Äußerungen entgegen geradezu bestreitet, daß in der Weislingen-Episode
das Erlebnis seines Schuldgefühls gegen Friederike gestaltet sei, ja dies Schuldgefühl
selbst leugnet. Daß Goethe nicht nur der Gestalt des Helden, sondern auch der des
Gegenspielers Elemente seines eigenen Wesens leiht, dafür wäre ja der Götz nicht
das einzige Beispiel.
In einem folgenden Kapitel wird dann das Verhältnis des Dramas zu der
Quelle, zur Geschichte, zu den Vorgängern und zu Shakespeare untersucht und über-
all die dichterische Selbständigkeit Goethes hervorgehoben. Die letzten Abschnitte
behandeln die Textgeschichte, die Aufnahme und Wirkung und die wechselvolle
Bühnengeschichte des Werkes.
Von allen Seiten beleuchtet der Verfasser das erste große Drama Goethes mit
liebevoller Versenkung in seine einzelnen Züge. Wie in vielen Einzelheiten, so ergibt
sich auch in der Gesamtdeutung ein im großen und ganzen zutreffendes und ein-
leuchtendes Bild. Es wird nicht ganz klar, weshalb der Verfasser in der Einleitung
„an entscheidenden Punkten" von der Betrachtung Gundolfs in dessen Goethebuch
abrückt. Es ergeben sich wohl einzelne Differenzen, aber das Wesentliche in Gun-
dolfs Deutung: der Götz als das Drama eines titanischen, oder titanisch gedachten
Helden, dessen dramatischer Kern dann von der epischen Fülle blühenden Lebens
überwuchert wird, findet in der Darstellung Meyer-Benfeys durchaus seine Bestäti-
gung.
Lübeck. Meta Corssen.
L. Dahlström: Strindbergs Dramatic Expressionism. Univer-
sity of Michigan, 1930.
Ein amerikanischer Wissenschaftler offenbar schwedischer Herkunft, L. Dahl-
ström, hat in einer Doktorarbeit den Versuch unternommen, die gesamte Dramatik
Strindbergs auf ihren Wert als expressionistische Dichtung hin zu prüfen. Da er
391
Anfang in voller Manneskraft, ist am Schluß ein Greis. Als eigentlich dramatisch
erscheint nur der Stil der Darstellung, dessen unmittelbare Lebendigkeit, vor allem
auch in der Sprache, mit feiner Beobachtung charakterisiert wird.
Als Grundstimmung des Dramas erkennt der Verfasser eine tragisch-pessi-
mistische Stimmung, die aus Goethes eigener Seele stamme und der des Werther
verwandt sei, die aber zu der Wirklichkeit der dargestellten Zeit, zu dem Zeitalter
der Reformation und des Humanismus, einer Zeit neu. aufquellender Kräfte, durch-
aus nicht stimme. Es ist gewiß richtig gesehen, daß Goethe die Zeit nur vom Stand-
punkt des untergehenden Rittertums aus darstellt und auch mancherlei Züge aus
seiner eigenen Zeit einmischt, daß in seinem Drama weder die Reformation noch
der Bauernkrieg noch die aufsteigende bürgerliche Kultur mit historischem Ver-
ständnis behandelt sind, trotzdem wirkt die Dichtung, wie der Verfasser selbst hin-
zufügt, durch ihre Fülle an Leben erfrischend und befreiend und kann so doch als
echtes Bild einer kraftvollen Zeit gelten. Als Grundanschauung, die das Ganze trägt,
erscheint vor allem ein aristokratischer Individualismus, ein Ideal von Unabhängig-
keitssinn, Gerechtigkeitsgefühl und Selbstgenügsamkeit, das mit. dem Ideal des Ge-
waltmenschen, wie es die Stürmer und Dränger pflegten, nicht verwandt ist. Der
Träger dieses Ideals ist Götz und in ihm verkörpert sich Goethes eigenes Lebens-
gefühl in jener Zeit, sein unbefriedigter Tatendrang, seine Auflehnung gegen die
Enge der bürgerlichen Welt. Es ist zweifellos richtig, wenn Meyer-Benfey betont,
daß dies der wesentliche Gehalt des Dramas sei, daß wir es nicht etwa mit einem
Weislingen-Drama zu tun haben, aber es ist doch merkwürdig, wenn er Goethes
eigenen Äußerungen entgegen geradezu bestreitet, daß in der Weislingen-Episode
das Erlebnis seines Schuldgefühls gegen Friederike gestaltet sei, ja dies Schuldgefühl
selbst leugnet. Daß Goethe nicht nur der Gestalt des Helden, sondern auch der des
Gegenspielers Elemente seines eigenen Wesens leiht, dafür wäre ja der Götz nicht
das einzige Beispiel.
In einem folgenden Kapitel wird dann das Verhältnis des Dramas zu der
Quelle, zur Geschichte, zu den Vorgängern und zu Shakespeare untersucht und über-
all die dichterische Selbständigkeit Goethes hervorgehoben. Die letzten Abschnitte
behandeln die Textgeschichte, die Aufnahme und Wirkung und die wechselvolle
Bühnengeschichte des Werkes.
Von allen Seiten beleuchtet der Verfasser das erste große Drama Goethes mit
liebevoller Versenkung in seine einzelnen Züge. Wie in vielen Einzelheiten, so ergibt
sich auch in der Gesamtdeutung ein im großen und ganzen zutreffendes und ein-
leuchtendes Bild. Es wird nicht ganz klar, weshalb der Verfasser in der Einleitung
„an entscheidenden Punkten" von der Betrachtung Gundolfs in dessen Goethebuch
abrückt. Es ergeben sich wohl einzelne Differenzen, aber das Wesentliche in Gun-
dolfs Deutung: der Götz als das Drama eines titanischen, oder titanisch gedachten
Helden, dessen dramatischer Kern dann von der epischen Fülle blühenden Lebens
überwuchert wird, findet in der Darstellung Meyer-Benfeys durchaus seine Bestäti-
gung.
Lübeck. Meta Corssen.
L. Dahlström: Strindbergs Dramatic Expressionism. Univer-
sity of Michigan, 1930.
Ein amerikanischer Wissenschaftler offenbar schwedischer Herkunft, L. Dahl-
ström, hat in einer Doktorarbeit den Versuch unternommen, die gesamte Dramatik
Strindbergs auf ihren Wert als expressionistische Dichtung hin zu prüfen. Da er