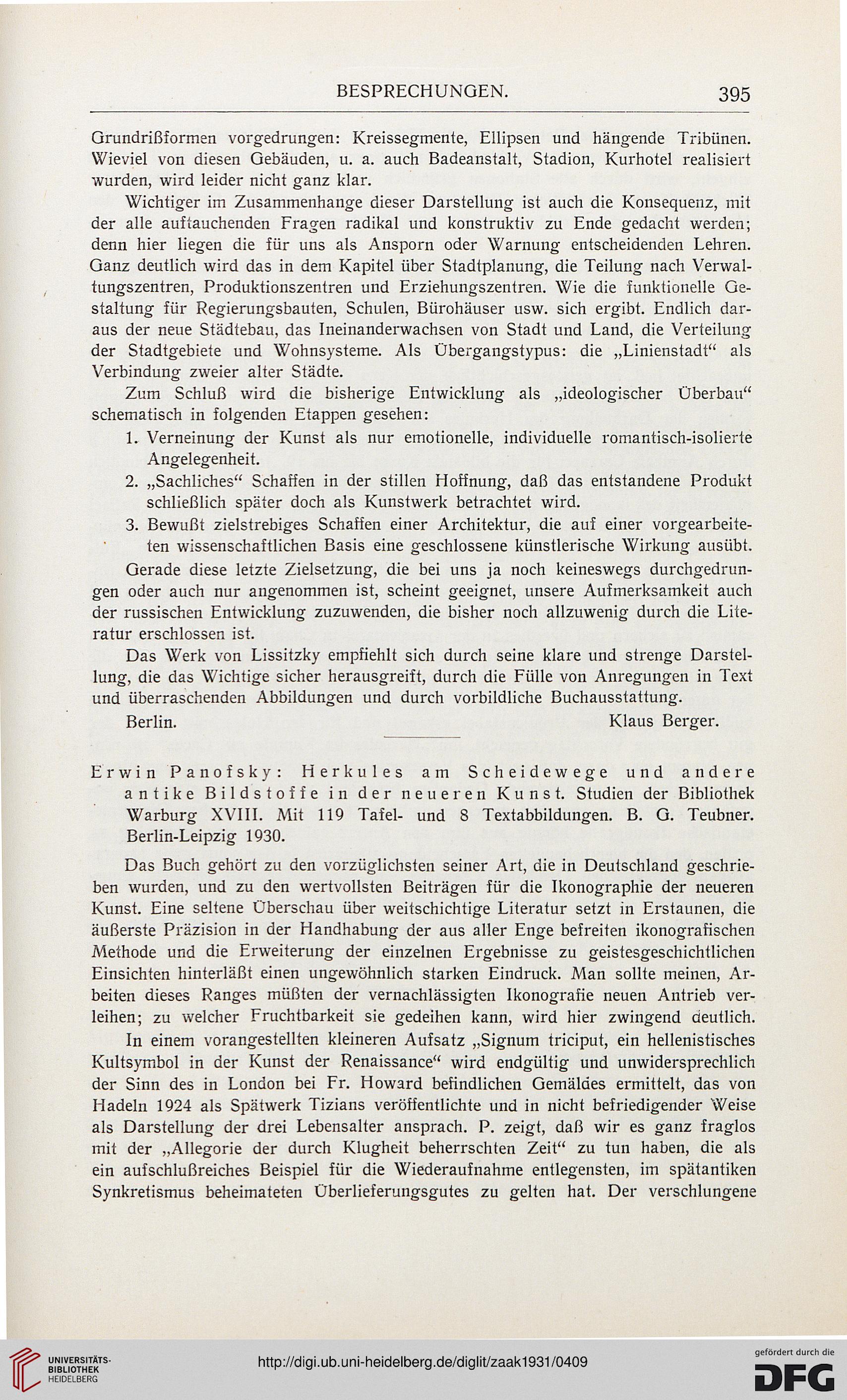BESPRECHUNGEN.
395
Grundrißformen vorgedrungen: Kreissegmente, Ellipsen und hängende Tribünen.
Wieviel von diesen Gebäuden, u. a. auch Badeanstalt, Stadion, Kurhotel realisiert
wurden, wird leider nicht ganz klar.
Wichtiger im Zusammenhange dieser Darstellung ist auch die Konsequenz, mit
der alle auftauchenden Fragen radikal und konstruktiv zu Ende gedacht werden;
denn hier liegen die für uns als Ansporn oder Warnung entscheidenden Lehren.
Ganz deutlich wird das in dem Kapitel über Stadtplanung, die Teilung nach Verwal-
tungszentren, Produktionszentren und Erziehungszentren. Wie die funktionelle Ge-
staltung für Regierungsbauten, Schulen, Bürohäuser usw. sich ergibt. Endlich dar-
aus der neue Städtebau, das Ineinanderwachsen von Stadt und Land, die Verteilung
der Stadtgebiete und Wohnsysteme. Als Obergangstypus: die „Linienstadt" als
Verbindung zweier alter Städte.
Zum Schluß wird die bisherige Entwicklung als „ideologischer Oberbau"
schematisch in folgenden Etappen gesehen:
1. Verneinung der Kunst als nur emotionelle, individuelle romantisch-isolierte
Angelegenheit.
2. „Sachliches" Schaffen in der stillen Hoffnung, daß das entstandene Produkt
schließlich später doch als Kunstwerk betrachtet wird.
3. Bewußt zielstrebiges Schaffen einer Architektur, die auf einer vorgearbeite-
ten wissenschaftlichen Basis eine geschlossene künstlerische Wirkung ausübt.
Gerade diese letzte Zielsetzung, die bei uns ja noch keineswegs durchgedrun-
gen oder auch nur angenommen ist, scheint geeignet, unsere Aufmerksamkeit auch
der russischen Entwicklung zuzuwenden, die bisher noch allzuwenig durch die Lite-
ratur erschlossen ist.
Das Werk von Lissitzky empfiehlt sich durch seine klare und strenge Darstel-
lung, die das Wichtige sicher herausgreift, durch die Fülle von Anregungen in Text
und überraschenden Abbildungen und durch vorbildliche Buchausstattung.
Berlin. Klaus Berger.
Erwin Panofsky: Herkules am Scheidewege und andere
antike Bildstoffe in der neueren Kunst. Studien der Bibliothek
Warburg XVIII. Mit 119 Tafel- und 8 Textabbildungen. B. G. Teubner.
Berlin-Leipzig 1930.
Das Buch gehört zu den vorzüglichsten seiner Art, die in Deutschland geschrie-
ben wurden, und zu den wertvollsten Beiträgen für die Ikonographie der neueren
Kunst. Eine seltene Oberschau über weitschichtige Literatur setzt in Erstaunen, die
äußerste Präzision in der Handhabung der aus aller Enge befreiten ikonografischen
Methode und die Erweiterung der einzelnen Ergebnisse zu geistesgeschichtlichen
Einsichten hinterläßt einen ungewöhnlich starken Eindruck. Man sollte meinen, Ar-
beiten dieses Ranges müßten der vernachlässigten Ikonografie neuen Antrieb ver-
leihen; zu welcher Fruchtbarkeit sie gedeihen kann, wird hier zwingend deutlich.
In einem vorangestellten kleineren Aufsatz „Signum triciput, ein hellenistisches
Kultsymbol in der Kunst der Renaissance" wird endgültig und unwidersprechlich
der Sinn des in London bei Fr. Howard befindlichen Gemäldes ermittelt, das von
Hadeln 1924 als Spätwerk Tizians veröffentlichte und in nicht befriedigender Weise
als Darstellung der drei Lebensalter ansprach. P. zeigt, daß wir es ganz fraglos
mit der „Allegorie der durch Klugheit beherrschten Zeit" zu tun haben, die als
ein aufschlußreiches Beispiel für die Wiederaufnahme entlegensten, im spätantiken
Synkretismus beheimateten Überlieferungsgutes zu gelten hat. Der verschlungene
395
Grundrißformen vorgedrungen: Kreissegmente, Ellipsen und hängende Tribünen.
Wieviel von diesen Gebäuden, u. a. auch Badeanstalt, Stadion, Kurhotel realisiert
wurden, wird leider nicht ganz klar.
Wichtiger im Zusammenhange dieser Darstellung ist auch die Konsequenz, mit
der alle auftauchenden Fragen radikal und konstruktiv zu Ende gedacht werden;
denn hier liegen die für uns als Ansporn oder Warnung entscheidenden Lehren.
Ganz deutlich wird das in dem Kapitel über Stadtplanung, die Teilung nach Verwal-
tungszentren, Produktionszentren und Erziehungszentren. Wie die funktionelle Ge-
staltung für Regierungsbauten, Schulen, Bürohäuser usw. sich ergibt. Endlich dar-
aus der neue Städtebau, das Ineinanderwachsen von Stadt und Land, die Verteilung
der Stadtgebiete und Wohnsysteme. Als Obergangstypus: die „Linienstadt" als
Verbindung zweier alter Städte.
Zum Schluß wird die bisherige Entwicklung als „ideologischer Oberbau"
schematisch in folgenden Etappen gesehen:
1. Verneinung der Kunst als nur emotionelle, individuelle romantisch-isolierte
Angelegenheit.
2. „Sachliches" Schaffen in der stillen Hoffnung, daß das entstandene Produkt
schließlich später doch als Kunstwerk betrachtet wird.
3. Bewußt zielstrebiges Schaffen einer Architektur, die auf einer vorgearbeite-
ten wissenschaftlichen Basis eine geschlossene künstlerische Wirkung ausübt.
Gerade diese letzte Zielsetzung, die bei uns ja noch keineswegs durchgedrun-
gen oder auch nur angenommen ist, scheint geeignet, unsere Aufmerksamkeit auch
der russischen Entwicklung zuzuwenden, die bisher noch allzuwenig durch die Lite-
ratur erschlossen ist.
Das Werk von Lissitzky empfiehlt sich durch seine klare und strenge Darstel-
lung, die das Wichtige sicher herausgreift, durch die Fülle von Anregungen in Text
und überraschenden Abbildungen und durch vorbildliche Buchausstattung.
Berlin. Klaus Berger.
Erwin Panofsky: Herkules am Scheidewege und andere
antike Bildstoffe in der neueren Kunst. Studien der Bibliothek
Warburg XVIII. Mit 119 Tafel- und 8 Textabbildungen. B. G. Teubner.
Berlin-Leipzig 1930.
Das Buch gehört zu den vorzüglichsten seiner Art, die in Deutschland geschrie-
ben wurden, und zu den wertvollsten Beiträgen für die Ikonographie der neueren
Kunst. Eine seltene Oberschau über weitschichtige Literatur setzt in Erstaunen, die
äußerste Präzision in der Handhabung der aus aller Enge befreiten ikonografischen
Methode und die Erweiterung der einzelnen Ergebnisse zu geistesgeschichtlichen
Einsichten hinterläßt einen ungewöhnlich starken Eindruck. Man sollte meinen, Ar-
beiten dieses Ranges müßten der vernachlässigten Ikonografie neuen Antrieb ver-
leihen; zu welcher Fruchtbarkeit sie gedeihen kann, wird hier zwingend deutlich.
In einem vorangestellten kleineren Aufsatz „Signum triciput, ein hellenistisches
Kultsymbol in der Kunst der Renaissance" wird endgültig und unwidersprechlich
der Sinn des in London bei Fr. Howard befindlichen Gemäldes ermittelt, das von
Hadeln 1924 als Spätwerk Tizians veröffentlichte und in nicht befriedigender Weise
als Darstellung der drei Lebensalter ansprach. P. zeigt, daß wir es ganz fraglos
mit der „Allegorie der durch Klugheit beherrschten Zeit" zu tun haben, die als
ein aufschlußreiches Beispiel für die Wiederaufnahme entlegensten, im spätantiken
Synkretismus beheimateten Überlieferungsgutes zu gelten hat. Der verschlungene