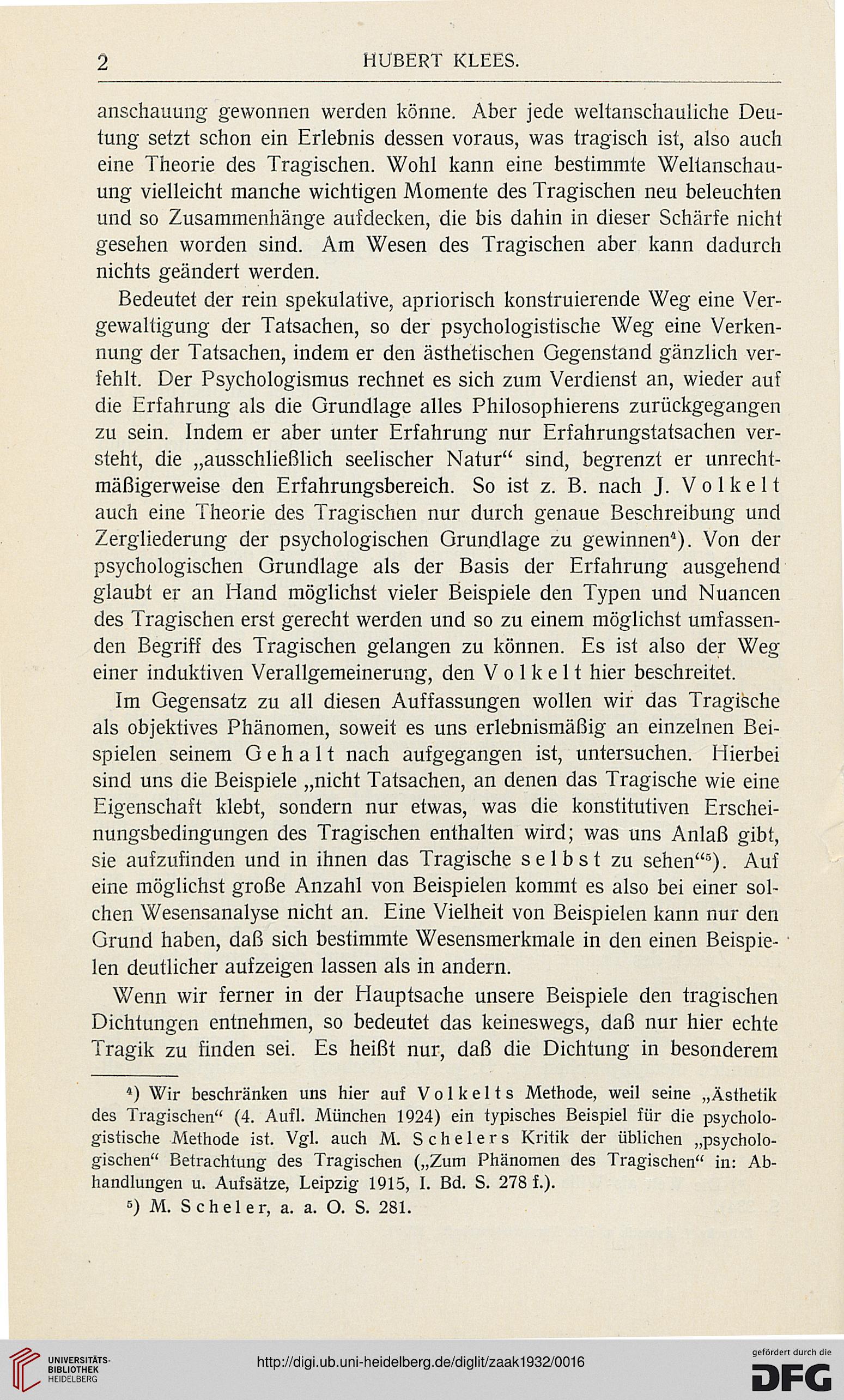2
HUBERT KLEES.
anschauung gewonnen werden könne. Aber jede weltanschauliche Deu-
tung setzt schon ein Erlebnis dessen voraus, was tragisch ist, also auch
eine Theorie des Tragischen. Wohl kann eine bestimmte Weltanschau-
ung vielleicht manche wichtigen Momente des Tragischen neu beleuchten
und so Zusammenhänge aufdecken, die bis dahin in dieser Schärfe nicht
gesehen worden sind. Am Wesen des Tragischen aber kann dadurch
nichts geändert werden.
Bedeutet der rein spekulative, apriorisch konstruierende Weg eine Ver-
gewaltigung der Tatsachen, so der psychologistische Weg eine Verken-
nung der Tatsachen, indem er den ästhetischen Gegenstand gänzlich ver-
fehlt. Der Psychologismus rechnet es sich zum Verdienst an, wieder auf
die Erfahrung als die Grundlage alles Philosophierens zurückgegangen
zu sein. Indem er aber unter Erfahrung nur Erfahrungstatsachen ver-
steht, die „ausschließlich seelischer Natur" sind, begrenzt er unrecht-
mäßigerweise den Erfahrungsbereich. So ist z. B. nach J. Volkelt
auch eine Theorie des Tragischen nur durch genaue Beschreibung und
Zergliederung der psychologischen Grundlage zu gewinnen"). Von der
psychologischen Grundlage als der Basis der Erfahrung ausgehend
glaubt er an Hand möglichst vieler Beispiele den Typen und Nuancen
des Tragischen erst gerecht werden und so zu einem möglichst umfassen-
den Begriff des Tragischen gelangen zu können. Es ist also der Weg
einer induktiven Verallgemeinerung, den V o 1 k e 11 hier beschreitet.
Im Gegensatz zu all diesen Auffassungen wollen wir das Tragische
als objektives Phänomen, soweit es uns erlebnismäßig an einzelnen Bei-
spielen seinem Gehalt nach aufgegangen ist, untersuchen. Hierbei
sind uns die Beispiele „nicht Tatsachen, an denen das Tragische wie eine
Eigenschaft klebt, sondern nur etwas, was die konstitutiven Erschei-
nungsbedingungen des Tragischen enthalten wird; was uns Anlaß gibt,
sie aufzufinden und in ihnen das Tragische selbst zu sehen""'). Auf
eine möglichst große Anzahl von Beispielen kommt es also bei einer sol-
chen Wesensanalyse nicht an. Eine Vielheit von Beispielen kann nur den
Grund haben, daß sich bestimmte Wesensmerkmale in den einen Beispie-
len deutlicher aufzeigen lassen als in andern.
Wenn wir ferner in der Hauptsache unsere Beispiele den tragischen
Dichtungen entnehmen, so bedeutet das keineswegs, daß nur hier echte
Tragik zu finden sei. Es heißt nur, daß die Dichtung in besonderem
4) Wir beschränken uns hier auf V o 1 k e 11 s Methode, weil seine „Ästhetik
des Tragischen" (4. Aufl. München 1924) ein typisches Beispiel für die psycholo-
gistische Methode ist. Vgl. auch M. Schelers Kritik der üblichen „psycholo-
gischen" Betrachtung des Tragischen („Zum Phänomen des Tragischen" in: Ab-
handlungen u. Aufsätze, Leipzig 1915, I. Bd. S. 278 f.).
5) M. Scheler, a. a. O. S. 281.
HUBERT KLEES.
anschauung gewonnen werden könne. Aber jede weltanschauliche Deu-
tung setzt schon ein Erlebnis dessen voraus, was tragisch ist, also auch
eine Theorie des Tragischen. Wohl kann eine bestimmte Weltanschau-
ung vielleicht manche wichtigen Momente des Tragischen neu beleuchten
und so Zusammenhänge aufdecken, die bis dahin in dieser Schärfe nicht
gesehen worden sind. Am Wesen des Tragischen aber kann dadurch
nichts geändert werden.
Bedeutet der rein spekulative, apriorisch konstruierende Weg eine Ver-
gewaltigung der Tatsachen, so der psychologistische Weg eine Verken-
nung der Tatsachen, indem er den ästhetischen Gegenstand gänzlich ver-
fehlt. Der Psychologismus rechnet es sich zum Verdienst an, wieder auf
die Erfahrung als die Grundlage alles Philosophierens zurückgegangen
zu sein. Indem er aber unter Erfahrung nur Erfahrungstatsachen ver-
steht, die „ausschließlich seelischer Natur" sind, begrenzt er unrecht-
mäßigerweise den Erfahrungsbereich. So ist z. B. nach J. Volkelt
auch eine Theorie des Tragischen nur durch genaue Beschreibung und
Zergliederung der psychologischen Grundlage zu gewinnen"). Von der
psychologischen Grundlage als der Basis der Erfahrung ausgehend
glaubt er an Hand möglichst vieler Beispiele den Typen und Nuancen
des Tragischen erst gerecht werden und so zu einem möglichst umfassen-
den Begriff des Tragischen gelangen zu können. Es ist also der Weg
einer induktiven Verallgemeinerung, den V o 1 k e 11 hier beschreitet.
Im Gegensatz zu all diesen Auffassungen wollen wir das Tragische
als objektives Phänomen, soweit es uns erlebnismäßig an einzelnen Bei-
spielen seinem Gehalt nach aufgegangen ist, untersuchen. Hierbei
sind uns die Beispiele „nicht Tatsachen, an denen das Tragische wie eine
Eigenschaft klebt, sondern nur etwas, was die konstitutiven Erschei-
nungsbedingungen des Tragischen enthalten wird; was uns Anlaß gibt,
sie aufzufinden und in ihnen das Tragische selbst zu sehen""'). Auf
eine möglichst große Anzahl von Beispielen kommt es also bei einer sol-
chen Wesensanalyse nicht an. Eine Vielheit von Beispielen kann nur den
Grund haben, daß sich bestimmte Wesensmerkmale in den einen Beispie-
len deutlicher aufzeigen lassen als in andern.
Wenn wir ferner in der Hauptsache unsere Beispiele den tragischen
Dichtungen entnehmen, so bedeutet das keineswegs, daß nur hier echte
Tragik zu finden sei. Es heißt nur, daß die Dichtung in besonderem
4) Wir beschränken uns hier auf V o 1 k e 11 s Methode, weil seine „Ästhetik
des Tragischen" (4. Aufl. München 1924) ein typisches Beispiel für die psycholo-
gistische Methode ist. Vgl. auch M. Schelers Kritik der üblichen „psycholo-
gischen" Betrachtung des Tragischen („Zum Phänomen des Tragischen" in: Ab-
handlungen u. Aufsätze, Leipzig 1915, I. Bd. S. 278 f.).
5) M. Scheler, a. a. O. S. 281.