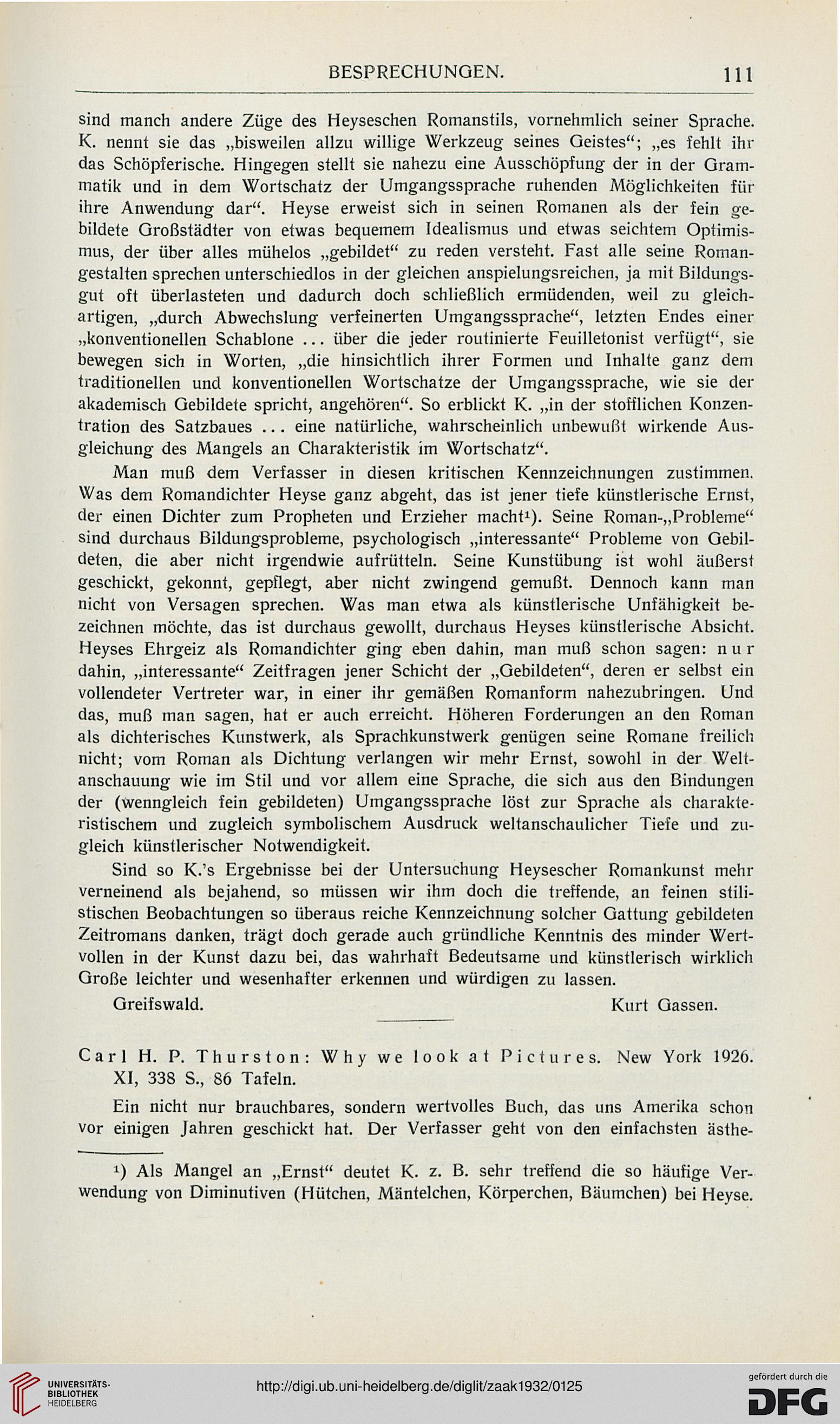BESPRECHUNGEN.
111
sind manch andere Züge des Heyseschen Romanstils, vornehmlich seiner Sprache.
K. nennt sie das „bisweilen allzu willige Werkzeug seines Geistes"; „es fehlt ihr
das Schöpferische. Hingegen stellt sie nahezu eine Ausschöpfung der in der Gram-
matik und in dem Wortschatz der Umgangssprache ruhenden Möglichkeiten für
ihre Anwendung dar". Heyse erweist sich in seinen Romanen als der fein ge-
bildete Großstädter von etwas bequemem Idealismus und etwas seichtem Optimis-
mus, der über alles mühelos „gebildet" zu reden versteht. Fast alle seine Roman-
gestalten sprechen unterschiedlos in der gleichen anspielungsreichen, ja mit Bildungs-
gut oft überlasteten und dadurch doch schließlich ermüdenden, weil zu gleich-
artigen, „durch Abwechslung verfeinerten Umgangssprache", letzten Endes einer
„konventionellen Schablone ... über die jeder routinierte Feuilletonist verfügt", sie
bewegen sich in Worten, „die hinsichtlich ihrer Formen und Inhalte ganz dem
traditionellen und konventionellen Wortschatze der Umgangssprache, wie sie der
akademisch Gebildete spricht, angehören". So erblickt K. „in der stofflichen Konzen-
tration des Satzbaues .. . eine natürliche, wahrscheinlich unbewußt wirkende Aus-
gleichung des Mangels an Charakteristik im Wortschatz".
Man muß dem Verfasser in diesen kritischen Kennzeichnungen zustimmen.
Was dem Romandichter Heyse ganz abgeht, das ist jener tiefe künstlerische Ernst,
der einen Dichter zum Propheten und Erzieher macht1). Seine Roman-„Probleme"
sind durchaus Bildungsprobleme, psychologisch „interessante" Probleme von Gebil-
deten, die aber nicht irgendwie aufrütteln. Seine Kunstübung ist wohl äußerst
geschickt, gekonnt, gepflegt, aber nicht zwingend gemußt. Dennoch kann man
nicht von Versagen sprechen. Was man etwa als künstlerische Unfähigkeit be-
zeichnen möchte, das ist durchaus gewollt, durchaus Heyses künstlerische Absicht.
Heyses Ehrgeiz als Romandichter ging eben dahin, man muß schon sagen: nur
dahin, „interessante" Zeitfragen jener Schicht der „Gebildeten", deren er selbst ein
vollendeter Vertreter war, in einer ihr gemäßen Romanform nahezubringen. Und
das, muß man sagen, hat er auch erreicht. Höheren Forderungen an den Roman
als dichterisches Kunstwerk, als Sprachkunstwerk genügen seine Romane freilich
nicht; vom Roman als Dichtung verlangen wir mehr Ernst, sowohl in der Welt-
anschauung wie im Stil und vor allem eine Sprache, die sich aus den Bindungen
der (wenngleich fein gebildeten) Umgangssprache löst zur Sprache als charakte-
ristischem und zugleich symbolischem Ausdruck weltanschaulicher Tiefe und zu-
gleich künstlerischer Notwendigkeit.
Sind so K.'s Ergebnisse bei der Untersuchung Heysescher Romankunst mehr
verneinend als bejahend, so müssen wir ihm doch die treffende, an feinen stili-
stischen Beobachtungen so überaus reiche Kennzeichnung solcher Gattung gebildeten
Zeitromans danken, trägt doch gerade auch gründliche Kenntnis des minder Wert-
vollen in der Kunst dazu bei, das wahrhaft Bedeutsame und künstlerisch wirklich
Große leichter und wesenhafter erkennen und würdigen zu lassen.
Greifswald. Kurt Gassen.
Carl H. P. Thurston: Why we look at Pictures. New York 1926.
XI, 338 S., 86 Tafeln.
Ein nicht nur brauchbares, sondern wertvolles Buch, das uns Amerika schon
vor einigen Jahren geschickt hat. Der Verfasser geht von den einfachsten ästhe-
!) Als Mangel an „Ernst" deutet K. z. B. sehr treffend die so häufige Ver-
wendung von Diminutiven (Hütchen, Mäntelchen, Körperchen, Bäumchen) bei Heyse.
111
sind manch andere Züge des Heyseschen Romanstils, vornehmlich seiner Sprache.
K. nennt sie das „bisweilen allzu willige Werkzeug seines Geistes"; „es fehlt ihr
das Schöpferische. Hingegen stellt sie nahezu eine Ausschöpfung der in der Gram-
matik und in dem Wortschatz der Umgangssprache ruhenden Möglichkeiten für
ihre Anwendung dar". Heyse erweist sich in seinen Romanen als der fein ge-
bildete Großstädter von etwas bequemem Idealismus und etwas seichtem Optimis-
mus, der über alles mühelos „gebildet" zu reden versteht. Fast alle seine Roman-
gestalten sprechen unterschiedlos in der gleichen anspielungsreichen, ja mit Bildungs-
gut oft überlasteten und dadurch doch schließlich ermüdenden, weil zu gleich-
artigen, „durch Abwechslung verfeinerten Umgangssprache", letzten Endes einer
„konventionellen Schablone ... über die jeder routinierte Feuilletonist verfügt", sie
bewegen sich in Worten, „die hinsichtlich ihrer Formen und Inhalte ganz dem
traditionellen und konventionellen Wortschatze der Umgangssprache, wie sie der
akademisch Gebildete spricht, angehören". So erblickt K. „in der stofflichen Konzen-
tration des Satzbaues .. . eine natürliche, wahrscheinlich unbewußt wirkende Aus-
gleichung des Mangels an Charakteristik im Wortschatz".
Man muß dem Verfasser in diesen kritischen Kennzeichnungen zustimmen.
Was dem Romandichter Heyse ganz abgeht, das ist jener tiefe künstlerische Ernst,
der einen Dichter zum Propheten und Erzieher macht1). Seine Roman-„Probleme"
sind durchaus Bildungsprobleme, psychologisch „interessante" Probleme von Gebil-
deten, die aber nicht irgendwie aufrütteln. Seine Kunstübung ist wohl äußerst
geschickt, gekonnt, gepflegt, aber nicht zwingend gemußt. Dennoch kann man
nicht von Versagen sprechen. Was man etwa als künstlerische Unfähigkeit be-
zeichnen möchte, das ist durchaus gewollt, durchaus Heyses künstlerische Absicht.
Heyses Ehrgeiz als Romandichter ging eben dahin, man muß schon sagen: nur
dahin, „interessante" Zeitfragen jener Schicht der „Gebildeten", deren er selbst ein
vollendeter Vertreter war, in einer ihr gemäßen Romanform nahezubringen. Und
das, muß man sagen, hat er auch erreicht. Höheren Forderungen an den Roman
als dichterisches Kunstwerk, als Sprachkunstwerk genügen seine Romane freilich
nicht; vom Roman als Dichtung verlangen wir mehr Ernst, sowohl in der Welt-
anschauung wie im Stil und vor allem eine Sprache, die sich aus den Bindungen
der (wenngleich fein gebildeten) Umgangssprache löst zur Sprache als charakte-
ristischem und zugleich symbolischem Ausdruck weltanschaulicher Tiefe und zu-
gleich künstlerischer Notwendigkeit.
Sind so K.'s Ergebnisse bei der Untersuchung Heysescher Romankunst mehr
verneinend als bejahend, so müssen wir ihm doch die treffende, an feinen stili-
stischen Beobachtungen so überaus reiche Kennzeichnung solcher Gattung gebildeten
Zeitromans danken, trägt doch gerade auch gründliche Kenntnis des minder Wert-
vollen in der Kunst dazu bei, das wahrhaft Bedeutsame und künstlerisch wirklich
Große leichter und wesenhafter erkennen und würdigen zu lassen.
Greifswald. Kurt Gassen.
Carl H. P. Thurston: Why we look at Pictures. New York 1926.
XI, 338 S., 86 Tafeln.
Ein nicht nur brauchbares, sondern wertvolles Buch, das uns Amerika schon
vor einigen Jahren geschickt hat. Der Verfasser geht von den einfachsten ästhe-
!) Als Mangel an „Ernst" deutet K. z. B. sehr treffend die so häufige Ver-
wendung von Diminutiven (Hütchen, Mäntelchen, Körperchen, Bäumchen) bei Heyse.