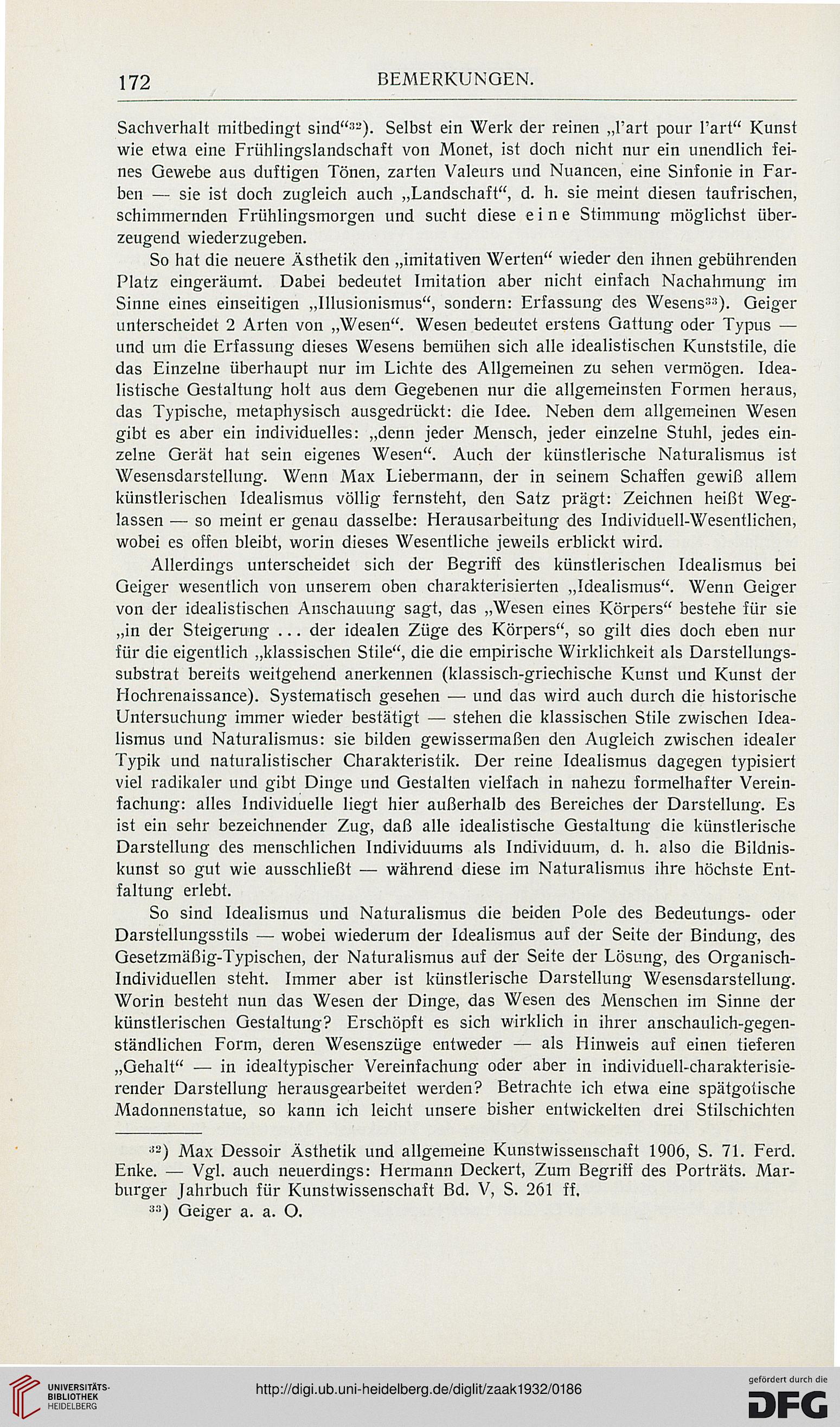172
BEMERKUNGEN.
Sachverhalt mitbedingt sind"32). Selbst ein Werk der reinen ,,1'art pour Part" Kunst
wie etwa eine Frühlingslandschaft von Monet, ist doch nicht nur ein unendlich fei-
nes Gewebe aus duftigen Tönen, zarten Valeurs und Nuancen, eine Sinfonie in Far-
ben — sie ist doch zugleich auch „Landschaft", d. h. sie meint diesen taufrischen,
schimmernden Frühlingsmorgen und sucht diese eine Stimmung möglichst über-
zeugend wiederzugeben.
So hat die neuere Ästhetik den „imitativen Werten" wieder den ihnen gebührenden
Platz eingeräumt. Dabei bedeutet Imitation aber nicht einfach Nachahmung im
Sinne eines einseitigen „Illusionismus", sondern: Erfassung des Wesens-™). Geiger
unterscheidet 2 Arten von „Wesen". Wesen bedeutet erstens Gattung oder Typus —
und um die Erfassung dieses Wesens bemühen sich alle idealistischen Kunststile, die
das Einzelne überhaupt nur im Lichte des Allgemeinen zu sehen vermögen. Idea-
listische Gestaltung holt aus dem Gegebenen nur die allgemeinsten Formen heraus,
das Typische, metaphysisch ausgedrückt: die Idee. Neben dem allgemeinen Wesen
gibt es aber ein individuelles: „denn jeder Mensch, jeder einzelne Stuhl, jedes ein-
zelne Gerät hat sein eigenes Wesen". Auch der künstlerische Naturalismus ist
Wesensdarstellung. Wenn Max Liebermann, der in seinem Scharfen gewiß allem
künstlerischen Idealismus völlig fernsteht, den Satz prägt: Zeichnen heißt Weg-
lassen — so meint er genau dasselbe: Herausarbeitung des Individuell-Wesentlichen,
wobei es offen bleibt, worin dieses Wesentliche jeweils erblickt wird.
Allerdings unterscheidet sich der Begriff des künstlerischen Idealismus bei
Geiger wesentlich von unserem oben charakterisierten „Idealismus". Wenn Geiger
von der idealistischen Anschauung sagt, das „Wesen eines Körpers" bestehe für sie
„in der Steigerung ... der idealen Züge des Körpers", so gilt dies doch eben nur
für die eigentlich „klassischen Stile", die die empirische Wirklichkeit als Darstellungs-
substrat bereits weitgehend anerkennen (klassisch-griechische Kunst und Kunst der
Hochrenaissance). Systematisch gesehen — und das wird auch durch die historische
Untersuchung immer wieder bestätigt — stehen die klassischen Stile zwischen Idea-
lismus und Naturalismus: sie bilden gewissermaßen den Augleich zwischen idealer
Typik und naturalistischer Charakteristik. Der reine Idealismus dagegen typisiert
viel radikaler und gibt Dinge und Gestalten vielfach in nahezu formelhafter Verein-
fachung: alles Individuelle liegt hier außerhalb des Bereiches der Darstellung. Es
ist ein sehr bezeichnender Zug, daß alle idealistische Gestaltung die künstlerische
Darstellung des menschlichen Individuums als Individuum, d. h. also die Bildnis-
kunst so gut wie ausschließt — während diese im Naturalismus ihre höchste Ent-
faltung erlebt.
So sind Idealismus und Naturalismus die beiden Pole des Bedeutungs- oder
Darstellungsstils — wobei wiederum der Idealismus auf der Seite der Bindung, des
Gesetzmäßig-Typischen, der Naturalismus auf der Seite der Lösung, des Organisch-
Individuellen steht. Immer aber ist künstlerische Darstellung Wesensdarstellung.
Worin besteht nun das Wesen der Dinge, das Wesen des Menschen im Sinne der
künstlerischen Gestaltung? Erschöpft es sich wirklich in ihrer anschaulich-gegen-
ständlichen Form, deren Wesenszüge entweder — als Hinweis auf einen tieferen
„Gehalt" — in idealtypischer Vereinfachung oder aber in individuell-charakterisie-
render Darstellung herausgearbeitet werden? Betrachte ich etwa eine spätgotische
Madonnenstatue, so kann ich leicht unsere bisher entwickelten drei Stilschichten
•'-') Max Dessoir Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft 1906, S. 71. Ferd.
Enke. — Vgl. auch neuerdings: Hermann Deckert, Zum Begriff des Porträts. Mar-
burger Jahrbuch für Kunstwissenschaft Bd. V, S. 261 ff.
S3) Geiger a. a. O.
BEMERKUNGEN.
Sachverhalt mitbedingt sind"32). Selbst ein Werk der reinen ,,1'art pour Part" Kunst
wie etwa eine Frühlingslandschaft von Monet, ist doch nicht nur ein unendlich fei-
nes Gewebe aus duftigen Tönen, zarten Valeurs und Nuancen, eine Sinfonie in Far-
ben — sie ist doch zugleich auch „Landschaft", d. h. sie meint diesen taufrischen,
schimmernden Frühlingsmorgen und sucht diese eine Stimmung möglichst über-
zeugend wiederzugeben.
So hat die neuere Ästhetik den „imitativen Werten" wieder den ihnen gebührenden
Platz eingeräumt. Dabei bedeutet Imitation aber nicht einfach Nachahmung im
Sinne eines einseitigen „Illusionismus", sondern: Erfassung des Wesens-™). Geiger
unterscheidet 2 Arten von „Wesen". Wesen bedeutet erstens Gattung oder Typus —
und um die Erfassung dieses Wesens bemühen sich alle idealistischen Kunststile, die
das Einzelne überhaupt nur im Lichte des Allgemeinen zu sehen vermögen. Idea-
listische Gestaltung holt aus dem Gegebenen nur die allgemeinsten Formen heraus,
das Typische, metaphysisch ausgedrückt: die Idee. Neben dem allgemeinen Wesen
gibt es aber ein individuelles: „denn jeder Mensch, jeder einzelne Stuhl, jedes ein-
zelne Gerät hat sein eigenes Wesen". Auch der künstlerische Naturalismus ist
Wesensdarstellung. Wenn Max Liebermann, der in seinem Scharfen gewiß allem
künstlerischen Idealismus völlig fernsteht, den Satz prägt: Zeichnen heißt Weg-
lassen — so meint er genau dasselbe: Herausarbeitung des Individuell-Wesentlichen,
wobei es offen bleibt, worin dieses Wesentliche jeweils erblickt wird.
Allerdings unterscheidet sich der Begriff des künstlerischen Idealismus bei
Geiger wesentlich von unserem oben charakterisierten „Idealismus". Wenn Geiger
von der idealistischen Anschauung sagt, das „Wesen eines Körpers" bestehe für sie
„in der Steigerung ... der idealen Züge des Körpers", so gilt dies doch eben nur
für die eigentlich „klassischen Stile", die die empirische Wirklichkeit als Darstellungs-
substrat bereits weitgehend anerkennen (klassisch-griechische Kunst und Kunst der
Hochrenaissance). Systematisch gesehen — und das wird auch durch die historische
Untersuchung immer wieder bestätigt — stehen die klassischen Stile zwischen Idea-
lismus und Naturalismus: sie bilden gewissermaßen den Augleich zwischen idealer
Typik und naturalistischer Charakteristik. Der reine Idealismus dagegen typisiert
viel radikaler und gibt Dinge und Gestalten vielfach in nahezu formelhafter Verein-
fachung: alles Individuelle liegt hier außerhalb des Bereiches der Darstellung. Es
ist ein sehr bezeichnender Zug, daß alle idealistische Gestaltung die künstlerische
Darstellung des menschlichen Individuums als Individuum, d. h. also die Bildnis-
kunst so gut wie ausschließt — während diese im Naturalismus ihre höchste Ent-
faltung erlebt.
So sind Idealismus und Naturalismus die beiden Pole des Bedeutungs- oder
Darstellungsstils — wobei wiederum der Idealismus auf der Seite der Bindung, des
Gesetzmäßig-Typischen, der Naturalismus auf der Seite der Lösung, des Organisch-
Individuellen steht. Immer aber ist künstlerische Darstellung Wesensdarstellung.
Worin besteht nun das Wesen der Dinge, das Wesen des Menschen im Sinne der
künstlerischen Gestaltung? Erschöpft es sich wirklich in ihrer anschaulich-gegen-
ständlichen Form, deren Wesenszüge entweder — als Hinweis auf einen tieferen
„Gehalt" — in idealtypischer Vereinfachung oder aber in individuell-charakterisie-
render Darstellung herausgearbeitet werden? Betrachte ich etwa eine spätgotische
Madonnenstatue, so kann ich leicht unsere bisher entwickelten drei Stilschichten
•'-') Max Dessoir Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft 1906, S. 71. Ferd.
Enke. — Vgl. auch neuerdings: Hermann Deckert, Zum Begriff des Porträts. Mar-
burger Jahrbuch für Kunstwissenschaft Bd. V, S. 261 ff.
S3) Geiger a. a. O.