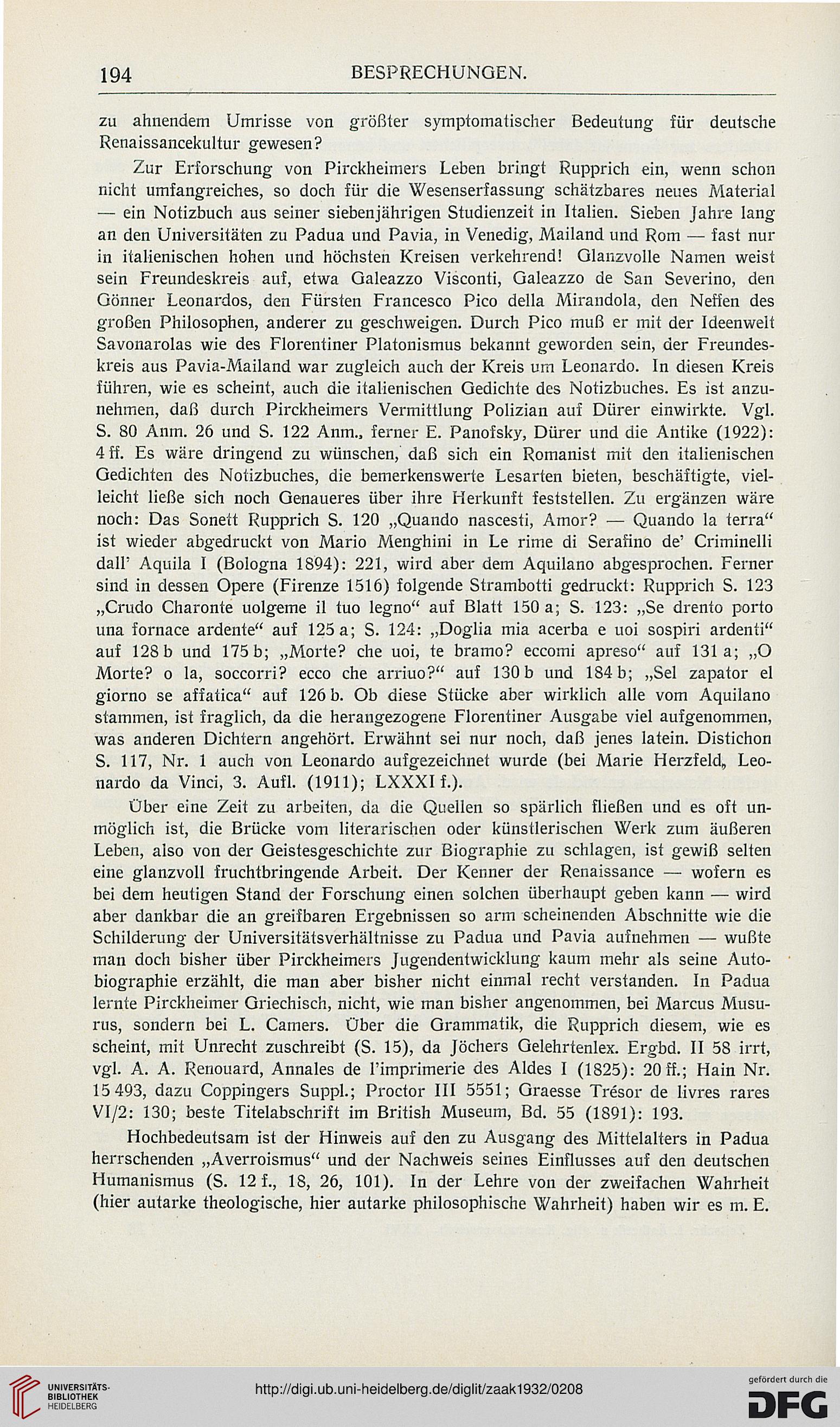194
BESPRECHUNGEN.
zu ahnendem Umrisse von größter symptomatischer Bedeutung für deutsche
Renaissancekultur gewesen?
Zur Erforschung von Pirckheimers Leben bringt Rupprich ein, wenn schon
nicht umfangreiches, so doch für die Wesenserfassung schätzbares neues Material
— ein Notizbuch aus seiner siebenjährigen Studienzeit in Italien. Sieben Jahre lang
an den Universitäten zu Padua und Pavia, in Venedig, Mailand und Rom — fast nur
in italienischen hohen und höchsten Kreisen verkehrend! Glanzvolle Namen weist
sein Freundeskreis auf, etwa Galeazzo Visconti, Galeazzo de San Severino, den
Gönner Leonardos, den Fürsten Francesco Pico della Mirandola, den Neffen des
großen Philosophen, anderer zu geschweigen. Durch Pico muß er mit der Ideenwelt
Savonarolas wie des Florentiner Platonismus bekannt geworden sein, der Freundes-
kreis aus Pavia-Mailand war zugleich auch der Kreis um Leonardo. In diesen Kreis
führen, wie es scheint, auch die italienischen Gedichte des Notizbuches. Es ist anzu-
nehmen, daß durch Pirckheimers Vermittlung Polizian auf Dürer einwirkte. Vgl.
S. 80 Anm. 26 und S. 122 Anm.. ferner E. Panofsky, Dürer und die Antike (1922):
4 ff. Es wäre dringend zu wünschen, daß sich ein Romanist mit den italienischen
Gedichten des Notizbuches, die bemerkenswerte Lesarten bieten, beschäftigte, viel-
leicht ließe sich noch Genaueres über ihre Herkunft feststellen. Zu ergänzen wäre
noch: Das Sonett Rupprich S. 120 „Quando nascesti, Amor? — Quando la terra"
ist wieder abgedruckt von Mario Menghini in Le rime di Serafino de' Criminelli
dair Aquila I (Bologna 1894): 221, wird aber dem Aquilano abgesprochen. Ferner
sind in dessen Opere (Firenze 1516) folgende Strambotti gedruckt: Rupprich S. 123
„Crudo Charonte uolgeme il tuo legno" auf Blatt 150 a; S. 123: „Se drento porto
una fornace ardente" auf 125 a; S. 124: „Doglia mia acerba e uoi sospiri ardenti"
auf 128 b und 175 b; „Morte? che uoi, te bramo? eccomi apreso" auf 131a; „O
Morte? o la, soccorri? ecco che arriuo?" auf 130 b und 184 b; „Sei zapator el
giorno se affatica" auf 126 b. Ob diese Stücke aber wirklich alle vom Aquilano
stammen, ist fraglich, da die herangezogene Florentiner Ausgabe viel aufgenommen,
was anderen Dichtern angehört. Erwähnt sei nur noch, daß jenes latein. Distichon
S. 117, Nr. 1 auch von Leonardo aufgezeichnet wurde (bei Marie Herzfeld, Leo-
nardo da Vinci, 3. Aufl. (1911); LXXXI f.).
Über eine Zeit zu arbeiten, da die Quellen so spärlich fließen und es oft un-
möglich ist, die Brücke vom literarischen oder künstlerischen Werk zum äußeren
Leben, also von der Geistesgeschichte zur Biographie zu schlagen, ist gewiß selten
eine glanzvoll fruchtbringende Arbeit. Der Kenner der Renaissance — wofern es
bei dem heutigen Stand der Forschung einen solchen überhaupt geben kann — wird
aber dankbar die an greifbaren Ergebnissen so arm scheinenden Abschnitte wie die
Schilderung der Universitätsverhältnisse zu Padua und Pavia aufnehmen — wußte
man doch bisher über Pirckheimers Jugendentwicklung kaum mehr als seine Auto-
biographie erzählt, die man aber bisher nicht einmal recht verstanden. In Padua
lernte Pirckheimer Griechisch, nicht, wie man bisher angenommen, bei Marcus Musu-
rus, sondern bei L. Camers. Über die Grammatik, die Rupprich diesem, wie es
scheint, mit Unrecht zuschreibt (S. 15), da Jöchers Gelehrtenlex. Ergbd. II 58 irrt,
vgl. A. A. Renouard, Annales de rimprimerie des Aldes I (1825): 20 ff.; Hain Nr.
15 493, dazu Coppingers Suppl.; Proctor III 5551; Graesse Tresor de livres rares
VI/2: 130; beste Titelabschrift im British Museum, Bd. 55 (1891): 193.
Hochbedeutsam ist der Hinweis auf den zu Ausgang des Mittelalters in Padua
herrschenden „Averroismus" und der Nachweis seines Einflusses auf den deutschen
Humanismus (S. 12 f., 18, 26, 101). In der Lehre von der zweifachen Wahrheit
(hier autarke theologische, hier autarke philosophische Wahrheit) haben wir es m. E.
BESPRECHUNGEN.
zu ahnendem Umrisse von größter symptomatischer Bedeutung für deutsche
Renaissancekultur gewesen?
Zur Erforschung von Pirckheimers Leben bringt Rupprich ein, wenn schon
nicht umfangreiches, so doch für die Wesenserfassung schätzbares neues Material
— ein Notizbuch aus seiner siebenjährigen Studienzeit in Italien. Sieben Jahre lang
an den Universitäten zu Padua und Pavia, in Venedig, Mailand und Rom — fast nur
in italienischen hohen und höchsten Kreisen verkehrend! Glanzvolle Namen weist
sein Freundeskreis auf, etwa Galeazzo Visconti, Galeazzo de San Severino, den
Gönner Leonardos, den Fürsten Francesco Pico della Mirandola, den Neffen des
großen Philosophen, anderer zu geschweigen. Durch Pico muß er mit der Ideenwelt
Savonarolas wie des Florentiner Platonismus bekannt geworden sein, der Freundes-
kreis aus Pavia-Mailand war zugleich auch der Kreis um Leonardo. In diesen Kreis
führen, wie es scheint, auch die italienischen Gedichte des Notizbuches. Es ist anzu-
nehmen, daß durch Pirckheimers Vermittlung Polizian auf Dürer einwirkte. Vgl.
S. 80 Anm. 26 und S. 122 Anm.. ferner E. Panofsky, Dürer und die Antike (1922):
4 ff. Es wäre dringend zu wünschen, daß sich ein Romanist mit den italienischen
Gedichten des Notizbuches, die bemerkenswerte Lesarten bieten, beschäftigte, viel-
leicht ließe sich noch Genaueres über ihre Herkunft feststellen. Zu ergänzen wäre
noch: Das Sonett Rupprich S. 120 „Quando nascesti, Amor? — Quando la terra"
ist wieder abgedruckt von Mario Menghini in Le rime di Serafino de' Criminelli
dair Aquila I (Bologna 1894): 221, wird aber dem Aquilano abgesprochen. Ferner
sind in dessen Opere (Firenze 1516) folgende Strambotti gedruckt: Rupprich S. 123
„Crudo Charonte uolgeme il tuo legno" auf Blatt 150 a; S. 123: „Se drento porto
una fornace ardente" auf 125 a; S. 124: „Doglia mia acerba e uoi sospiri ardenti"
auf 128 b und 175 b; „Morte? che uoi, te bramo? eccomi apreso" auf 131a; „O
Morte? o la, soccorri? ecco che arriuo?" auf 130 b und 184 b; „Sei zapator el
giorno se affatica" auf 126 b. Ob diese Stücke aber wirklich alle vom Aquilano
stammen, ist fraglich, da die herangezogene Florentiner Ausgabe viel aufgenommen,
was anderen Dichtern angehört. Erwähnt sei nur noch, daß jenes latein. Distichon
S. 117, Nr. 1 auch von Leonardo aufgezeichnet wurde (bei Marie Herzfeld, Leo-
nardo da Vinci, 3. Aufl. (1911); LXXXI f.).
Über eine Zeit zu arbeiten, da die Quellen so spärlich fließen und es oft un-
möglich ist, die Brücke vom literarischen oder künstlerischen Werk zum äußeren
Leben, also von der Geistesgeschichte zur Biographie zu schlagen, ist gewiß selten
eine glanzvoll fruchtbringende Arbeit. Der Kenner der Renaissance — wofern es
bei dem heutigen Stand der Forschung einen solchen überhaupt geben kann — wird
aber dankbar die an greifbaren Ergebnissen so arm scheinenden Abschnitte wie die
Schilderung der Universitätsverhältnisse zu Padua und Pavia aufnehmen — wußte
man doch bisher über Pirckheimers Jugendentwicklung kaum mehr als seine Auto-
biographie erzählt, die man aber bisher nicht einmal recht verstanden. In Padua
lernte Pirckheimer Griechisch, nicht, wie man bisher angenommen, bei Marcus Musu-
rus, sondern bei L. Camers. Über die Grammatik, die Rupprich diesem, wie es
scheint, mit Unrecht zuschreibt (S. 15), da Jöchers Gelehrtenlex. Ergbd. II 58 irrt,
vgl. A. A. Renouard, Annales de rimprimerie des Aldes I (1825): 20 ff.; Hain Nr.
15 493, dazu Coppingers Suppl.; Proctor III 5551; Graesse Tresor de livres rares
VI/2: 130; beste Titelabschrift im British Museum, Bd. 55 (1891): 193.
Hochbedeutsam ist der Hinweis auf den zu Ausgang des Mittelalters in Padua
herrschenden „Averroismus" und der Nachweis seines Einflusses auf den deutschen
Humanismus (S. 12 f., 18, 26, 101). In der Lehre von der zweifachen Wahrheit
(hier autarke theologische, hier autarke philosophische Wahrheit) haben wir es m. E.