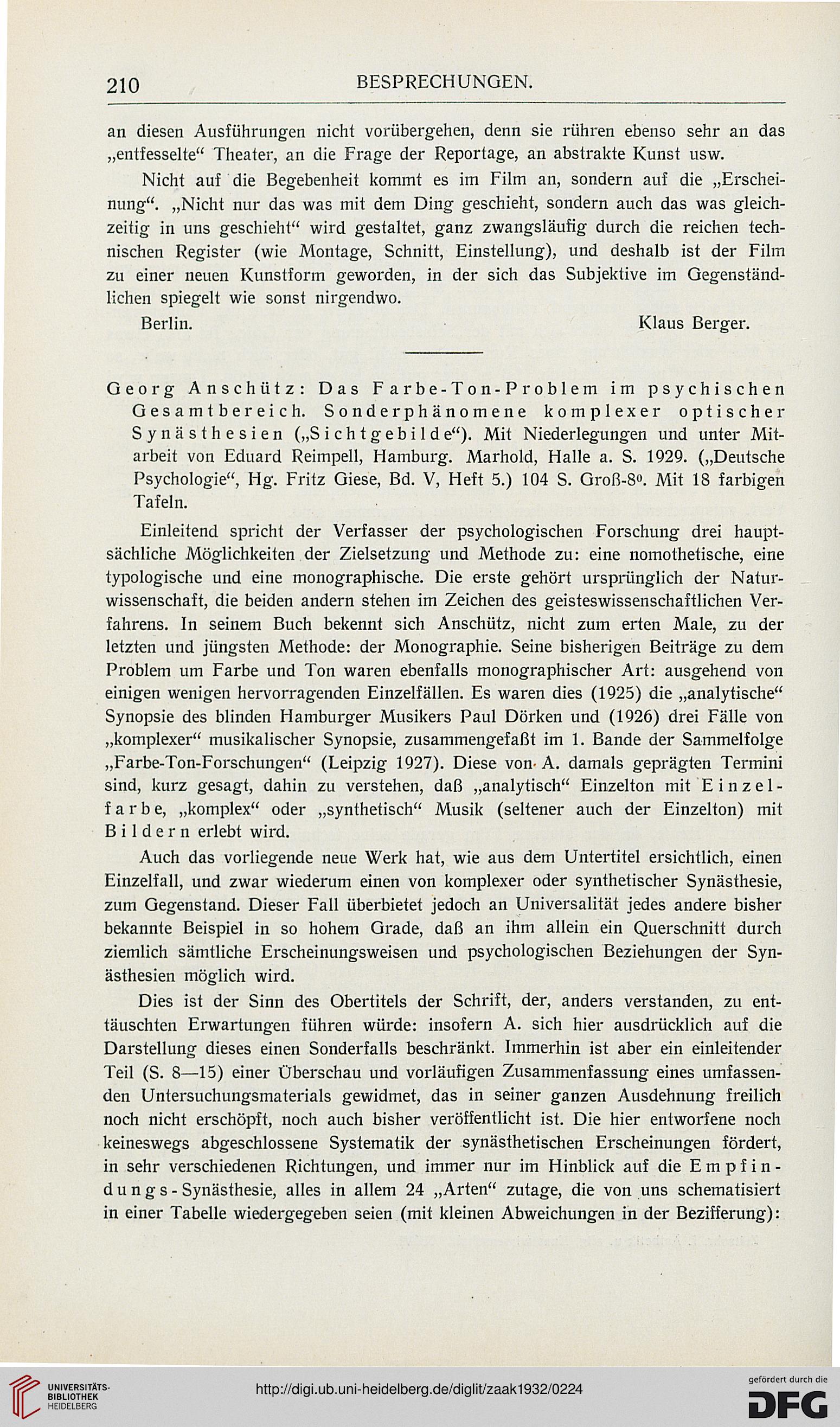210
BESPRECHUNGEN.
an diesen Ausführungen nicht vorübergehen, denn sie rühren ebenso sehr an das
„entfesselte" Theater, an die Frage der Reportage, an abstrakte Kunst usw.
Nicht auf die Begebenheit kommt es im Film an, sondern auf die „Erschei-
nung". „Nicht nur das was mit dem Ding geschieht, sondern auch das was gleich-
zeitig in uns geschieht" wird gestaltet, ganz zwangsläufig durch die reichen tech-
nischen Register (wie Montage, Schnitt, Einstellung), und deshalb ist der Film
zu einer neuen Kunstform geworden, in der sich das Subjektive im Gegenständ-
lichen spiegelt wie sonst nirgendwo.
Berlin. Klaus Berger.
Georg Anschütz: Das Farbe-Ton-Problem im psychischen
Gesamtbereich. Sonderphänomene komplexer optischer
Synästhesien („S i c h t g e b i 1 d e"). Mit Niederlegungen und unter Mit-
arbeit von Eduard Reimpell, Hamburg. Marhold, Halle a. S. 1929. („Deutsche
Psychologie", Hg. Fritz Giese, Bd. V, Heft 5.) 104 S. Groß-8». Mit 18 farbigen
Tafeln.
Einleitend spricht der Verfasser der psychologischen Forschung drei haupt-
sächliche Möglichkeiten der Zielsetzung und Methode zu: eine nomothetische, eine
typologische und eine monographische. Die erste gehört ursprünglich der Natur-
wissenschaft, die beiden andern stehen im Zeichen des geisteswissenschaftlichen Ver-
fahrens. In seinem Buch bekennt sich Anschütz, nicht zum erten Male, zu der
letzten und jüngsten Methode: der Monographie. Seine bisherigen Beiträge zu dem
Problem um Farbe und Ton waren ebenfalls monographischer Art: ausgehend von
einigen wenigen hervorragenden Einzelfällen. Es waren dies (1925) die „analytische"
Synopsie des blinden Hamburger Musikers Paul Dörken und (1926) drei Fälle von
„komplexer" musikalischer Synopsie, zusammengefaßt im 1. Bande der Sammelfolge
„Farbe-Ton-Forschungen" (Leipzig 1927). Diese von-A. damals geprägten Termini
sind, kurz gesagt, dahin zu verstehen, daß „analytisch" Einzelton mit Einzel-
farbe, „komplex" oder „synthetisch" Musik (seltener auch der Einzelton) mit
Bildern erlebt wird.
Auch das vorliegende neue Werk hat, wie aus dem Untertitel ersichtlich, einen
Einzelfall, und zwar wiederum einen von komplexer oder synthetischer Synästhesie,
zum Gegenstand. Dieser Fall überbietet jedoch an Universalität jedes andere bisher
bekannte Beispiel in so hohem Grade, daß an ihm allein ein Querschnitt durch
ziemlich sämtliche Erscheinungsweisen und psychologischen Beziehungen der Syn-
ästhesien möglich wird.
Dies ist der Sinn des Obertitels der Schrift, der, anders verstanden, zu ent-
täuschten Erwartungen führen würde: insofern A. sich hier ausdrücklich auf die
Darstellung dieses einen Sonderfalls beschränkt. Immerhin ist aber ein einleitender
Teil (S. 8—15) einer Überschau und vorläufigen Zusammenfassung eines umfassen-
den Untersuchungsmaterials gewidmet, das in seiner ganzen Ausdehnung freilich
noch nicht erschöpft, noch auch bisher veröffentlicht ist. Die hier entworfene noch
keineswegs abgeschlossene Systematik der synästhetischen Erscheinungen fördert,
in sehr verschiedenen Richtungen, und immer nur im Hinblick auf die E m p f i n -
dungs - Synästhesie, alles in allem 24 „Arten" zutage, die von uns schematisiert
in einer Tabelle wiedergegeben seien (mit kleinen Abweichungen in der Bezifferung):
BESPRECHUNGEN.
an diesen Ausführungen nicht vorübergehen, denn sie rühren ebenso sehr an das
„entfesselte" Theater, an die Frage der Reportage, an abstrakte Kunst usw.
Nicht auf die Begebenheit kommt es im Film an, sondern auf die „Erschei-
nung". „Nicht nur das was mit dem Ding geschieht, sondern auch das was gleich-
zeitig in uns geschieht" wird gestaltet, ganz zwangsläufig durch die reichen tech-
nischen Register (wie Montage, Schnitt, Einstellung), und deshalb ist der Film
zu einer neuen Kunstform geworden, in der sich das Subjektive im Gegenständ-
lichen spiegelt wie sonst nirgendwo.
Berlin. Klaus Berger.
Georg Anschütz: Das Farbe-Ton-Problem im psychischen
Gesamtbereich. Sonderphänomene komplexer optischer
Synästhesien („S i c h t g e b i 1 d e"). Mit Niederlegungen und unter Mit-
arbeit von Eduard Reimpell, Hamburg. Marhold, Halle a. S. 1929. („Deutsche
Psychologie", Hg. Fritz Giese, Bd. V, Heft 5.) 104 S. Groß-8». Mit 18 farbigen
Tafeln.
Einleitend spricht der Verfasser der psychologischen Forschung drei haupt-
sächliche Möglichkeiten der Zielsetzung und Methode zu: eine nomothetische, eine
typologische und eine monographische. Die erste gehört ursprünglich der Natur-
wissenschaft, die beiden andern stehen im Zeichen des geisteswissenschaftlichen Ver-
fahrens. In seinem Buch bekennt sich Anschütz, nicht zum erten Male, zu der
letzten und jüngsten Methode: der Monographie. Seine bisherigen Beiträge zu dem
Problem um Farbe und Ton waren ebenfalls monographischer Art: ausgehend von
einigen wenigen hervorragenden Einzelfällen. Es waren dies (1925) die „analytische"
Synopsie des blinden Hamburger Musikers Paul Dörken und (1926) drei Fälle von
„komplexer" musikalischer Synopsie, zusammengefaßt im 1. Bande der Sammelfolge
„Farbe-Ton-Forschungen" (Leipzig 1927). Diese von-A. damals geprägten Termini
sind, kurz gesagt, dahin zu verstehen, daß „analytisch" Einzelton mit Einzel-
farbe, „komplex" oder „synthetisch" Musik (seltener auch der Einzelton) mit
Bildern erlebt wird.
Auch das vorliegende neue Werk hat, wie aus dem Untertitel ersichtlich, einen
Einzelfall, und zwar wiederum einen von komplexer oder synthetischer Synästhesie,
zum Gegenstand. Dieser Fall überbietet jedoch an Universalität jedes andere bisher
bekannte Beispiel in so hohem Grade, daß an ihm allein ein Querschnitt durch
ziemlich sämtliche Erscheinungsweisen und psychologischen Beziehungen der Syn-
ästhesien möglich wird.
Dies ist der Sinn des Obertitels der Schrift, der, anders verstanden, zu ent-
täuschten Erwartungen führen würde: insofern A. sich hier ausdrücklich auf die
Darstellung dieses einen Sonderfalls beschränkt. Immerhin ist aber ein einleitender
Teil (S. 8—15) einer Überschau und vorläufigen Zusammenfassung eines umfassen-
den Untersuchungsmaterials gewidmet, das in seiner ganzen Ausdehnung freilich
noch nicht erschöpft, noch auch bisher veröffentlicht ist. Die hier entworfene noch
keineswegs abgeschlossene Systematik der synästhetischen Erscheinungen fördert,
in sehr verschiedenen Richtungen, und immer nur im Hinblick auf die E m p f i n -
dungs - Synästhesie, alles in allem 24 „Arten" zutage, die von uns schematisiert
in einer Tabelle wiedergegeben seien (mit kleinen Abweichungen in der Bezifferung):