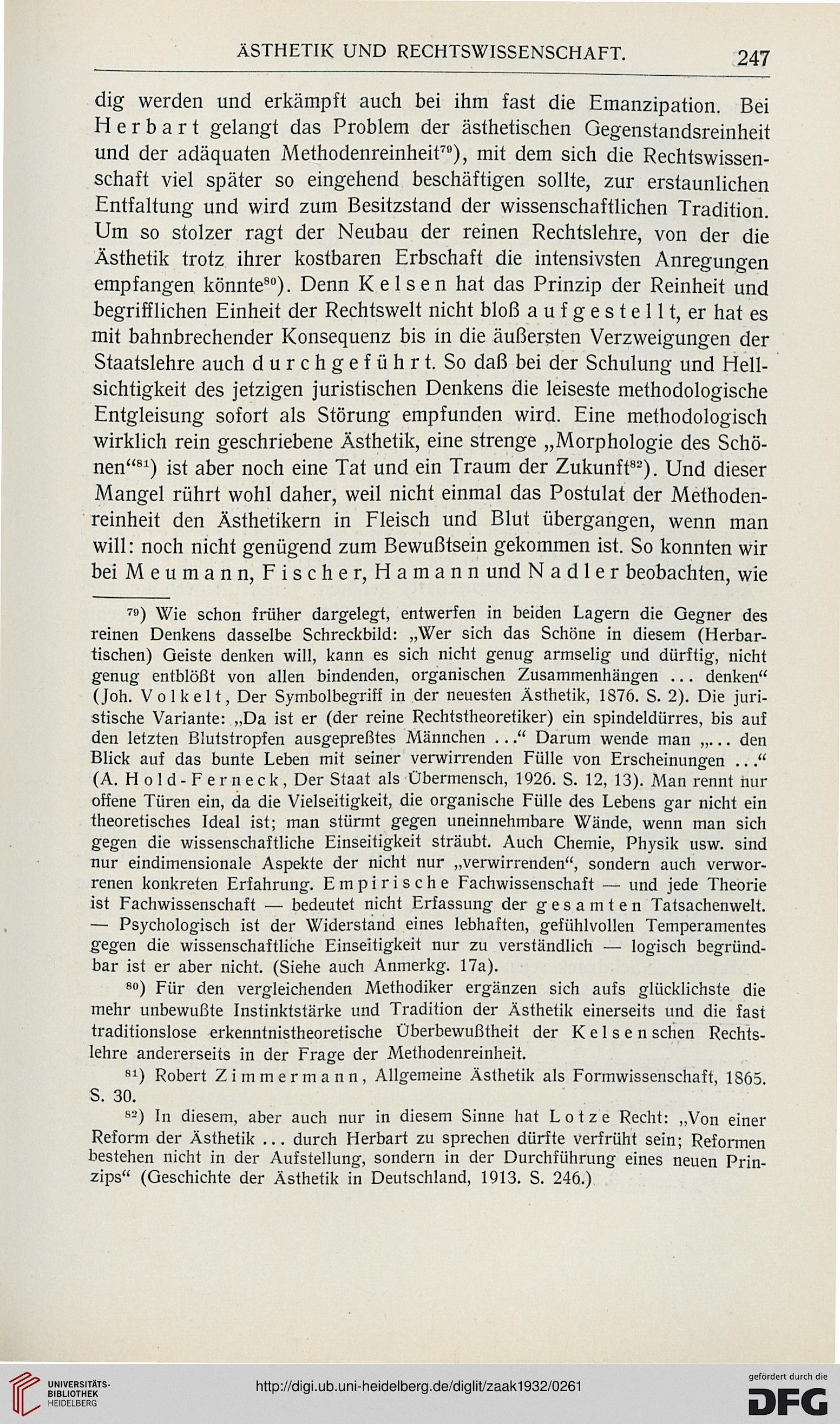ÄSTHETIK UND RECHTSWISSENSCHAFT.
247
dig werden und erkämpft auch bei ihm fast die Emanzipation. Bei
H e r b a r t gelangt das Problem der ästhetischen Gegenstandsreinheit
und der adäquaten Methodenreinheit70), mit dem sich die Rechtswissen-
schaft viel später so eingehend beschäftigen sollte, zur erstaunlichen
Entfaltung und wird zum Besitzstand der wissenschaftlichen Tradition.
Um so stolzer ragt der Neubau der reinen Rechtslehre, von der die
Ästhetik trotz ihrer kostbaren Erbschaft die intensivsten Anregungen
empfangen könnte80). Denn Kelsen hat das Prinzip der Reinheit und
begrifflichen Einheit der Rechtswelt nicht bloß a u f g e s t e 111, er hat es
mit bahnbrechender Konsequenz bis in die äußersten Verzweigungen der
Staatslehre auch durchgeführt. So daß bei der Schulung und Hell-
sichtigkeit des jetzigen juristischen Denkens die leiseste methodologische
Entgleisung sofort als Störung empfunden wird. Eine methodologisch
wirklich rein geschriebene Ästhetik, eine strenge „Morphologie des Schö-
nen"81) ist aber noch eine Tat und ein Traum der Zukunft82). Und dieser
Mangel rührt wohl daher, weil nicht einmal das Postulat der Methoden-
reinheit den Ästhetikern in Fleisch und Blut übergangen, wenn man
will: noch nicht genügend zum Bewußtsein gekommen ist. So konnten wir
bei Meumann, Fischer, Hamann und N a d 1 e r beobachten, wie
™) Wie schon früher dargelegt, entwerfen in beiden Lagern die Gegner des
reinen Denkens dasselbe Schreckbild: „Wer sich das Schöne in diesem (Herbar-
tischen) Geiste denken will, kann es sich nicht genug armselig und dürftig, nicht
genug entblößt von allen bindenden, organischen Zusammenhängen ... denken"
(Joh. Volkelt, Der Symbolbegriff in der neuesten Ästhetik, 1876. S. 2). Die juri-
stische Variante: „Da ist er (der reine Rechtstheoretiker) ein spindeldürres, bis auf
den letzten Blutstropfen ausgepreßtes Männchen ..." Darum wende man „... den
Blick auf das bunte Leben mit seiner verwirrenden Fülle von Erscheinungen ..."
(A. H o 1 d - F e r n e c k , Der Staat als Übermensch, 1926. S. 12, 13). Man rennt nur
offene Türen ein, da die Vielseitigkeit, die organische Fülle des Lebens gar nicht ein
theoretisches Ideal ist; man stürmt gegen uneinnehmbare Wände, wenn man sich
gegen die wissenschaftliche Einseitigkeit sträubt. Auch Chemie, Physik usw. sind
nur eindimensionale Aspekte der nicht nur „verwirrenden", sondern auch verwor-
renen konkreten Erfahrung. Empirische Fachwissenschaft — und jede Theorie
ist Fachwissenschaft — bedeutet nicht Erfassung der gesamten Tatsachenwelt.
— Psychologisch ist der Widerstand eines lebhaften, gefühlvollen Temperamentes
gegen die wissenschaftliche Einseitigkeit nur zu verständlich — logisch begründ-
bar ist er aber nicht. (Siehe auch Anmerkg. 17a).
80) Für den vergleichenden Methodiker ergänzen sich aufs glücklichste die
mehr unbewußte Instinktstärke und Tradition der Ästhetik einerseits und die fast
traditionslose erkenntnistheoretische Überbewußtheit der Kelsen sehen Rechts-
lehre andererseits in der Frage der Methodenreinheit.
R1) Robert Zimmermann, Allgemeine Ästhetik als Formwissenschaft, 1S65.
S. 30.
82) In diesem, aber auch nur in diesem Sinne hat Lotze Recht: „Von einer
Reform der Ästhetik ... durch Herbart zu sprechen dürfte verfrüht sein; Reformen
bestehen nicht in der Aufstellung, sondern in der Durchführung eines neuen Prin-
zips" (Geschichte der Ästhetik in Deutschland, 1913. S. 246.)
247
dig werden und erkämpft auch bei ihm fast die Emanzipation. Bei
H e r b a r t gelangt das Problem der ästhetischen Gegenstandsreinheit
und der adäquaten Methodenreinheit70), mit dem sich die Rechtswissen-
schaft viel später so eingehend beschäftigen sollte, zur erstaunlichen
Entfaltung und wird zum Besitzstand der wissenschaftlichen Tradition.
Um so stolzer ragt der Neubau der reinen Rechtslehre, von der die
Ästhetik trotz ihrer kostbaren Erbschaft die intensivsten Anregungen
empfangen könnte80). Denn Kelsen hat das Prinzip der Reinheit und
begrifflichen Einheit der Rechtswelt nicht bloß a u f g e s t e 111, er hat es
mit bahnbrechender Konsequenz bis in die äußersten Verzweigungen der
Staatslehre auch durchgeführt. So daß bei der Schulung und Hell-
sichtigkeit des jetzigen juristischen Denkens die leiseste methodologische
Entgleisung sofort als Störung empfunden wird. Eine methodologisch
wirklich rein geschriebene Ästhetik, eine strenge „Morphologie des Schö-
nen"81) ist aber noch eine Tat und ein Traum der Zukunft82). Und dieser
Mangel rührt wohl daher, weil nicht einmal das Postulat der Methoden-
reinheit den Ästhetikern in Fleisch und Blut übergangen, wenn man
will: noch nicht genügend zum Bewußtsein gekommen ist. So konnten wir
bei Meumann, Fischer, Hamann und N a d 1 e r beobachten, wie
™) Wie schon früher dargelegt, entwerfen in beiden Lagern die Gegner des
reinen Denkens dasselbe Schreckbild: „Wer sich das Schöne in diesem (Herbar-
tischen) Geiste denken will, kann es sich nicht genug armselig und dürftig, nicht
genug entblößt von allen bindenden, organischen Zusammenhängen ... denken"
(Joh. Volkelt, Der Symbolbegriff in der neuesten Ästhetik, 1876. S. 2). Die juri-
stische Variante: „Da ist er (der reine Rechtstheoretiker) ein spindeldürres, bis auf
den letzten Blutstropfen ausgepreßtes Männchen ..." Darum wende man „... den
Blick auf das bunte Leben mit seiner verwirrenden Fülle von Erscheinungen ..."
(A. H o 1 d - F e r n e c k , Der Staat als Übermensch, 1926. S. 12, 13). Man rennt nur
offene Türen ein, da die Vielseitigkeit, die organische Fülle des Lebens gar nicht ein
theoretisches Ideal ist; man stürmt gegen uneinnehmbare Wände, wenn man sich
gegen die wissenschaftliche Einseitigkeit sträubt. Auch Chemie, Physik usw. sind
nur eindimensionale Aspekte der nicht nur „verwirrenden", sondern auch verwor-
renen konkreten Erfahrung. Empirische Fachwissenschaft — und jede Theorie
ist Fachwissenschaft — bedeutet nicht Erfassung der gesamten Tatsachenwelt.
— Psychologisch ist der Widerstand eines lebhaften, gefühlvollen Temperamentes
gegen die wissenschaftliche Einseitigkeit nur zu verständlich — logisch begründ-
bar ist er aber nicht. (Siehe auch Anmerkg. 17a).
80) Für den vergleichenden Methodiker ergänzen sich aufs glücklichste die
mehr unbewußte Instinktstärke und Tradition der Ästhetik einerseits und die fast
traditionslose erkenntnistheoretische Überbewußtheit der Kelsen sehen Rechts-
lehre andererseits in der Frage der Methodenreinheit.
R1) Robert Zimmermann, Allgemeine Ästhetik als Formwissenschaft, 1S65.
S. 30.
82) In diesem, aber auch nur in diesem Sinne hat Lotze Recht: „Von einer
Reform der Ästhetik ... durch Herbart zu sprechen dürfte verfrüht sein; Reformen
bestehen nicht in der Aufstellung, sondern in der Durchführung eines neuen Prin-
zips" (Geschichte der Ästhetik in Deutschland, 1913. S. 246.)