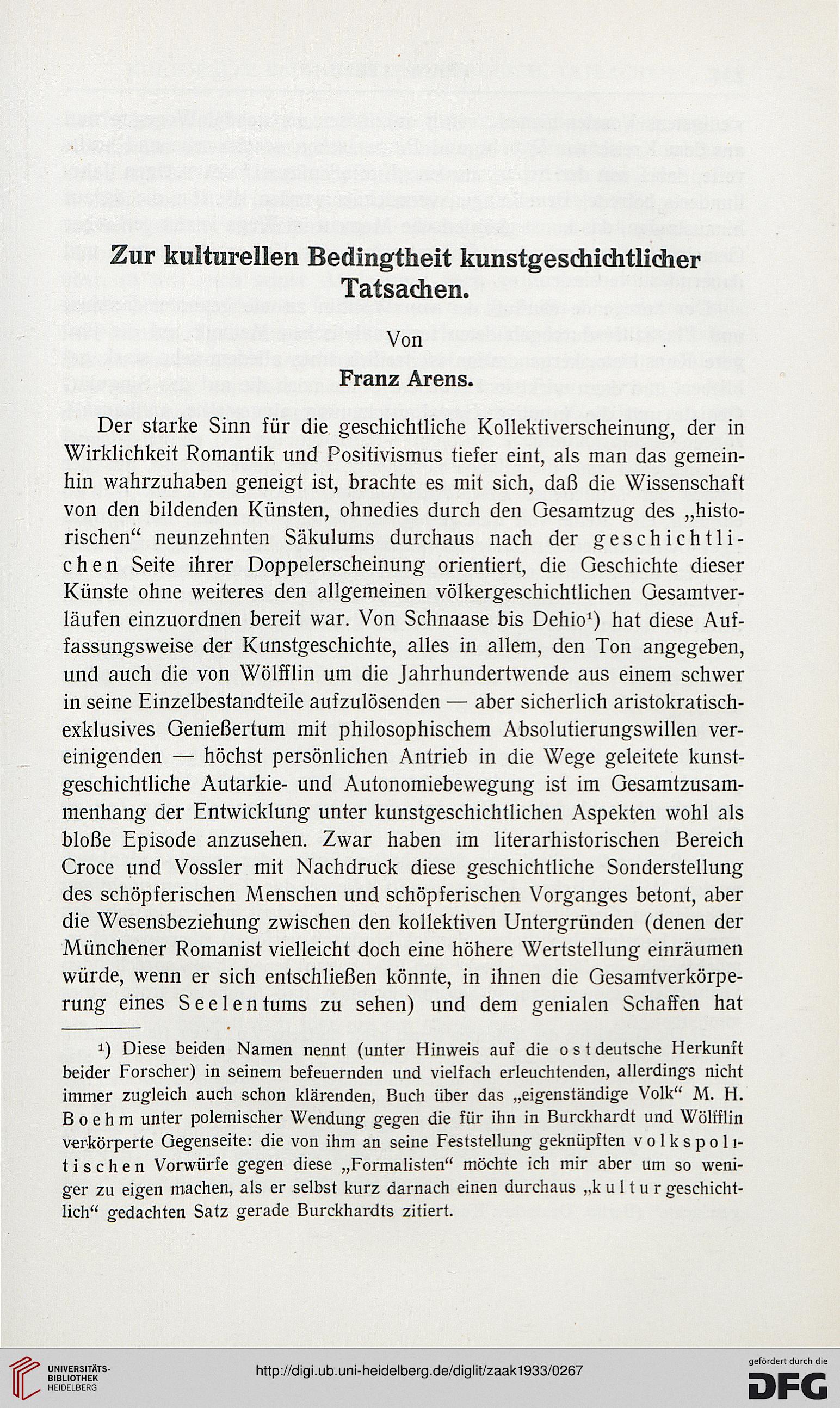Zur kulturellen Bedingtheit kunstgeschichtlicher
Tatsachen.
Von
Franz Arens.
Der starke Sinn für die geschichtliche Kollektiverscheinung, der in
Wirklichkeit Romantik und Positivismus tiefer eint, als man das gemein-
hin wahrzuhaben geneigt ist, brachte es mit sich, daß die Wissenschaft
von den bildenden Künsten, ohnedies durch den Gesamtzug des „histo-
rischen" neunzehnten Säkulums durchaus nach der geschichtli-
chen Seite ihrer Doppelerscheinung orientiert, die Geschichte dieser
Künste ohne weiteres den allgemeinen völkergeschichtlichen Gesamtver-
läufen einzuordnen bereit war. Von Schnaase bis Dehio1) hat diese Auf-
fassungsweise der Kunstgeschichte, alles in allem, den Ton angegeben,
und auch die von Wölfflin um die Jahrhundertwende aus einem schwer
in seine Einzelbestandteile aufzulösenden — aber sicherlich aristokratisch-
exklusives Genießertum mit philosophischem Absolutierungswillen ver-
einigenden — höchst persönlichen Antrieb in die Wege geleitete kunst-
geschichtliche Autarkie- und Autonomiebewegung ist im Gesamtzusam-
menhang der Entwicklung unter kunstgeschichtlichen Aspekten wohl als
bloße Episode anzusehen. Zwar haben im literarhistorischen Bereich
Croce und Vossler mit Nachdruck diese geschichtliche Sonderstellung
des schöpferischen Menschen und schöpferischen Vorganges betont, aber
die Wesensbeziehung zwischen den kollektiven Untergründen (denen der
Münchener Romanist vielleicht doch eine höhere Wertstellung einräumen
würde, wenn er sich entschließen könnte, in ihnen die Gesamtverkörpe-
rung eines Seelentums zu sehen) und dem genialen Schaffen hat
!) Diese beiden Namen nennt (unter Hinweis auf die ostdeutsche Herkunft
beider Forscher) in seinem befeuernden und vielfach erleuchtenden, allerdings nicht
immer zugleich auch schon klärenden, Buch über das „eigenständige Volk" M. H.
B o e h m unter polemischer Wendung gegen die für ihn in Burckhardt und Wölfflin
verkörperte Gegenseite: die von ihm an seine Feststellung geknüpften v o 1 k s p o 11-
tischen Vorwürfe gegen diese „Formalisten" möchte ich mir aber um so weni-
ger zu eigen machen, als er selbst kurz darnach einen durchaus „k u 11 u r geschicht-
lich" gedachten Satz gerade Burckhardts zitiert.
Tatsachen.
Von
Franz Arens.
Der starke Sinn für die geschichtliche Kollektiverscheinung, der in
Wirklichkeit Romantik und Positivismus tiefer eint, als man das gemein-
hin wahrzuhaben geneigt ist, brachte es mit sich, daß die Wissenschaft
von den bildenden Künsten, ohnedies durch den Gesamtzug des „histo-
rischen" neunzehnten Säkulums durchaus nach der geschichtli-
chen Seite ihrer Doppelerscheinung orientiert, die Geschichte dieser
Künste ohne weiteres den allgemeinen völkergeschichtlichen Gesamtver-
läufen einzuordnen bereit war. Von Schnaase bis Dehio1) hat diese Auf-
fassungsweise der Kunstgeschichte, alles in allem, den Ton angegeben,
und auch die von Wölfflin um die Jahrhundertwende aus einem schwer
in seine Einzelbestandteile aufzulösenden — aber sicherlich aristokratisch-
exklusives Genießertum mit philosophischem Absolutierungswillen ver-
einigenden — höchst persönlichen Antrieb in die Wege geleitete kunst-
geschichtliche Autarkie- und Autonomiebewegung ist im Gesamtzusam-
menhang der Entwicklung unter kunstgeschichtlichen Aspekten wohl als
bloße Episode anzusehen. Zwar haben im literarhistorischen Bereich
Croce und Vossler mit Nachdruck diese geschichtliche Sonderstellung
des schöpferischen Menschen und schöpferischen Vorganges betont, aber
die Wesensbeziehung zwischen den kollektiven Untergründen (denen der
Münchener Romanist vielleicht doch eine höhere Wertstellung einräumen
würde, wenn er sich entschließen könnte, in ihnen die Gesamtverkörpe-
rung eines Seelentums zu sehen) und dem genialen Schaffen hat
!) Diese beiden Namen nennt (unter Hinweis auf die ostdeutsche Herkunft
beider Forscher) in seinem befeuernden und vielfach erleuchtenden, allerdings nicht
immer zugleich auch schon klärenden, Buch über das „eigenständige Volk" M. H.
B o e h m unter polemischer Wendung gegen die für ihn in Burckhardt und Wölfflin
verkörperte Gegenseite: die von ihm an seine Feststellung geknüpften v o 1 k s p o 11-
tischen Vorwürfe gegen diese „Formalisten" möchte ich mir aber um so weni-
ger zu eigen machen, als er selbst kurz darnach einen durchaus „k u 11 u r geschicht-
lich" gedachten Satz gerade Burckhardts zitiert.