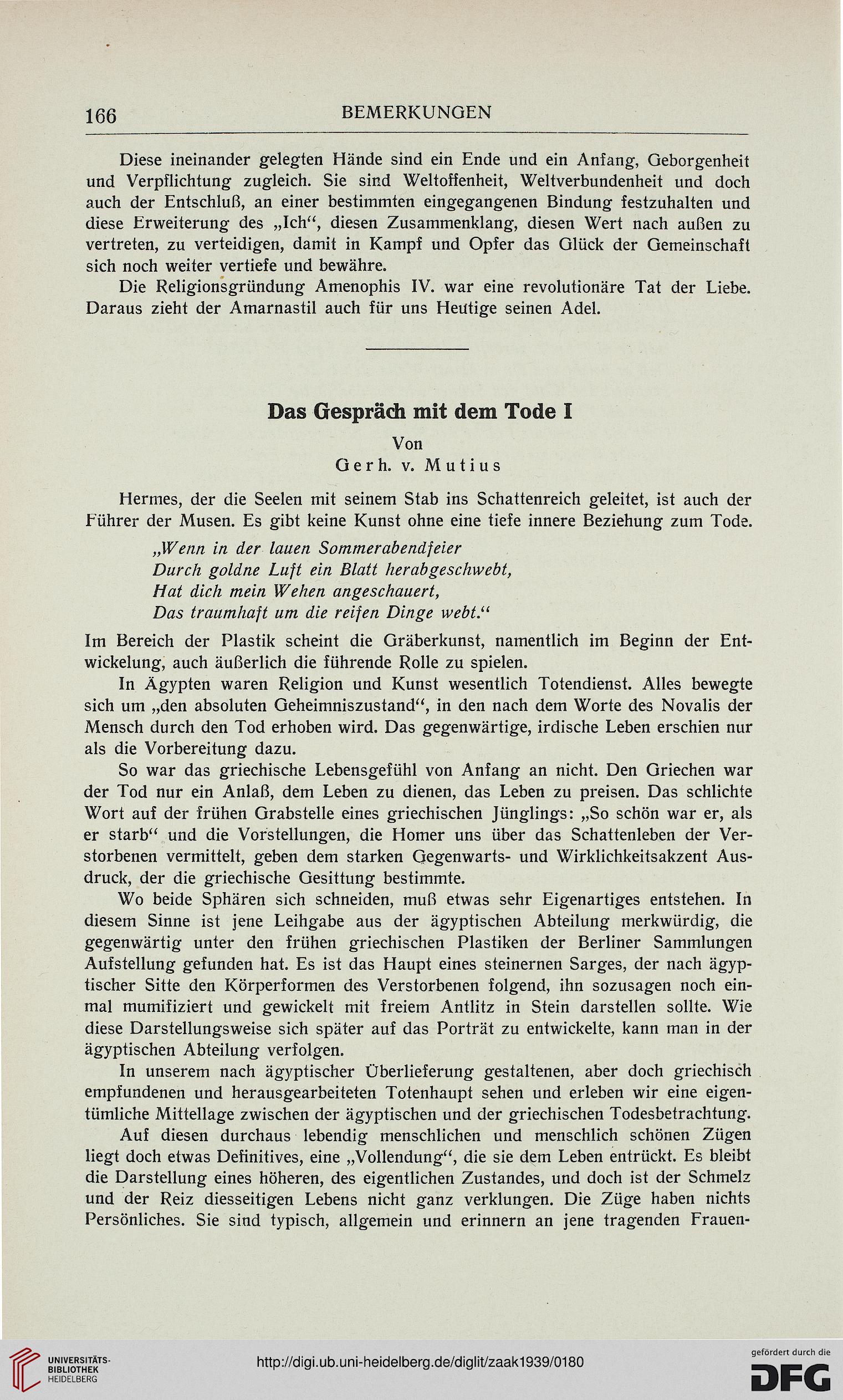166
BEMERKUNGEN
Diese ineinander gelegten Hände sind ein Ende und ein Anfang, Geborgenheit
und Verpflichtung zugleich. Sie sind Weltoffenheit, Weltverbundenheit und doch
auch der Entschluß, an einer bestimmten eingegangenen Bindung festzuhalten und
diese Erweiterung des „Ich", diesen Zusammenklang, diesen Wert nach außen zu
vertreten, zu verteidigen, damit in Kampf und Opfer das Glück der Gemeinschaft
sich noch weiter vertiefe und bewähre.
Die Religionsgründung Amenophis IV. war eine revolutionäre Tat der Liebe.
Daraus zieht der Amarnastil auch für uns Heutige seinen Adel.
Das Gespräch mit dem Tode I
Von
Gerh. v. Mutius
Hermes, der die Seelen mit seinem Stab ins Schattenreich geleitet, ist auch der
Führer der Musen. Es gibt keine Kunst ohne eine tiefe innere Beziehung zum Tode.
„Wenn in der lauen Sommerabendfeier
Durch goldne Luft ein Blatt herabgeschwebt,
Hat dich mein Wehen angeschauert,
Das traumhaft um die reifen Dinge webt."
Im Bereich der Plastik scheint die Gräberkunst, namentlich im Beginn der Ent-
wickelung, auch äußerlich die führende Rolle zu spielen.
In Ägypten waren Religion und Kunst wesentlich Totendienst. Alles bewegte
sich um „den absoluten Geheimniszustand", in den nach dem Worte des Novalis der
Mensch durch den Tod erhoben wird. Das gegenwärtige, irdische Leben erschien nur
als die Vorbereitung dazu.
So war das griechische Lebensgefühl von Anfang an nicht. Den Griechen war
der Tod nur ein Anlaß, dem Leben zu dienen, das Leben zu preisen. Das schlichte
Wort auf der frühen Grabstelle eines griechischen Jünglings: „So schön war er, als
er starb" und die Vorstellungen, die Homer uns über das Schattenleben der Ver-
storbenen vermittelt, geben dem starken Qegenwarts- und Wirklichkeitsakzent Aus-
druck, der die griechische Gesittung bestimmte.
Wo beide Sphären sich schneiden, muß etwas sehr Eigenartiges entstehen. In
diesem Sinne ist jene Leihgabe aus der ägyptischen Abteilung merkwürdig, die
gegenwärtig unter den frühen griechischen Plastiken der Berliner Sammlungen
Aufstellung gefunden hat. Es ist das Haupt eines steinernen Sarges, der nach ägyp-
tischer Sitte den Körperformen des Verstorbenen folgend, ihn sozusagen noch ein-
mal mumifiziert und gewickelt mit freiem Antlitz in Stein darstellen sollte. Wie
diese Darstellungsweise sich später auf das Porträt zu entwickelte, kann man in der
ägyptischen Abteilung verfolgen.
In unserem nach ägyptischer Überlieferung gestaltenen, aber doch griechisch
empfundenen und herausgearbeiteten Totenhaupt sehen und erleben wir eine eigen-
tümliche Mittellage zwischen der ägyptischen und der griechischen Todesbetrachtung.
Auf diesen durchaus lebendig menschlichen und menschlich schönen Zügen
liegt doch etwas Definitives, eine „Vollendung", die sie dem Leben entrückt. Es bleibt
die Darstellung eines höheren, des eigentlichen Zustandes, und doch ist der Schmelz
und der Reiz diesseitigen Lebens nicht ganz verklungen. Die Züge haben nichts
Persönliches. Sie sind typisch, allgemein und erinnern an jene tragenden Frauen-
BEMERKUNGEN
Diese ineinander gelegten Hände sind ein Ende und ein Anfang, Geborgenheit
und Verpflichtung zugleich. Sie sind Weltoffenheit, Weltverbundenheit und doch
auch der Entschluß, an einer bestimmten eingegangenen Bindung festzuhalten und
diese Erweiterung des „Ich", diesen Zusammenklang, diesen Wert nach außen zu
vertreten, zu verteidigen, damit in Kampf und Opfer das Glück der Gemeinschaft
sich noch weiter vertiefe und bewähre.
Die Religionsgründung Amenophis IV. war eine revolutionäre Tat der Liebe.
Daraus zieht der Amarnastil auch für uns Heutige seinen Adel.
Das Gespräch mit dem Tode I
Von
Gerh. v. Mutius
Hermes, der die Seelen mit seinem Stab ins Schattenreich geleitet, ist auch der
Führer der Musen. Es gibt keine Kunst ohne eine tiefe innere Beziehung zum Tode.
„Wenn in der lauen Sommerabendfeier
Durch goldne Luft ein Blatt herabgeschwebt,
Hat dich mein Wehen angeschauert,
Das traumhaft um die reifen Dinge webt."
Im Bereich der Plastik scheint die Gräberkunst, namentlich im Beginn der Ent-
wickelung, auch äußerlich die führende Rolle zu spielen.
In Ägypten waren Religion und Kunst wesentlich Totendienst. Alles bewegte
sich um „den absoluten Geheimniszustand", in den nach dem Worte des Novalis der
Mensch durch den Tod erhoben wird. Das gegenwärtige, irdische Leben erschien nur
als die Vorbereitung dazu.
So war das griechische Lebensgefühl von Anfang an nicht. Den Griechen war
der Tod nur ein Anlaß, dem Leben zu dienen, das Leben zu preisen. Das schlichte
Wort auf der frühen Grabstelle eines griechischen Jünglings: „So schön war er, als
er starb" und die Vorstellungen, die Homer uns über das Schattenleben der Ver-
storbenen vermittelt, geben dem starken Qegenwarts- und Wirklichkeitsakzent Aus-
druck, der die griechische Gesittung bestimmte.
Wo beide Sphären sich schneiden, muß etwas sehr Eigenartiges entstehen. In
diesem Sinne ist jene Leihgabe aus der ägyptischen Abteilung merkwürdig, die
gegenwärtig unter den frühen griechischen Plastiken der Berliner Sammlungen
Aufstellung gefunden hat. Es ist das Haupt eines steinernen Sarges, der nach ägyp-
tischer Sitte den Körperformen des Verstorbenen folgend, ihn sozusagen noch ein-
mal mumifiziert und gewickelt mit freiem Antlitz in Stein darstellen sollte. Wie
diese Darstellungsweise sich später auf das Porträt zu entwickelte, kann man in der
ägyptischen Abteilung verfolgen.
In unserem nach ägyptischer Überlieferung gestaltenen, aber doch griechisch
empfundenen und herausgearbeiteten Totenhaupt sehen und erleben wir eine eigen-
tümliche Mittellage zwischen der ägyptischen und der griechischen Todesbetrachtung.
Auf diesen durchaus lebendig menschlichen und menschlich schönen Zügen
liegt doch etwas Definitives, eine „Vollendung", die sie dem Leben entrückt. Es bleibt
die Darstellung eines höheren, des eigentlichen Zustandes, und doch ist der Schmelz
und der Reiz diesseitigen Lebens nicht ganz verklungen. Die Züge haben nichts
Persönliches. Sie sind typisch, allgemein und erinnern an jene tragenden Frauen-