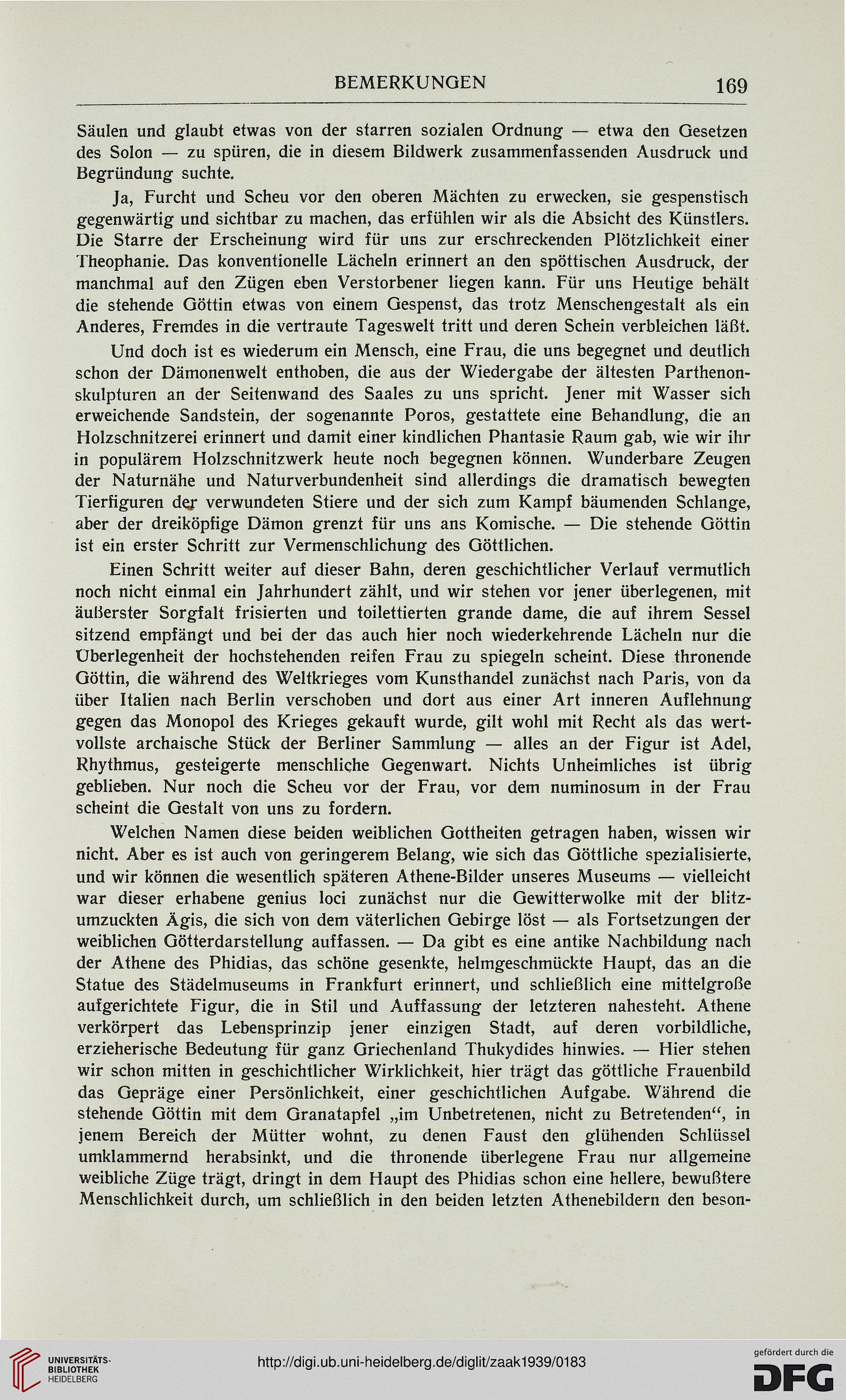BEMERKUNGEN
169
Säulen und glaubt etwas von der starren sozialen Ordnung — etwa den Gesetzen
des Solon — zu spüren, die in diesem Bildwerk zusammenfassenden Ausdruck und
Begründung suchte.
Ja, Furcht und Scheu vor den oberen Mächten zu erwecken, sie gespenstisch
gegenwärtig und sichtbar zu machen, das erfühlen wir als die Absicht des Künstlers.
Die Starre der Erscheinung wird für uns zur erschreckenden Plötzlichkeit einer
Theophanie. Das konventionelle Lächeln erinnert an den spöttischen Ausdruck, der
manchmal auf den Zügen eben Verstorbener liegen kann. Für uns Heutige behält
die stehende Göttin etwas von einem Gespenst, das trotz Menschengestalt als ein
Anderes, Fremdes in die vertraute Tageswelt tritt und deren Schein verbleichen läßt.
Und doch ist es wiederum ein Mensch, eine Frau, die uns begegnet und deutlich
schon der Dämonenwelt enthoben, die aus der Wiedergabe der ältesten Parthenon-
skulpturen an der Seitenwand des Saales zu uns spricht. Jener mit Wasser sich
erweichende Sandstein, der sogenannte Porös, gestattete eine Behandlung, die an
Holzschnitzerei erinnert und damit einer kindlichen Phantasie Raum gab, wie wir ihr
in populärem Holzschnitzwerk heute noch begegnen können. Wunderbare Zeugen
der Naturnähe und Naturverbundenheit sind allerdings die dramatisch bewegten
Tierfiguren dej* verwundeten Stiere und der sich zum Kampf bäumenden Schlange,
aber der dreiköpfige Dämon grenzt für uns ans Komische. — Die stehende Göttin
ist ein erster Schritt zur Vermenschlichung des Göttlichen.
Einen Schritt weiter auf dieser Bahn, deren geschichtlicher Verlauf vermutlich
noch nicht einmal ein Jahrhundert zählt, und wir stehen vor jener überlegenen, mit
äußerster Sorgfalt frisierten und toilettierten grande dame, die auf ihrem Sessel
sitzend empfängt und bei der das auch hier noch wiederkehrende Lächeln nur die
Überlegenheit der hochstehenden reifen Frau zu spiegeln scheint. Diese thronende
Göttin, die während des Weltkrieges vom Kunsthandel zunächst nach Paris, von da
über Italien nach Berlin verschoben und dort aus einer Art inneren Auflehnung
gegen das Monopol des Krieges gekauft wurde, gilt wohl mit Recht als das wert-
vollste archaische Stück der Berliner Sammlung — alles an der Figur ist Adel,
Rhythmus, gesteigerte menschliche Gegenwart. Nichts Unheimliches ist übrig
geblieben. Nur noch die Scheu vor der Frau, vor dem numinosum in der Frau
scheint die Gestalt von uns zu fordern.
Welchen Namen diese beiden weiblichen Gottheiten getragen haben, wissen wir
nicht. Aber es ist auch von geringerem Belang, wie sich das Göttliche spezialisierte,
und wir können die wesentlich späteren Athene-Bilder unseres Museums — vielleicht
war dieser erhabene genius loci zunächst nur die Gewitterwolke mit der blitz-
umzuckten Ägis, die sich von dem väterlichen Gebirge löst — als Fortsetzungen der
weiblichen Götterdarstellung auffassen. — Da gibt es eine antike Nachbildung nach
der Athene des Phidias, das schöne gesenkte, helmgeschmückte Haupt, das an die
Statue des Städelmuseums in Frankfurt erinnert, und schließlich eine mittelgroße
aufgerichtete Figur, die in Stil und Auffassung der letzteren nahesteht. Athene
verkörpert das Lebensprinzip jener einzigen Stadt, auf deren vorbildliche,
erzieherische Bedeutung für ganz Griechenland Thukydides hinwies. — Hier stehen
wir schon mitten in geschichtlicher Wirklichkeit, hier trägt das göttliche Frauenbild
das Gepräge einer Persönlichkeit, einer geschichtlichen Aufgabe. Während die
stehende Göttin mit dem Granatapfel „im Unbetretenen, nicht zu Betretenden", in
jenem Bereich der Mütter wohnt, zu denen Faust den glühenden Schlüssel
umklammernd herabsinkt, und die thronende überlegene Frau nur allgemeine
weibliche Züge trägt, dringt in dem Haupt des Phidias schon eine hellere, bewußtere
Menschlichkeit durch, um schließlich in den beiden letzten Athenebildern den beson-
169
Säulen und glaubt etwas von der starren sozialen Ordnung — etwa den Gesetzen
des Solon — zu spüren, die in diesem Bildwerk zusammenfassenden Ausdruck und
Begründung suchte.
Ja, Furcht und Scheu vor den oberen Mächten zu erwecken, sie gespenstisch
gegenwärtig und sichtbar zu machen, das erfühlen wir als die Absicht des Künstlers.
Die Starre der Erscheinung wird für uns zur erschreckenden Plötzlichkeit einer
Theophanie. Das konventionelle Lächeln erinnert an den spöttischen Ausdruck, der
manchmal auf den Zügen eben Verstorbener liegen kann. Für uns Heutige behält
die stehende Göttin etwas von einem Gespenst, das trotz Menschengestalt als ein
Anderes, Fremdes in die vertraute Tageswelt tritt und deren Schein verbleichen läßt.
Und doch ist es wiederum ein Mensch, eine Frau, die uns begegnet und deutlich
schon der Dämonenwelt enthoben, die aus der Wiedergabe der ältesten Parthenon-
skulpturen an der Seitenwand des Saales zu uns spricht. Jener mit Wasser sich
erweichende Sandstein, der sogenannte Porös, gestattete eine Behandlung, die an
Holzschnitzerei erinnert und damit einer kindlichen Phantasie Raum gab, wie wir ihr
in populärem Holzschnitzwerk heute noch begegnen können. Wunderbare Zeugen
der Naturnähe und Naturverbundenheit sind allerdings die dramatisch bewegten
Tierfiguren dej* verwundeten Stiere und der sich zum Kampf bäumenden Schlange,
aber der dreiköpfige Dämon grenzt für uns ans Komische. — Die stehende Göttin
ist ein erster Schritt zur Vermenschlichung des Göttlichen.
Einen Schritt weiter auf dieser Bahn, deren geschichtlicher Verlauf vermutlich
noch nicht einmal ein Jahrhundert zählt, und wir stehen vor jener überlegenen, mit
äußerster Sorgfalt frisierten und toilettierten grande dame, die auf ihrem Sessel
sitzend empfängt und bei der das auch hier noch wiederkehrende Lächeln nur die
Überlegenheit der hochstehenden reifen Frau zu spiegeln scheint. Diese thronende
Göttin, die während des Weltkrieges vom Kunsthandel zunächst nach Paris, von da
über Italien nach Berlin verschoben und dort aus einer Art inneren Auflehnung
gegen das Monopol des Krieges gekauft wurde, gilt wohl mit Recht als das wert-
vollste archaische Stück der Berliner Sammlung — alles an der Figur ist Adel,
Rhythmus, gesteigerte menschliche Gegenwart. Nichts Unheimliches ist übrig
geblieben. Nur noch die Scheu vor der Frau, vor dem numinosum in der Frau
scheint die Gestalt von uns zu fordern.
Welchen Namen diese beiden weiblichen Gottheiten getragen haben, wissen wir
nicht. Aber es ist auch von geringerem Belang, wie sich das Göttliche spezialisierte,
und wir können die wesentlich späteren Athene-Bilder unseres Museums — vielleicht
war dieser erhabene genius loci zunächst nur die Gewitterwolke mit der blitz-
umzuckten Ägis, die sich von dem väterlichen Gebirge löst — als Fortsetzungen der
weiblichen Götterdarstellung auffassen. — Da gibt es eine antike Nachbildung nach
der Athene des Phidias, das schöne gesenkte, helmgeschmückte Haupt, das an die
Statue des Städelmuseums in Frankfurt erinnert, und schließlich eine mittelgroße
aufgerichtete Figur, die in Stil und Auffassung der letzteren nahesteht. Athene
verkörpert das Lebensprinzip jener einzigen Stadt, auf deren vorbildliche,
erzieherische Bedeutung für ganz Griechenland Thukydides hinwies. — Hier stehen
wir schon mitten in geschichtlicher Wirklichkeit, hier trägt das göttliche Frauenbild
das Gepräge einer Persönlichkeit, einer geschichtlichen Aufgabe. Während die
stehende Göttin mit dem Granatapfel „im Unbetretenen, nicht zu Betretenden", in
jenem Bereich der Mütter wohnt, zu denen Faust den glühenden Schlüssel
umklammernd herabsinkt, und die thronende überlegene Frau nur allgemeine
weibliche Züge trägt, dringt in dem Haupt des Phidias schon eine hellere, bewußtere
Menschlichkeit durch, um schließlich in den beiden letzten Athenebildern den beson-