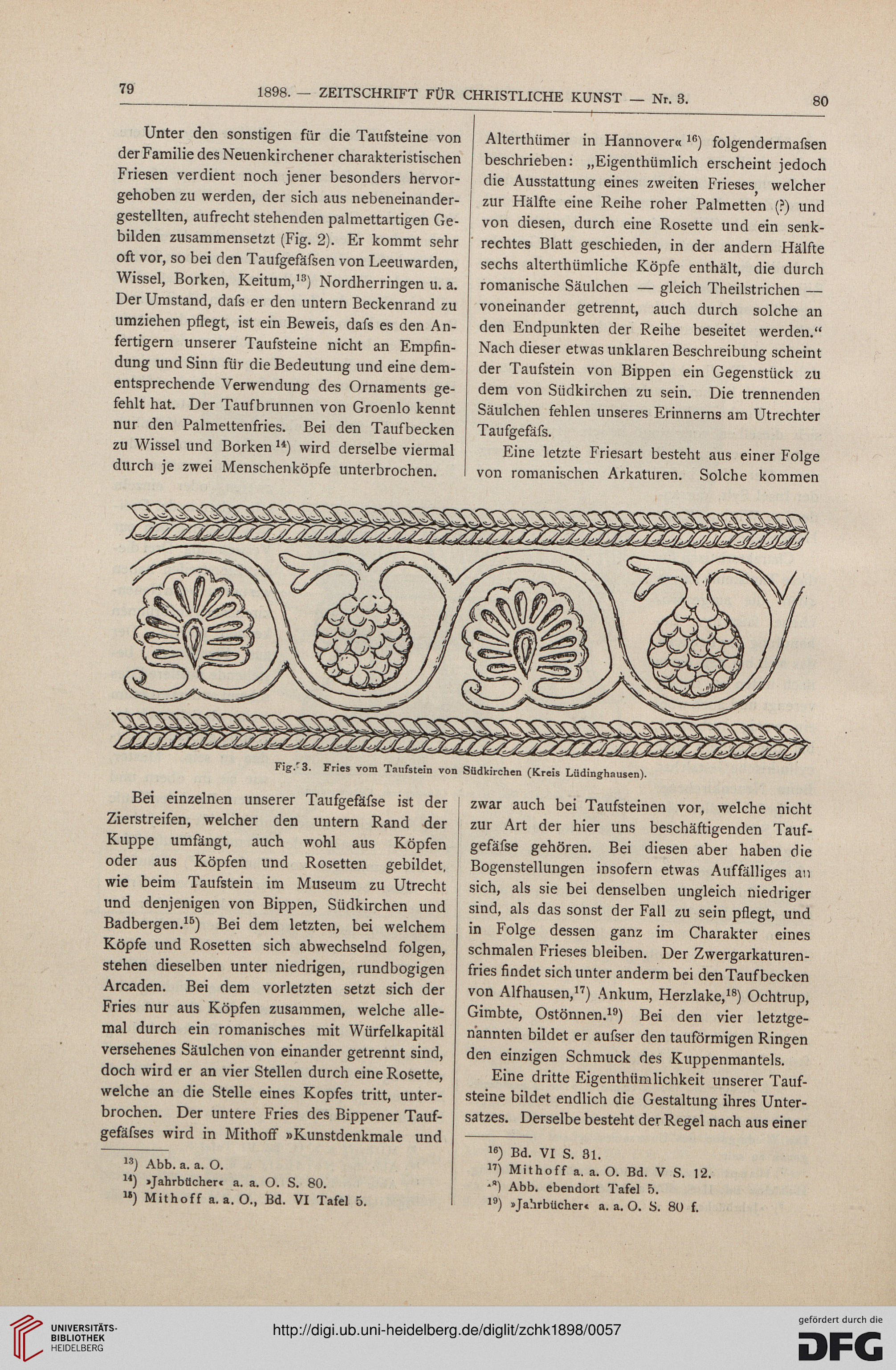79
1898. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 3.
80
Unter den sonstigen für die Taufsteine von
der Familie des Neuenkirchener charakteristischen
Friesen verdient noch jener besonders hervor-
gehoben zu werden, der sich aus nebeneinander-
gestellten, aufrecht stehenden palmettartigen Ge-
bilden zusammensetzt (Fig. 2). Er kommt sehr
oft vor, so bei den Taufgefäfsen von Leeuwarden,
Wissel, Borken, Keitum,13) Nordherringen u. a.
Der Umstand, dafs er den untern Beckenrand zu
umziehen pflegt, ist ein Beweis, dafs es den An-
fertigern unserer Taufsteine nicht an Empfin-
dung und Sinn für die Bedeutung und eine dem-
entsprechende Verwendung des Ornaments ge-
fehlt hat. Der Taufbrunnen von Groenlo kennt
nur den Palmettenfries. Bei den Taufbecken
zu Wissel und Borken u) wird derselbe viermal
durch je zwei Menschenköpfe unterbrochen.
Alterthümer in Hannover« 10) folgendermafsen
beschrieben: „Eigenthümlich erscheint jedoch
die Ausstattung eines zweiten Frieses welcher
zur Hälfte eine Reihe roher Palmetten (?) und
von diesen, durch eine Rosette und ein senk-
rechtes Blatt geschieden, in der andern Hälfte
sechs alterthümliche Köpfe enthält, die durch
romanische Säulchen — gleich Theilstrichen —
voneinander getrennt, auch durch solche an
den Endpunkten der Reihe beseitet werden."
Nach dieser etwas unklaren Beschreibung scheint
der Taufstein von Bippen ein Gegenstück zu
dem von Südkirchen zu sein. Die trennenden
Säulchen fehlen unseres Erinnerns am Utrechter
Taufgefäfs.
Eine letzte Friesart besteht aus einer Folge
von romanischen Arkaturen. Solche kommen
Fig.'3. Fries vom Taufstein von Südkirchen (Kreis Lüdinghausen).
Bei einzelnen unserer Taufgefäfse ist der
Zierstreifen, welcher den untern Rand der
Kuppe umfängt, auch wohl aus Köpfen
oder aus Köpfen und Rosetten gebildet,
wie beim Taufstein im Museum zu Utrecht
und denjenigen von Bippen, Südkirchen und
Badbergen.15) Bei dem letzten, bei welchem
Köpfe und Rosetten sich abwechselnd folgen,
stehen dieselben unter niedrigen, rundbogigen
Arcaden. Bei dem vorletzten setzt sich der
Fries nur aus Köpfen zusammen, welche alle-
mal durch ein romanisches mit Würfelkapitäl
versehenes Säulchen von einander getrennt sind,
doch wird er an vier Stellen durch eine Rosette,
welche an die Stelle eines Kopfes tritt, unter-
brochen. Der untere Fries des Bippener Tauf-
gefäfses wird in Mithoff »Kunstdenkmale und
13) Abb. a. a. O.
") •Jahrbücher« a. a. O. S.
80.
") Mithoff a.a.O., Bd. VI Tafel 5.
zwar auch bei Taufsteinen vor, welche nicht
zur Art der hier uns beschäftigenden Tauf-
gefäfse gehören. Bei diesen aber haben die
Bogenstellungen insofern etwas Auffälliges an
sich, als sie bei denselben ungleich niedriger
sind, als das sonst der Fall zu sein pflegt, und
in Folge dessen ganz im Charakter eines
schmalen Frieses bleiben. Der Zwergarkaturen-
fries findet sich unter anderm bei den Taufbecken
von Alfhausen,17) Ankum, Herzlake,18) Ochtrup,
Gimbte, Ostönnen.19) Bei den vier letztge-
nannten bildet er aufser den tauförmigen Ringen
den einzigen Schmuck des Kuppenmantels.
Eine dritte Eigenthümlichkeit unserer Tauf-
steine bildet endlich die Gestaltung ihres Unter-
satzes. Derselbe besteht der Regel nach aus einer
le) Bd. VI S. 31.
") Mithoff a. a. O. Bd. V S. 12.
*") Abb. ebendort Tafel 5.
•9) »Jahrbücher« a. a. O. S. 80 f.
1898. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 3.
80
Unter den sonstigen für die Taufsteine von
der Familie des Neuenkirchener charakteristischen
Friesen verdient noch jener besonders hervor-
gehoben zu werden, der sich aus nebeneinander-
gestellten, aufrecht stehenden palmettartigen Ge-
bilden zusammensetzt (Fig. 2). Er kommt sehr
oft vor, so bei den Taufgefäfsen von Leeuwarden,
Wissel, Borken, Keitum,13) Nordherringen u. a.
Der Umstand, dafs er den untern Beckenrand zu
umziehen pflegt, ist ein Beweis, dafs es den An-
fertigern unserer Taufsteine nicht an Empfin-
dung und Sinn für die Bedeutung und eine dem-
entsprechende Verwendung des Ornaments ge-
fehlt hat. Der Taufbrunnen von Groenlo kennt
nur den Palmettenfries. Bei den Taufbecken
zu Wissel und Borken u) wird derselbe viermal
durch je zwei Menschenköpfe unterbrochen.
Alterthümer in Hannover« 10) folgendermafsen
beschrieben: „Eigenthümlich erscheint jedoch
die Ausstattung eines zweiten Frieses welcher
zur Hälfte eine Reihe roher Palmetten (?) und
von diesen, durch eine Rosette und ein senk-
rechtes Blatt geschieden, in der andern Hälfte
sechs alterthümliche Köpfe enthält, die durch
romanische Säulchen — gleich Theilstrichen —
voneinander getrennt, auch durch solche an
den Endpunkten der Reihe beseitet werden."
Nach dieser etwas unklaren Beschreibung scheint
der Taufstein von Bippen ein Gegenstück zu
dem von Südkirchen zu sein. Die trennenden
Säulchen fehlen unseres Erinnerns am Utrechter
Taufgefäfs.
Eine letzte Friesart besteht aus einer Folge
von romanischen Arkaturen. Solche kommen
Fig.'3. Fries vom Taufstein von Südkirchen (Kreis Lüdinghausen).
Bei einzelnen unserer Taufgefäfse ist der
Zierstreifen, welcher den untern Rand der
Kuppe umfängt, auch wohl aus Köpfen
oder aus Köpfen und Rosetten gebildet,
wie beim Taufstein im Museum zu Utrecht
und denjenigen von Bippen, Südkirchen und
Badbergen.15) Bei dem letzten, bei welchem
Köpfe und Rosetten sich abwechselnd folgen,
stehen dieselben unter niedrigen, rundbogigen
Arcaden. Bei dem vorletzten setzt sich der
Fries nur aus Köpfen zusammen, welche alle-
mal durch ein romanisches mit Würfelkapitäl
versehenes Säulchen von einander getrennt sind,
doch wird er an vier Stellen durch eine Rosette,
welche an die Stelle eines Kopfes tritt, unter-
brochen. Der untere Fries des Bippener Tauf-
gefäfses wird in Mithoff »Kunstdenkmale und
13) Abb. a. a. O.
") •Jahrbücher« a. a. O. S.
80.
") Mithoff a.a.O., Bd. VI Tafel 5.
zwar auch bei Taufsteinen vor, welche nicht
zur Art der hier uns beschäftigenden Tauf-
gefäfse gehören. Bei diesen aber haben die
Bogenstellungen insofern etwas Auffälliges an
sich, als sie bei denselben ungleich niedriger
sind, als das sonst der Fall zu sein pflegt, und
in Folge dessen ganz im Charakter eines
schmalen Frieses bleiben. Der Zwergarkaturen-
fries findet sich unter anderm bei den Taufbecken
von Alfhausen,17) Ankum, Herzlake,18) Ochtrup,
Gimbte, Ostönnen.19) Bei den vier letztge-
nannten bildet er aufser den tauförmigen Ringen
den einzigen Schmuck des Kuppenmantels.
Eine dritte Eigenthümlichkeit unserer Tauf-
steine bildet endlich die Gestaltung ihres Unter-
satzes. Derselbe besteht der Regel nach aus einer
le) Bd. VI S. 31.
") Mithoff a. a. O. Bd. V S. 12.
*") Abb. ebendort Tafel 5.
•9) »Jahrbücher« a. a. O. S. 80 f.