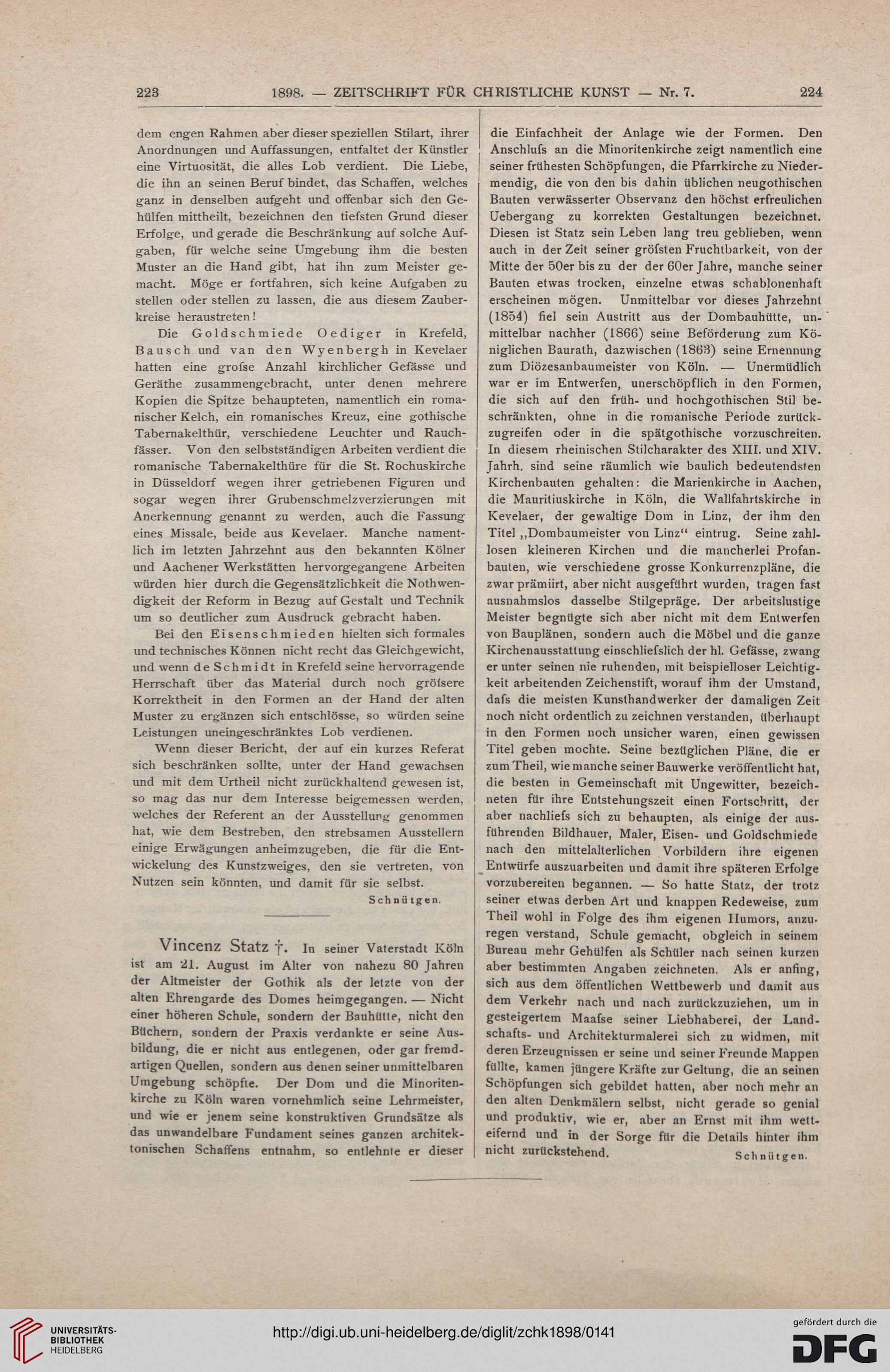223
1898.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
224
dem engen Rahmen aber dieser speziellen Stilart, ihrer
Anordnungen und Auffassungen, entfaltet der Künstler
eine Virtuosität, die alles Lob verdient. Die Liebe,
die ihn an seinen Beruf bindet, das Schaffen, welches
ganz in denselben aufgeht und offenbar sich den Ge-
hülfen mittheilt, bezeichnen den tiefsten Grund dieser
Erfolge, und gerade die Beschränkung auf solche Auf-
gaben, für welche seine Umgebung ihm die besten
Muster an die Hand gibt, hat ihn zum Meister ge-
macht. Möge er fortfahren, sich keine Aufgaben zu
stellen oder stellen zu lassen, die aus diesem Zauber-
kreise heraustreten!
Die Goldschmiede Oediger in Krefeld,
Bausch und van den Wyenbergh in Kevelaer
hatten eine grofse Anzahl kirchlicher Gefässe und
Geräthe zusammengebracht, unter denen mehrere
Kopien die Spitze behaupteten, namentlich ein roma-
nischer Kelch, ein romanisches Kreuz, eine gothische
Tabernakelthür, verschiedene Leuchter und Rauch-
fässer. Von den selbstständigen Arbeiten verdient die
romanische Tabernakelthüre für die St. Rochuskirche
in Düsseldorf wegen ihrer getriebenen Figuren und
sogar wegen ihrer Grubenschmelzverzierungen mit
Anerkennung genannt zu werden, auch die Fassung
eines Missale, beide aus Kevelaer. Manche nament-
lich im letzten Jahrzehnt aus den bekannten Kölner
und Aachener Werkstätten hervorgegangene Arbeiten
würden hier durch die Gegensätzlichkeit die Nothwen-
digkeit der Reform in Bezug auf Gestalt und Technik
um so deutlicher zum Ausdruck gebracht haben.
Bei den Eisenschmieden hielten sich formales
und technisches Können nicht recht das Gleichgewicht,
und wenn de Schmidt in Krefeld seine hervorragende
Herrschaft über das Material durch noch gröfsere
Korrektheit in den Formen an der Hand der alten
Muster zu ergänzen sich entschlösse, so würden seine
Leistungen uneingeschränktes Lob verdienen.
Wenn dieser Bericht, der auf ein kurzes Referat
sich beschränken sollte, unter der Hand gewachsen
und mit dem Urtheil nicht zurückhaltend gewesen ist,
so mag das nur dem Interesse beigemessen werden,
welches der Referent an der Ausstellung genommen
hat, wie dem Bestreben, den strebsamen Ausstellern
einige Erwägungen anheimzugeben, die für die Ent-
wicklung des Kunstzweiges, den sie vertreten, von
Nutzen sein könnten, und damit für sie selbst.
Schnü tgen.
Vincenz Statz f. In seiner Vaterstadt Köln
ist am 21. August im Alter von nahezu 80 Jahren
der Altmeister der Gothik als der letzte von der
alten Ehrengarde des Domes heimgegangen. — Nicht
einer höheren Schule, sondern der Bauhülle, nicht den
Büchern, sondern der Praxis verdankte er seine Aus-
bildung, die er nicht aus entlegenen, oder gar fremd-
artigen Quellen, sondern aus denen seiner unmittelbaren
Umgebung schöpfte. Der Dom und die Minoriten-
kirche zu Köln waren vornehmlich seine Lehrmeister,
und wie er jenem seine konstruktiven Grundsätze als
das unwandelbare Fundament seines ganzen architek-
tonischen Schaffens entnahm, so entlehnte er dieser
die Einfachheit der Anlage wie der Formen. Den
Anschlufs an die Minoritenkirche zeigt namentlich eine
seiner frühesten Schöpfungen, die Pfarrkirche zu Nieder-
mendig, die von den bis dahin üblichen neugothischen
Bauten verwässerter Observanz den höchst erfreulichen
Uebergang zu korrekten Gestaltungen bezeichnet.
Diesen ist Statz sein Leben lang treu geblieben, wenn
auch in der Zeit seiner gröfsten Fruchtbarkeit, von der
Mitte der 50er bis zu der der 60er Jahre, manche seiner
Bauten etwas trocken, einzelne etwas schablonenhaft
erscheinen mögen. Unmittelbar vor dieses Jahrzehnt
(1854) fiel sein Austritt aus der Dombauhütte, un- '
mittelbar nachher (1866) seine Beförderung zum Kö-
niglichen Baurath, dazwischen (1863) seine Ernennung
zum Diözesanbaumeister von Köln. — Unermüdlich
war er im Entwerfen, unerschöpflich in den Formen,
die sich auf den früh- und hochgothischen Stil be-
schränkten, ohne in die romanische Periode zurück-
zugreifen oder in die spätgothische vorzuschreiten.
In diesem rheinischen Stilcharakter des XIII. und XIV.
Jahrh. sind seine räumlich wie baulich bedeutendsten
Kirchenbauten gehalten: die Marienkirche in Aachen,
die Mauritiuskirche in Köln, die Wallfahrtskirche in
Kevelaer, der gewaltige Dom in Linz, der ihm den
Titel ,,Dombaumeister von Linz" eintrug. Seine zahl-
losen kleineren Kirchen und die mancherlei Profan-
bauten, wie verschiedene grosse Konkurrenzpläne, die
zwar prämiirt, aber nicht ausgeführt wurden, tragen fast
ausnahmslos dasselbe Stilgepräge. Der arbeitslustige
Meister begnügte sich aber nicht mit dem Entwerfen
von Bauplänen, sondern auch die Möbel und die ganze
Kirchenausstatlung einschliefslich der hl. Gefässe, zwang
er unter seinen nie ruhenden, mit beispielloser Leichtig-
keit arbeitenden Zeichenstift, worauf ihm der Umstand,
dafs die meisten Kunsthandwerker der damaligen Zeit
noch nicht ordentlich zu zeichnen verstanden, überhaupt
in den Formen noch unsicher waren, einen gewissen
Titel geben mochte. Seine bezüglichen Pläne, die er
zumTheil, wie manche seiner Bauwerke veröffentlicht hat,
die besten in Gemeinschaft mit Ungewitter, bezeich-
neten für ihre Entstehungszeit einen Fortschritt, der
aber nachliefs sich zu behaupten, als einige der aus-
führenden Bildhauer, Maler, Eisen- und Goldschmiede
nach den mittelalterlichen Vorbildern ihre eigenen
Entwürfe auszuarbeiten und damit ihre späteren Erfolge
vorzubereiten begannen. — So hatte Statz, der trotz
seiner etwas derben Art und knappen Redeweise, zum
Theil wohl in Folge des ihm eigenen Humors, anzu.
regen verstand, Schule gemacht, obgleich in seinem
Bureau mehr Gehülfen als Schüler nach seinen kurzen
aber bestimmten Angaben zeichneten. Als er anfing,
sich aus dem öffentlichen Wettbewerb und damit aus
dem Verkehr nach und nach zurückzuziehen, um in
gesteigertem Maafse seiner Liebhaberei, der Land-
schafts- und Architekturmalerei sich zu widmen, mit
deren Erzeugnissen er seine und seiner Freunde Mappen
füllte, kamen jüngere Kräfte zur Geltung, die an seinen
Schöpfungen sich gebildet hatten, aber noch mehr an
den alten Denkmälern selbst, nicht gerade so genial
und produktiv, wie er, aber an Ernst mit ihm wett-
eifernd und in der Sorge für die Details hinter ihm
nicht zurückstehend. Schniitg.n.
1898.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
224
dem engen Rahmen aber dieser speziellen Stilart, ihrer
Anordnungen und Auffassungen, entfaltet der Künstler
eine Virtuosität, die alles Lob verdient. Die Liebe,
die ihn an seinen Beruf bindet, das Schaffen, welches
ganz in denselben aufgeht und offenbar sich den Ge-
hülfen mittheilt, bezeichnen den tiefsten Grund dieser
Erfolge, und gerade die Beschränkung auf solche Auf-
gaben, für welche seine Umgebung ihm die besten
Muster an die Hand gibt, hat ihn zum Meister ge-
macht. Möge er fortfahren, sich keine Aufgaben zu
stellen oder stellen zu lassen, die aus diesem Zauber-
kreise heraustreten!
Die Goldschmiede Oediger in Krefeld,
Bausch und van den Wyenbergh in Kevelaer
hatten eine grofse Anzahl kirchlicher Gefässe und
Geräthe zusammengebracht, unter denen mehrere
Kopien die Spitze behaupteten, namentlich ein roma-
nischer Kelch, ein romanisches Kreuz, eine gothische
Tabernakelthür, verschiedene Leuchter und Rauch-
fässer. Von den selbstständigen Arbeiten verdient die
romanische Tabernakelthüre für die St. Rochuskirche
in Düsseldorf wegen ihrer getriebenen Figuren und
sogar wegen ihrer Grubenschmelzverzierungen mit
Anerkennung genannt zu werden, auch die Fassung
eines Missale, beide aus Kevelaer. Manche nament-
lich im letzten Jahrzehnt aus den bekannten Kölner
und Aachener Werkstätten hervorgegangene Arbeiten
würden hier durch die Gegensätzlichkeit die Nothwen-
digkeit der Reform in Bezug auf Gestalt und Technik
um so deutlicher zum Ausdruck gebracht haben.
Bei den Eisenschmieden hielten sich formales
und technisches Können nicht recht das Gleichgewicht,
und wenn de Schmidt in Krefeld seine hervorragende
Herrschaft über das Material durch noch gröfsere
Korrektheit in den Formen an der Hand der alten
Muster zu ergänzen sich entschlösse, so würden seine
Leistungen uneingeschränktes Lob verdienen.
Wenn dieser Bericht, der auf ein kurzes Referat
sich beschränken sollte, unter der Hand gewachsen
und mit dem Urtheil nicht zurückhaltend gewesen ist,
so mag das nur dem Interesse beigemessen werden,
welches der Referent an der Ausstellung genommen
hat, wie dem Bestreben, den strebsamen Ausstellern
einige Erwägungen anheimzugeben, die für die Ent-
wicklung des Kunstzweiges, den sie vertreten, von
Nutzen sein könnten, und damit für sie selbst.
Schnü tgen.
Vincenz Statz f. In seiner Vaterstadt Köln
ist am 21. August im Alter von nahezu 80 Jahren
der Altmeister der Gothik als der letzte von der
alten Ehrengarde des Domes heimgegangen. — Nicht
einer höheren Schule, sondern der Bauhülle, nicht den
Büchern, sondern der Praxis verdankte er seine Aus-
bildung, die er nicht aus entlegenen, oder gar fremd-
artigen Quellen, sondern aus denen seiner unmittelbaren
Umgebung schöpfte. Der Dom und die Minoriten-
kirche zu Köln waren vornehmlich seine Lehrmeister,
und wie er jenem seine konstruktiven Grundsätze als
das unwandelbare Fundament seines ganzen architek-
tonischen Schaffens entnahm, so entlehnte er dieser
die Einfachheit der Anlage wie der Formen. Den
Anschlufs an die Minoritenkirche zeigt namentlich eine
seiner frühesten Schöpfungen, die Pfarrkirche zu Nieder-
mendig, die von den bis dahin üblichen neugothischen
Bauten verwässerter Observanz den höchst erfreulichen
Uebergang zu korrekten Gestaltungen bezeichnet.
Diesen ist Statz sein Leben lang treu geblieben, wenn
auch in der Zeit seiner gröfsten Fruchtbarkeit, von der
Mitte der 50er bis zu der der 60er Jahre, manche seiner
Bauten etwas trocken, einzelne etwas schablonenhaft
erscheinen mögen. Unmittelbar vor dieses Jahrzehnt
(1854) fiel sein Austritt aus der Dombauhütte, un- '
mittelbar nachher (1866) seine Beförderung zum Kö-
niglichen Baurath, dazwischen (1863) seine Ernennung
zum Diözesanbaumeister von Köln. — Unermüdlich
war er im Entwerfen, unerschöpflich in den Formen,
die sich auf den früh- und hochgothischen Stil be-
schränkten, ohne in die romanische Periode zurück-
zugreifen oder in die spätgothische vorzuschreiten.
In diesem rheinischen Stilcharakter des XIII. und XIV.
Jahrh. sind seine räumlich wie baulich bedeutendsten
Kirchenbauten gehalten: die Marienkirche in Aachen,
die Mauritiuskirche in Köln, die Wallfahrtskirche in
Kevelaer, der gewaltige Dom in Linz, der ihm den
Titel ,,Dombaumeister von Linz" eintrug. Seine zahl-
losen kleineren Kirchen und die mancherlei Profan-
bauten, wie verschiedene grosse Konkurrenzpläne, die
zwar prämiirt, aber nicht ausgeführt wurden, tragen fast
ausnahmslos dasselbe Stilgepräge. Der arbeitslustige
Meister begnügte sich aber nicht mit dem Entwerfen
von Bauplänen, sondern auch die Möbel und die ganze
Kirchenausstatlung einschliefslich der hl. Gefässe, zwang
er unter seinen nie ruhenden, mit beispielloser Leichtig-
keit arbeitenden Zeichenstift, worauf ihm der Umstand,
dafs die meisten Kunsthandwerker der damaligen Zeit
noch nicht ordentlich zu zeichnen verstanden, überhaupt
in den Formen noch unsicher waren, einen gewissen
Titel geben mochte. Seine bezüglichen Pläne, die er
zumTheil, wie manche seiner Bauwerke veröffentlicht hat,
die besten in Gemeinschaft mit Ungewitter, bezeich-
neten für ihre Entstehungszeit einen Fortschritt, der
aber nachliefs sich zu behaupten, als einige der aus-
führenden Bildhauer, Maler, Eisen- und Goldschmiede
nach den mittelalterlichen Vorbildern ihre eigenen
Entwürfe auszuarbeiten und damit ihre späteren Erfolge
vorzubereiten begannen. — So hatte Statz, der trotz
seiner etwas derben Art und knappen Redeweise, zum
Theil wohl in Folge des ihm eigenen Humors, anzu.
regen verstand, Schule gemacht, obgleich in seinem
Bureau mehr Gehülfen als Schüler nach seinen kurzen
aber bestimmten Angaben zeichneten. Als er anfing,
sich aus dem öffentlichen Wettbewerb und damit aus
dem Verkehr nach und nach zurückzuziehen, um in
gesteigertem Maafse seiner Liebhaberei, der Land-
schafts- und Architekturmalerei sich zu widmen, mit
deren Erzeugnissen er seine und seiner Freunde Mappen
füllte, kamen jüngere Kräfte zur Geltung, die an seinen
Schöpfungen sich gebildet hatten, aber noch mehr an
den alten Denkmälern selbst, nicht gerade so genial
und produktiv, wie er, aber an Ernst mit ihm wett-
eifernd und in der Sorge für die Details hinter ihm
nicht zurückstehend. Schniitg.n.