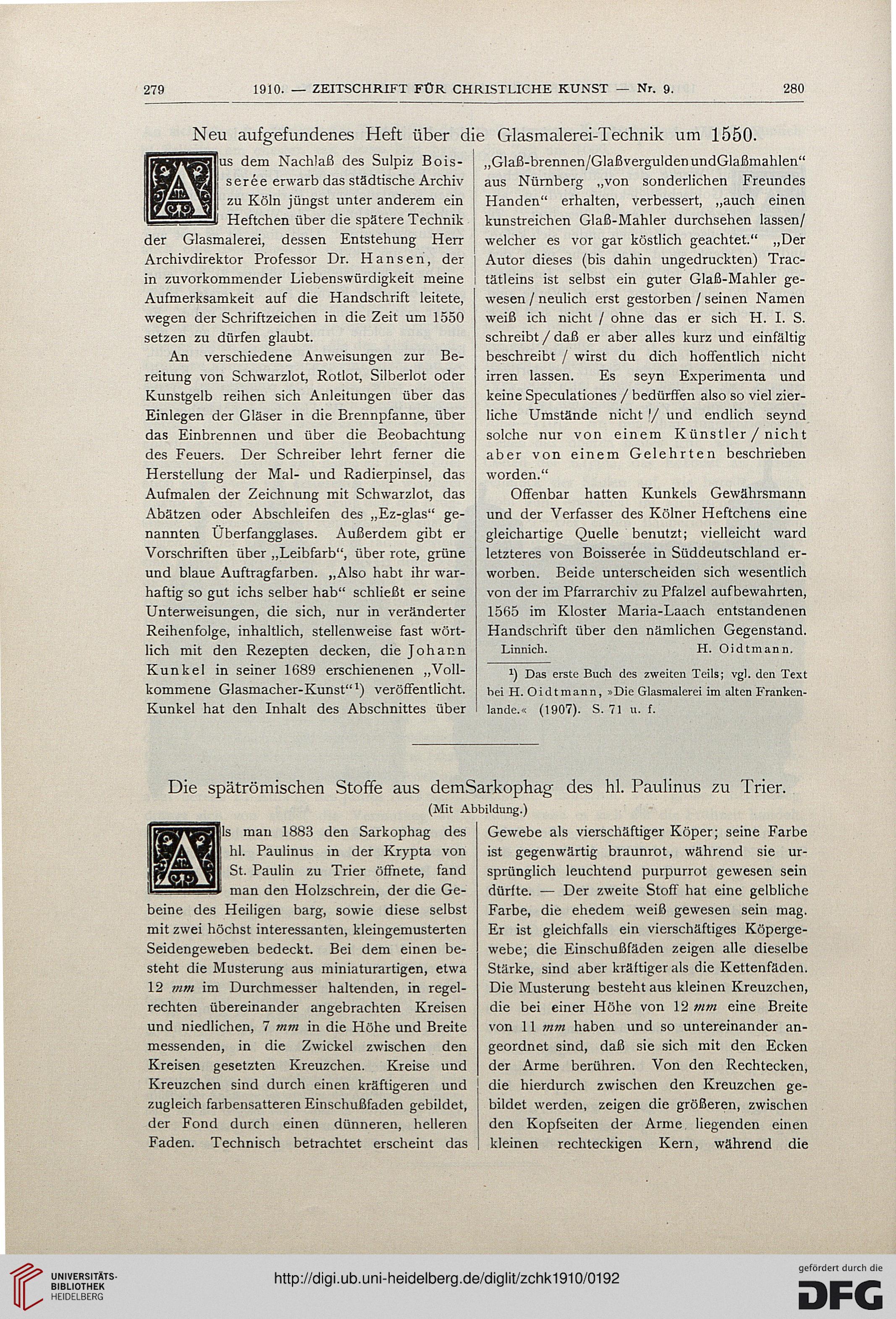279
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 9.
280
Neu aufgefundenes Heft über die Glasmalerei-Technik um 1550.
us dem Nachlaß des Sulpiz Bois-
seree erwarb das städtische Archiv
zu Köln jüngst unter anderem ein
Heftchen über die spätere Technik
der Glasmalerei, dessen Entstehung Herr
Archivdirektor Professor Dr. Hansen, der
in zuvorkommender Liebenswürdigkeit meine
Aufmerksamkeit auf die Handschrift leitete,
wegen der Schriftzeichen in die Zeit um 1550
setzen zu dürfen glaubt.
An verschiedene Anweisungen zur Be-
reitung von Schwarzlot, Rotlot, Silberlot oder
Kunstgelb reihen sich Anleitungen über das
Einlegen der Gläser in die Brennpfanne, über
das Einbrennen und über die Beobachtung
des Feuers. Der Schreiber lehrt ferner die
Herstellung der Mal- und Radierpinsel, das
Aufmalen der Zeichnung mit Schwarzlot, das
Abätzen oder Abschleifen des „Ez-glas" ge-
nannten Überfangglases. Außerdem gibt er
Vorschriften über „Leibfarb", über rote, grüne
und blaue Auftragfarben. „Also habt ihr war-
haftig so gut ichs selber hab" schließt er seine
Unterweisungen, die sich, nur in veränderter
Reihenfolge, inhaltlich, stellenweise fast wört-
lich mit den Rezepten decken, die Johann
Kunkel in seiner 1689 erschienenen „Voll-
kommene Glasmacher-Kunst"1) veröffentlicht.
Kunkel hat den Inhalt des Abschnittes über
„Glaß-brennen/GIaßverguldenundGlaßmahlen"
aus Nürnberg „von sonderlichen Freundes
Händen" erhalten, verbessert, „auch einen
kunstreichen Glaß-Mahler durchsehen lassen/
welcher es vor gar köstlich geachtet." „Der
Autor dieses (bis dahin ungedruckten) Trac-
tätleins ist selbst ein guter Glaß-Mahler ge-
wesen / neulich erst gestorben / seinen Namen
weiß ich nicht / ohne das er sich H. I. S.
schreibt/daß er aber alles kurz und einfältig
beschreibt / wirst du dich hoffentlich nicht
irren lassen. Es seyn Experimenta und
keine Speculationes / bedürffen also so viel zier-
liche Umstände nicht '/ und endlich seynd
solche nur von einem Künstler / nicht
aber von einem Gelehrten beschrieben
worden."
Offenbar hatten Kunkels Gewährsmann
und der Verfasser des Kölner Heftchens eine
gleichartige Quelle benutzt; vielleicht ward
letzteres von Boisseree in Süddeutschland er-
worben. Beide unterscheiden sich wesentlich
von der im Pfarrarchiv zu Pfalzel aufbewahrten,
1565 im Kloster Maria-Laach entstandenen
Handschrift über den nämlichen Gegenstand.
Linnich. H. Oidtmann.
J) Das erste Buch des zweiten Teils; vgl. den Text
hei H. Oidtmann, »Die Glasmalerei im alten Franken-
lande.« (1907). S. 71 u. f.
Die spätrömischen Stoffe aus demSarkophag des hl. Paulinus zu Trier,
(Mit Abbildung.)
RH ls man 1883 den Sarkophag des
hl. Paulinus in der Krypta von
St. Paulin zu Trier öffnete, fand
man den Holzschrein, der die Ge-
beine des Heiligen barg, sowie diese selbst
mit zwei höchst interessanten, kleingemusterten
Seidengeweben bedeckt. Bei dem einen be-
steht die Musterung aus miniaturartigen, etwa
12 mm im Durchmesser haltenden, in regel-
rechten übereinander angebrachten Kreisen
und niedlichen, 7 mm in die Höhe und Breite
messenden, in die Zwickel zwischen den
Kreisen gesetzten Kreuzchen. Kreise und
Gewebe als vierschäftiger Köper; seine Farbe
ist gegenwärtig braunrot, während sie ur-
sprünglich leuchtend purpurrot gewesen sein
dürfte. — Der zweite Stoff hat eine gelbliche
Farbe, die ehedem weiß gewesen sein mag.
Er ist gleichfalls ein vierschäftiges Köperge-
webe; die Einschußfäden zeigen alle dieselbe
Stärke, sind aber kräftiger als die Kettenfäden.
Die Musterung besteht aus kleinen Kreuzchen,
die bei einer Höhe von 12 mm eine Breite
von 11 mm haben und so untereinander an-
geordnet sind, daß sie sich mit den Ecken
der Arme berühren. Von den Rechtecken,
Kreuzchen sind durch einen kräftigeren und die hierdurch zwischen den Kreuzchen ge
zugleich farbensatteren Einschußfäden gebildet,
der Fond durch einen dünneren, helleren
Faden. Technisch betrachtet erscheint das
bildet werden, zeigen die größeren, zwischen
den Kopfseiten der Arme liegenden einen
kleinen rechteckigen Kern, während die
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 9.
280
Neu aufgefundenes Heft über die Glasmalerei-Technik um 1550.
us dem Nachlaß des Sulpiz Bois-
seree erwarb das städtische Archiv
zu Köln jüngst unter anderem ein
Heftchen über die spätere Technik
der Glasmalerei, dessen Entstehung Herr
Archivdirektor Professor Dr. Hansen, der
in zuvorkommender Liebenswürdigkeit meine
Aufmerksamkeit auf die Handschrift leitete,
wegen der Schriftzeichen in die Zeit um 1550
setzen zu dürfen glaubt.
An verschiedene Anweisungen zur Be-
reitung von Schwarzlot, Rotlot, Silberlot oder
Kunstgelb reihen sich Anleitungen über das
Einlegen der Gläser in die Brennpfanne, über
das Einbrennen und über die Beobachtung
des Feuers. Der Schreiber lehrt ferner die
Herstellung der Mal- und Radierpinsel, das
Aufmalen der Zeichnung mit Schwarzlot, das
Abätzen oder Abschleifen des „Ez-glas" ge-
nannten Überfangglases. Außerdem gibt er
Vorschriften über „Leibfarb", über rote, grüne
und blaue Auftragfarben. „Also habt ihr war-
haftig so gut ichs selber hab" schließt er seine
Unterweisungen, die sich, nur in veränderter
Reihenfolge, inhaltlich, stellenweise fast wört-
lich mit den Rezepten decken, die Johann
Kunkel in seiner 1689 erschienenen „Voll-
kommene Glasmacher-Kunst"1) veröffentlicht.
Kunkel hat den Inhalt des Abschnittes über
„Glaß-brennen/GIaßverguldenundGlaßmahlen"
aus Nürnberg „von sonderlichen Freundes
Händen" erhalten, verbessert, „auch einen
kunstreichen Glaß-Mahler durchsehen lassen/
welcher es vor gar köstlich geachtet." „Der
Autor dieses (bis dahin ungedruckten) Trac-
tätleins ist selbst ein guter Glaß-Mahler ge-
wesen / neulich erst gestorben / seinen Namen
weiß ich nicht / ohne das er sich H. I. S.
schreibt/daß er aber alles kurz und einfältig
beschreibt / wirst du dich hoffentlich nicht
irren lassen. Es seyn Experimenta und
keine Speculationes / bedürffen also so viel zier-
liche Umstände nicht '/ und endlich seynd
solche nur von einem Künstler / nicht
aber von einem Gelehrten beschrieben
worden."
Offenbar hatten Kunkels Gewährsmann
und der Verfasser des Kölner Heftchens eine
gleichartige Quelle benutzt; vielleicht ward
letzteres von Boisseree in Süddeutschland er-
worben. Beide unterscheiden sich wesentlich
von der im Pfarrarchiv zu Pfalzel aufbewahrten,
1565 im Kloster Maria-Laach entstandenen
Handschrift über den nämlichen Gegenstand.
Linnich. H. Oidtmann.
J) Das erste Buch des zweiten Teils; vgl. den Text
hei H. Oidtmann, »Die Glasmalerei im alten Franken-
lande.« (1907). S. 71 u. f.
Die spätrömischen Stoffe aus demSarkophag des hl. Paulinus zu Trier,
(Mit Abbildung.)
RH ls man 1883 den Sarkophag des
hl. Paulinus in der Krypta von
St. Paulin zu Trier öffnete, fand
man den Holzschrein, der die Ge-
beine des Heiligen barg, sowie diese selbst
mit zwei höchst interessanten, kleingemusterten
Seidengeweben bedeckt. Bei dem einen be-
steht die Musterung aus miniaturartigen, etwa
12 mm im Durchmesser haltenden, in regel-
rechten übereinander angebrachten Kreisen
und niedlichen, 7 mm in die Höhe und Breite
messenden, in die Zwickel zwischen den
Kreisen gesetzten Kreuzchen. Kreise und
Gewebe als vierschäftiger Köper; seine Farbe
ist gegenwärtig braunrot, während sie ur-
sprünglich leuchtend purpurrot gewesen sein
dürfte. — Der zweite Stoff hat eine gelbliche
Farbe, die ehedem weiß gewesen sein mag.
Er ist gleichfalls ein vierschäftiges Köperge-
webe; die Einschußfäden zeigen alle dieselbe
Stärke, sind aber kräftiger als die Kettenfäden.
Die Musterung besteht aus kleinen Kreuzchen,
die bei einer Höhe von 12 mm eine Breite
von 11 mm haben und so untereinander an-
geordnet sind, daß sie sich mit den Ecken
der Arme berühren. Von den Rechtecken,
Kreuzchen sind durch einen kräftigeren und die hierdurch zwischen den Kreuzchen ge
zugleich farbensatteren Einschußfäden gebildet,
der Fond durch einen dünneren, helleren
Faden. Technisch betrachtet erscheint das
bildet werden, zeigen die größeren, zwischen
den Kopfseiten der Arme liegenden einen
kleinen rechteckigen Kern, während die