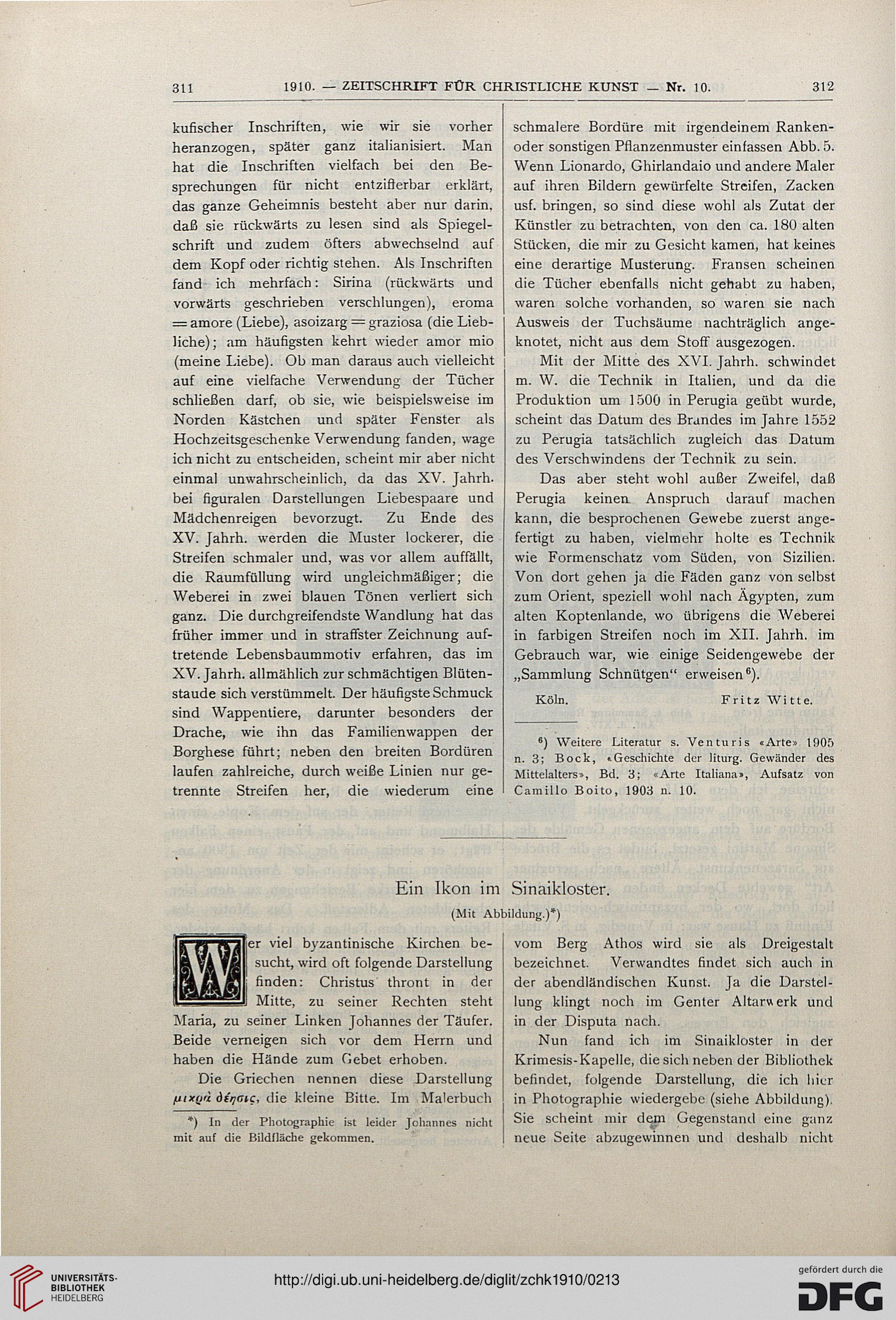311
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 10.
312
kufischer Inschriften, wie wir sie vorher
heranzogen, später ganz italianisiert. Man
hat die Inschriften vielfach bei den Be-
sprechungen für nicht entzifferbar erklärt,
das ganze Geheimnis besteht aber nur darin,
daß sie rückwärts zu lesen sind als Spiegel-
schrift und zudem öfters abwechselnd auf
dem Kopf oder richtig stehen. Als Inschriften
fand ich mehrfach: Sirina (rückwärts und
vorwärts geschrieben verschlungen), eroma
= amore (Liebe), asoizarg = graziosa (die Lieb-
liche) ; am häufigsten kehrt wieder amor mio
(meine Liebe). Ob man daraus auch vielleicht
auf eine vielfache Verwendung der Tücher
schließen darf, ob sie, wie beispielsweise im
Norden Kästchen und später Fenster als
Hochzeitsgeschenke Verwendung fanden, wage
ich nicht zu entscheiden, scheint mir aber nicht
einmal unwahrscheinlich, da das XV. Jahrh.
bei figuralen Darstellungen Liebespaare und
Mädchenreigen bevorzugt. Zu Ende des
XV. Jahrh. werden die Muster lockerer, die
Streifen schmaler und, was vor allem auffällt,
die Raumfüllung wird ungleichmäßiger; die
Weberei in zwei blauen Tönen verliert sich
ganz. Die durchgreifendste Wandlung hat das
früher immer und in straffster Zeichnung auf-
tretende Lebensbaummotiv erfahren, das im
XV. Jahrh. allmählich zur schmächtigen Blüten-
staude sich verstümmelt. Der häufigste Schmuck
sind Wappentiere, darunter besonders der
Drache, wie ihn das Familienwappen der
Borghese führt; neben den breiten Bordüren
laufen zahlreiche, durch weiße Linien nur ge-
trennte Streifen her, die wiederum eine
schmalere Bordüre mit irgendeinem Ranken-
oder sonstigen Pflanzenmuster einfassen Abb. 5.
Wenn Lionardo, Ghirlandaio und andere Maler
auf ihren Bildern gewürfelte Streifen, Zacken
usf. bringen, so sind diese wohl als Zutat der
Künstler zu betrachten, von den ca. 180 alten
Stücken, die mir zu Gesicht kamen, hat keines
eine derartige Musterung. Fransen scheinen
die Tücher ebenfalls nicht gehabt zu haben,
waren solche vorhanden, so waren sie nach
Ausweis der Tuchsäume nachträglich ange-
knotet, nicht aus dem Stoff ausgezogen.
Mit der Mitte des XVI. Jahrh. schwindet
m. W. die Technik in Italien, und da die
Produktion um 1500 in Perugia geübt wurde,
scheint das Datum des Brandes im Jahre 1552
zu Perugia tatsächlich zugleich das Datum
des Verschwindens der Technik zu sein.
Das aber steht wohl außer Zweifel, daß
Perugia keinen Anspruch darauf machen
kann, die besprochenen Gewebe zuerst ange-
fertigt zu haben, vielmehr holte es Technik
wie Formenschatz vom Süden, von Sizilien.
Von dort gehen ja die Fäden ganz von selbst
zum Orient, speziell wohl nach Ägypten, zum
alten Koptenlande, wo übrigens die Weberei
in farbigen Streifen noch im XII. Jahrh. im
Gebrauch war, wie einige Seidengewebe der
„Sammlung Schnütgen" erweisen6).
Köln. Fritz Witte.
6) Weitere Literatur s. Venturis «Arte» 190!)
n. 3; Bock, «Geschichte der Hturg. Gewänder des
Mittelalters», Bd. 3; «Arte Italiana», Aufsatz von
Camillo Boito, 1903 n. 10.
Ein Ikon im Sinaikloster.
(Mit Abbildung.)*)
er viel byzantinische Kirchen be-
sucht, wird oft folgende Darstellung
finden: Christus' thront in der
Mitte, zu seiner Rechten steht
Maria, zu seiner Linken Johannes der Täufer.
Beide verneigen sich vor dem Herrn und
haben die Hände zum Gebet erhoben.
Die Griechen nennen diese Darstellung
fjixyri dtijan:, die kleine Bitte. Im Malerbuch
*) In der Photographie ist leider Johannes nicht
mit auf die Bildfläche gekommen.
vom Berg Athos wird sie als Dreigestalt
bezeichnet. Verwandtes findet sich auch in
der abendländischen Kunst. Ja die Darstel-
lung klingt noch im Genter Altarwerk und
in der Disputa nach.
Nun fand ich im Sinaikloster in der
Krimesis-Kapelle, die sich neben der Bibliothek
befindet, folgende Darstellung, die ich hier
in Photographie wiedergebe (siehe Abbildung).
Sie scheint mir dem Gegenstand eine ganz
neue Seite abzugewinnen und deshalb nicht
1910. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 10.
312
kufischer Inschriften, wie wir sie vorher
heranzogen, später ganz italianisiert. Man
hat die Inschriften vielfach bei den Be-
sprechungen für nicht entzifferbar erklärt,
das ganze Geheimnis besteht aber nur darin,
daß sie rückwärts zu lesen sind als Spiegel-
schrift und zudem öfters abwechselnd auf
dem Kopf oder richtig stehen. Als Inschriften
fand ich mehrfach: Sirina (rückwärts und
vorwärts geschrieben verschlungen), eroma
= amore (Liebe), asoizarg = graziosa (die Lieb-
liche) ; am häufigsten kehrt wieder amor mio
(meine Liebe). Ob man daraus auch vielleicht
auf eine vielfache Verwendung der Tücher
schließen darf, ob sie, wie beispielsweise im
Norden Kästchen und später Fenster als
Hochzeitsgeschenke Verwendung fanden, wage
ich nicht zu entscheiden, scheint mir aber nicht
einmal unwahrscheinlich, da das XV. Jahrh.
bei figuralen Darstellungen Liebespaare und
Mädchenreigen bevorzugt. Zu Ende des
XV. Jahrh. werden die Muster lockerer, die
Streifen schmaler und, was vor allem auffällt,
die Raumfüllung wird ungleichmäßiger; die
Weberei in zwei blauen Tönen verliert sich
ganz. Die durchgreifendste Wandlung hat das
früher immer und in straffster Zeichnung auf-
tretende Lebensbaummotiv erfahren, das im
XV. Jahrh. allmählich zur schmächtigen Blüten-
staude sich verstümmelt. Der häufigste Schmuck
sind Wappentiere, darunter besonders der
Drache, wie ihn das Familienwappen der
Borghese führt; neben den breiten Bordüren
laufen zahlreiche, durch weiße Linien nur ge-
trennte Streifen her, die wiederum eine
schmalere Bordüre mit irgendeinem Ranken-
oder sonstigen Pflanzenmuster einfassen Abb. 5.
Wenn Lionardo, Ghirlandaio und andere Maler
auf ihren Bildern gewürfelte Streifen, Zacken
usf. bringen, so sind diese wohl als Zutat der
Künstler zu betrachten, von den ca. 180 alten
Stücken, die mir zu Gesicht kamen, hat keines
eine derartige Musterung. Fransen scheinen
die Tücher ebenfalls nicht gehabt zu haben,
waren solche vorhanden, so waren sie nach
Ausweis der Tuchsäume nachträglich ange-
knotet, nicht aus dem Stoff ausgezogen.
Mit der Mitte des XVI. Jahrh. schwindet
m. W. die Technik in Italien, und da die
Produktion um 1500 in Perugia geübt wurde,
scheint das Datum des Brandes im Jahre 1552
zu Perugia tatsächlich zugleich das Datum
des Verschwindens der Technik zu sein.
Das aber steht wohl außer Zweifel, daß
Perugia keinen Anspruch darauf machen
kann, die besprochenen Gewebe zuerst ange-
fertigt zu haben, vielmehr holte es Technik
wie Formenschatz vom Süden, von Sizilien.
Von dort gehen ja die Fäden ganz von selbst
zum Orient, speziell wohl nach Ägypten, zum
alten Koptenlande, wo übrigens die Weberei
in farbigen Streifen noch im XII. Jahrh. im
Gebrauch war, wie einige Seidengewebe der
„Sammlung Schnütgen" erweisen6).
Köln. Fritz Witte.
6) Weitere Literatur s. Venturis «Arte» 190!)
n. 3; Bock, «Geschichte der Hturg. Gewänder des
Mittelalters», Bd. 3; «Arte Italiana», Aufsatz von
Camillo Boito, 1903 n. 10.
Ein Ikon im Sinaikloster.
(Mit Abbildung.)*)
er viel byzantinische Kirchen be-
sucht, wird oft folgende Darstellung
finden: Christus' thront in der
Mitte, zu seiner Rechten steht
Maria, zu seiner Linken Johannes der Täufer.
Beide verneigen sich vor dem Herrn und
haben die Hände zum Gebet erhoben.
Die Griechen nennen diese Darstellung
fjixyri dtijan:, die kleine Bitte. Im Malerbuch
*) In der Photographie ist leider Johannes nicht
mit auf die Bildfläche gekommen.
vom Berg Athos wird sie als Dreigestalt
bezeichnet. Verwandtes findet sich auch in
der abendländischen Kunst. Ja die Darstel-
lung klingt noch im Genter Altarwerk und
in der Disputa nach.
Nun fand ich im Sinaikloster in der
Krimesis-Kapelle, die sich neben der Bibliothek
befindet, folgende Darstellung, die ich hier
in Photographie wiedergebe (siehe Abbildung).
Sie scheint mir dem Gegenstand eine ganz
neue Seite abzugewinnen und deshalb nicht