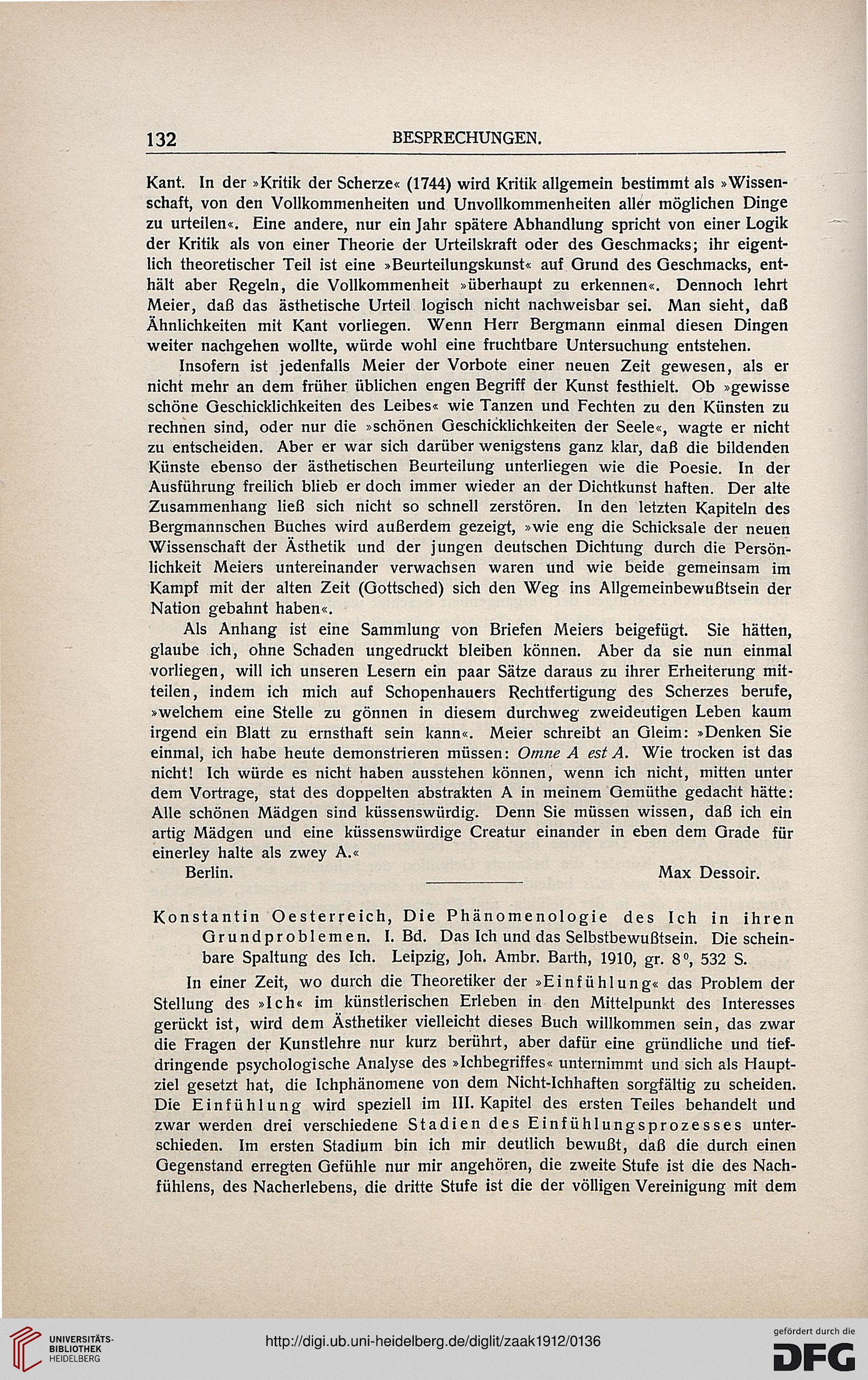132 BESPRECHUNGEN.
Kant. In der »Kritik der Scherze« (1744) wird Kritik allgemein bestimmt als »Wissen-
schaft, von den Vollkommenheiten und Unvollkommenheiten aller möglichen Dinge
zu urteilen«. Eine andere, nur ein Jahr spätere Abhandlung spricht von einer Logik
der Kritik als von einer Theorie der Urteilskraft oder des Geschmacks; ihr eigent-
lich theoretischer Teil ist eine »Beurteilungskunst« auf Grund des Geschmacks, ent-
hält aber Regeln, die Vollkommenheit »überhaupt zu erkennen«. Dennoch lehrt
Meier, daß das ästhetische Urteil logisch nicht nachweisbar sei. Man sieht, daß
Ähnlichkeiten mit Kant vorliegen. Wenn Herr Bergmann einmal diesen Dingen
weiter nachgehen wollte, würde wohl eine fruchtbare Untersuchung entstehen.
Insofern ist jedenfalls Meier der Vorbote einer neuen Zeit gewesen, als er
nicht mehr an dem früher üblichen engen Begriff der Kunst festhielt. Ob »gewisse
schöne Geschicklichkeiten des Leibes« wie Tanzen und Fechten zu den Künsten zu
rechnen sind, oder nur die »schönen Geschicklichkeiten der Seele«, wagte er nicht
zu entscheiden. Aber er war sich darüber wenigstens ganz klar, daß die bildenden
Künste ebenso der ästhetischen Beurteilung unterliegen wie die Poesie. In der
Ausführung freilich blieb er doch immer wieder an der Dichtkunst haften. Der alte
Zusammenhang ließ sich nicht so schnell zerstören. In den letzten Kapiteln des
Bergmannschen Buches wird außerdem gezeigt, »wie eng die Schicksale der neuen
Wissenschaft der Ästhetik und der jungen deutschen Dichtung durch die Persön-
lichkeit Meiers untereinander verwachsen waren und wie beide gemeinsam im
Kampf mit der alten Zeit (Gottsched) sich den Weg ins Allgemeinbewußtsein der
Nation gebahnt haben«.
Als Anhang ist eine Sammlung von Briefen Meiers beigefügt. Sie hätten,
glaube ich, ohne Schaden ungedruckt bleiben können. Aber da sie nun einmal
vorliegen, will ich unseren Lesern ein paar Sätze daraus zu ihrer Erheiterung mit-
teilen, indem ich mich auf Schopenhauers Rechtfertigung des Scherzes berufe,
»welchem eine Stelle zu gönnen in diesem durchweg zweideutigen Leben kaum
irgend ein Blatt zu ernsthaft sein kann«. Meier schreibt an Gleim: »Denken Sie
einmal, ich habe heute demonstrieren müssen: Omne A est A. Wie trocken ist das
nicht! Ich würde es nicht haben ausstehen können, wenn ich nicht, mitten unter
dem Vortrage, stat des doppelten abstrakten A in meinem Gemüthe gedacht hätte:
Alle schönen Mädgen sind küssenswürdig. Denn Sie müssen wissen, daß ich ein
artig Mädgen und eine küssenswürdige Creatur einander in eben dem Grade für
einerley halte als zwey A.«
Berlin. ___________ Max Dessoir.
Konstantin Oesterreich, Die Phänomenologie des Ich in ihren
Grundproblemen. I. Bd. Das Ich und das Selbstbewußtsein. Die schein-
bare Spaltung des Ich. Leipzig, Joh. Ambr. Barth, 1910, gr. 8°, 532 S.
In einer Zeit, wo durch die Theoretiker der »Einfühlung« das Problem der
Stellung des »Ich« im künstlerischen Erleben in den Mittelpunkt des Interesses
gerückt ist, wird dem Ästhetiker vielleicht dieses Buch willkommen sein, das zwar
die Fragen der Kunstlehre nur kurz berührt, aber dafür eine gründliche und tief-
dringende psychologische Analyse des »Ichbegriffes« unternimmt und sich als Haupt-
ziel gesetzt hat, die Ichphänomene von dem Nicht-Ichhaften sorgfältig zu scheiden.
Die Einfühlung wird speziell im III. Kapitel des ersten Teiles behandelt und
zwar werden drei verschiedene Stadien des Einfühlungsprozesses unter-
schieden. Im ersten Stadium bin ich mir deutlich bewußt, daß die durch einen
Gegenstand erregten Gefühle nur mir angehören, die zweite Stufe ist die des Nach-
fühlens, des Nacherlebens, die dritte Stufe ist die der völligen Vereinigung mit dem
Kant. In der »Kritik der Scherze« (1744) wird Kritik allgemein bestimmt als »Wissen-
schaft, von den Vollkommenheiten und Unvollkommenheiten aller möglichen Dinge
zu urteilen«. Eine andere, nur ein Jahr spätere Abhandlung spricht von einer Logik
der Kritik als von einer Theorie der Urteilskraft oder des Geschmacks; ihr eigent-
lich theoretischer Teil ist eine »Beurteilungskunst« auf Grund des Geschmacks, ent-
hält aber Regeln, die Vollkommenheit »überhaupt zu erkennen«. Dennoch lehrt
Meier, daß das ästhetische Urteil logisch nicht nachweisbar sei. Man sieht, daß
Ähnlichkeiten mit Kant vorliegen. Wenn Herr Bergmann einmal diesen Dingen
weiter nachgehen wollte, würde wohl eine fruchtbare Untersuchung entstehen.
Insofern ist jedenfalls Meier der Vorbote einer neuen Zeit gewesen, als er
nicht mehr an dem früher üblichen engen Begriff der Kunst festhielt. Ob »gewisse
schöne Geschicklichkeiten des Leibes« wie Tanzen und Fechten zu den Künsten zu
rechnen sind, oder nur die »schönen Geschicklichkeiten der Seele«, wagte er nicht
zu entscheiden. Aber er war sich darüber wenigstens ganz klar, daß die bildenden
Künste ebenso der ästhetischen Beurteilung unterliegen wie die Poesie. In der
Ausführung freilich blieb er doch immer wieder an der Dichtkunst haften. Der alte
Zusammenhang ließ sich nicht so schnell zerstören. In den letzten Kapiteln des
Bergmannschen Buches wird außerdem gezeigt, »wie eng die Schicksale der neuen
Wissenschaft der Ästhetik und der jungen deutschen Dichtung durch die Persön-
lichkeit Meiers untereinander verwachsen waren und wie beide gemeinsam im
Kampf mit der alten Zeit (Gottsched) sich den Weg ins Allgemeinbewußtsein der
Nation gebahnt haben«.
Als Anhang ist eine Sammlung von Briefen Meiers beigefügt. Sie hätten,
glaube ich, ohne Schaden ungedruckt bleiben können. Aber da sie nun einmal
vorliegen, will ich unseren Lesern ein paar Sätze daraus zu ihrer Erheiterung mit-
teilen, indem ich mich auf Schopenhauers Rechtfertigung des Scherzes berufe,
»welchem eine Stelle zu gönnen in diesem durchweg zweideutigen Leben kaum
irgend ein Blatt zu ernsthaft sein kann«. Meier schreibt an Gleim: »Denken Sie
einmal, ich habe heute demonstrieren müssen: Omne A est A. Wie trocken ist das
nicht! Ich würde es nicht haben ausstehen können, wenn ich nicht, mitten unter
dem Vortrage, stat des doppelten abstrakten A in meinem Gemüthe gedacht hätte:
Alle schönen Mädgen sind küssenswürdig. Denn Sie müssen wissen, daß ich ein
artig Mädgen und eine küssenswürdige Creatur einander in eben dem Grade für
einerley halte als zwey A.«
Berlin. ___________ Max Dessoir.
Konstantin Oesterreich, Die Phänomenologie des Ich in ihren
Grundproblemen. I. Bd. Das Ich und das Selbstbewußtsein. Die schein-
bare Spaltung des Ich. Leipzig, Joh. Ambr. Barth, 1910, gr. 8°, 532 S.
In einer Zeit, wo durch die Theoretiker der »Einfühlung« das Problem der
Stellung des »Ich« im künstlerischen Erleben in den Mittelpunkt des Interesses
gerückt ist, wird dem Ästhetiker vielleicht dieses Buch willkommen sein, das zwar
die Fragen der Kunstlehre nur kurz berührt, aber dafür eine gründliche und tief-
dringende psychologische Analyse des »Ichbegriffes« unternimmt und sich als Haupt-
ziel gesetzt hat, die Ichphänomene von dem Nicht-Ichhaften sorgfältig zu scheiden.
Die Einfühlung wird speziell im III. Kapitel des ersten Teiles behandelt und
zwar werden drei verschiedene Stadien des Einfühlungsprozesses unter-
schieden. Im ersten Stadium bin ich mir deutlich bewußt, daß die durch einen
Gegenstand erregten Gefühle nur mir angehören, die zweite Stufe ist die des Nach-
fühlens, des Nacherlebens, die dritte Stufe ist die der völligen Vereinigung mit dem