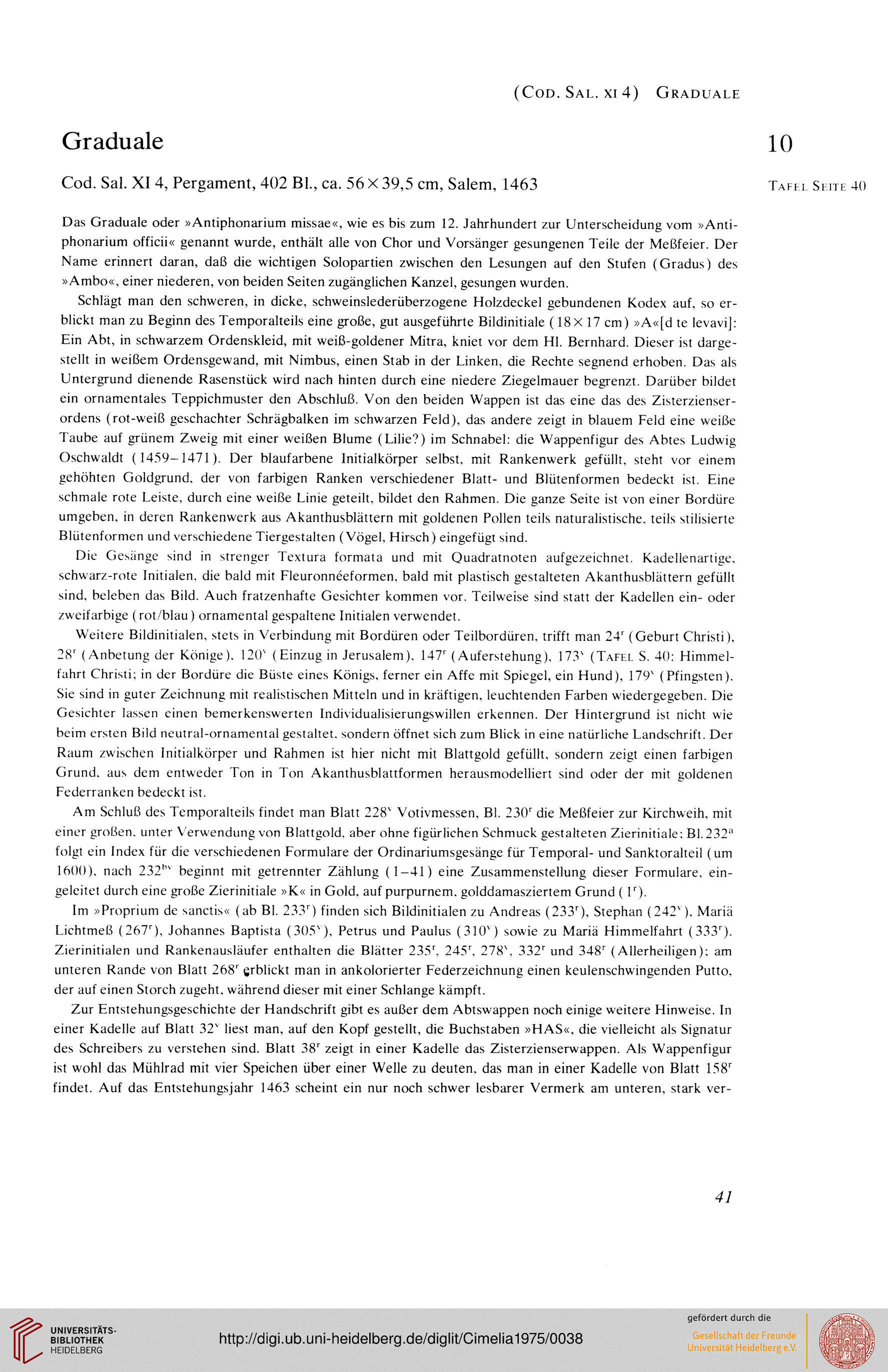(Cod. Sal. xi 4) Graduale
Gr aduale 10
Cod. Sal. XI 4, Pergament, 402 Bl., ca. 56 X 39,5 cm, Salem, 1463 Tafel Seite 40
Das Graduale oder »Antiphonarium missae«, wie es bis zum 12. Jahrhundert zur Unterscheidung vom »Anti-
phonarium officii« genannt wurde, enthält alle von Chor und Vorsänger gesungenen Teile der Meßfeier. Der
Name erinnert daran, daß die wichtigen Solopartien zwischen den Lesungen auf den Stufen (Gradus) des
»Ambo«, einer niederen, von beiden Seiten zugänglichen Kanzel, gesungen wurden.
Schlägt man den schweren, in dicke, schweinslederüberzogene Holzdeckel gebundenen Kodex auf, so er-
blickt man zu Beginn des Temporalteils eine große, gut ausgeführte Bildinitiale (18X 17 cm) »A«[d te levavij:
Ein Abt, in schwarzem Ordenskleid, mit weiß-goldener Mitra, kniet vor dem Hl. Bernhard. Dieser ist darge-
stellt in weißem Ordensgewand, mit Nimbus, einen Stab in der Linken, die Rechte segnend erhoben. Das als
Untergrund dienende Rasenstück wird nach hinten durch eine niedere Ziegelmauer begrenzt. Darüber bildet
ein ornamentales Teppichmuster den Abschluß. Von den beiden Wappen ist das eine das des Zisterzienser-
ordens (rot-weiß geschachter Schrägbalken im schwarzen Feld), das andere zeigt in blauem Feld eine weiße
Taube auf grünem Zweig mit einer weißen Blume (Lilie?) im Schnabel: die Wappenfigur des Abtes Ludwig
Oschwaldt (1459-1471). Der blaufarbene Initialkörper selbst, mit Rankenwerk gefüllt, steht vor einem
gehöhten Goldgrund, der von farbigen Ranken verschiedener Blatt- und Blütenformen bedeckt ist. Eine
schmale rote Leiste, durch eine weiße Linie geteilt, bildet den Rahmen. Die ganze Seite ist von einer Bordüre
umgeben, in deren Rankenwerk aus Akanthusblättern mit goldenen Pollen teils naturalistische, teils stilisierte
Blütenformen und verschiedene Tiergestalten (Vögel, Hirsch) eingefügt sind.
Die Gesänge sind in strenger Textura formata und mit Quadratnoten aufgezeichnet. Kadellenartige,
schwarz-rote Initialen, die bald mit Fleuronneeformen, bald mit plastisch gestalteten Akanthusblättern gefüllt
sind, beleben das Bild. Auch fratzenhafte Gesichter kommen vor. Teilweise sind statt der Kadellen ein- oder
zweifarbige (rot/blau) ornamental gespaltene Initialen verwendet.
Weitere Bildinitialen, stets in Verbindung mit Bordüren oder Teilbordüren, trifft man 24r (Geburt Christi),
28r (Anbetung der Könige). 120' (Einzug in Jerusalem). 147r (Auferstehung), 173v (Tafel S. 40: Himmel-
fahrt Christi; in der Bordüre die Büste eines Königs, ferner ein Affe mit Spiegel, ein Hund), 179v (Pfingsten).
Sie sind in guter Zeichnung mit realistischen Mitteln und in kräftigen, leuchtenden Farben wiedergegeben. Die
Gesichter lassen einen bemerkenswerten Individualisierungswillen erkennen. Der Hintergrund ist nicht wie
beim ersten Bild neutral-ornamental gestaltet, sondern öffnet sich zum Blick in eine natürliche Landschrift. Der
Raum zwischen Initialkörper und Rahmen ist hier nicht mit Blattgold gefüllt, sondern zeigt einen farbigen
Grund, aus dem entweder Ton in Ton Akanthusblattformen herausmodelliert sind oder der mit goldenen
Federranken bedeckt ist.
Am Schluß des Temporalteils findet man Blatt 228v Votivmessen, Bl. 230r die Meßfeier zur Kirchweih, mit
einer großen, unter Verwendung von Blattgold, aber ohne figürlichen Schmuck gestalteten Zierinitiale; Bl. 232a
folgt ein Index für die verschiedenen Formulare der Ordinariumsgesänge für Temporal- und Sanktoralteil (um
1600), nach 232bv beginnt mit getrennter Zählung (1-41) eine Zusammenstellung dieser Formulare, ein-
geleitet durch eine große Zierinitiale »K« in Gold, auf purpurnem, golddamasziertem Grund (lr)-
Im »Proprium de sanctis« (ab Bl. 233') finden sich Bildinitialen zu Andreas (233r), Stephan (242v), Maria
Lichtmeß (267r), Johannes Baptista (305v), Petrus und Paulus (310v) sowie zu Maria Himmelfahrt (333r).
Zierinitialen und Rankenausläufer enthalten die Blätter 235r, 245r, 278\ 332r und 348r (Allerheiligen); am
unteren Rande von Blatt 268r erblickt man in ankolorierter Federzeichnung einen keulenschwingenden Putto.
der auf einen Storch zugeht, während dieser mit einer Schlange kämpft.
Zur Entstehungsgeschichte der Handschrift gibt es außer dem Abtswappen noch einige weitere Hinweise. In
einer Kadelle auf Blatt 32v liest man, auf den Kopf gestellt, die Buchstaben »HAS«, die vielleicht als Signatur
des Schreibers zu verstehen sind. Blatt 38r zeigt in einer Kadelle das Zisterzienserwappen. Als Wappenfigur
ist wohl das Mühlrad mit vier Speichen über einer Welle zu deuten, das man in einer Kadelle von Blatt 158r
findet. Auf das Entstehungsjahr 1463 scheint ein nur noch schwer lesbarer Vermerk am unteren, stark ver-
41
Gr aduale 10
Cod. Sal. XI 4, Pergament, 402 Bl., ca. 56 X 39,5 cm, Salem, 1463 Tafel Seite 40
Das Graduale oder »Antiphonarium missae«, wie es bis zum 12. Jahrhundert zur Unterscheidung vom »Anti-
phonarium officii« genannt wurde, enthält alle von Chor und Vorsänger gesungenen Teile der Meßfeier. Der
Name erinnert daran, daß die wichtigen Solopartien zwischen den Lesungen auf den Stufen (Gradus) des
»Ambo«, einer niederen, von beiden Seiten zugänglichen Kanzel, gesungen wurden.
Schlägt man den schweren, in dicke, schweinslederüberzogene Holzdeckel gebundenen Kodex auf, so er-
blickt man zu Beginn des Temporalteils eine große, gut ausgeführte Bildinitiale (18X 17 cm) »A«[d te levavij:
Ein Abt, in schwarzem Ordenskleid, mit weiß-goldener Mitra, kniet vor dem Hl. Bernhard. Dieser ist darge-
stellt in weißem Ordensgewand, mit Nimbus, einen Stab in der Linken, die Rechte segnend erhoben. Das als
Untergrund dienende Rasenstück wird nach hinten durch eine niedere Ziegelmauer begrenzt. Darüber bildet
ein ornamentales Teppichmuster den Abschluß. Von den beiden Wappen ist das eine das des Zisterzienser-
ordens (rot-weiß geschachter Schrägbalken im schwarzen Feld), das andere zeigt in blauem Feld eine weiße
Taube auf grünem Zweig mit einer weißen Blume (Lilie?) im Schnabel: die Wappenfigur des Abtes Ludwig
Oschwaldt (1459-1471). Der blaufarbene Initialkörper selbst, mit Rankenwerk gefüllt, steht vor einem
gehöhten Goldgrund, der von farbigen Ranken verschiedener Blatt- und Blütenformen bedeckt ist. Eine
schmale rote Leiste, durch eine weiße Linie geteilt, bildet den Rahmen. Die ganze Seite ist von einer Bordüre
umgeben, in deren Rankenwerk aus Akanthusblättern mit goldenen Pollen teils naturalistische, teils stilisierte
Blütenformen und verschiedene Tiergestalten (Vögel, Hirsch) eingefügt sind.
Die Gesänge sind in strenger Textura formata und mit Quadratnoten aufgezeichnet. Kadellenartige,
schwarz-rote Initialen, die bald mit Fleuronneeformen, bald mit plastisch gestalteten Akanthusblättern gefüllt
sind, beleben das Bild. Auch fratzenhafte Gesichter kommen vor. Teilweise sind statt der Kadellen ein- oder
zweifarbige (rot/blau) ornamental gespaltene Initialen verwendet.
Weitere Bildinitialen, stets in Verbindung mit Bordüren oder Teilbordüren, trifft man 24r (Geburt Christi),
28r (Anbetung der Könige). 120' (Einzug in Jerusalem). 147r (Auferstehung), 173v (Tafel S. 40: Himmel-
fahrt Christi; in der Bordüre die Büste eines Königs, ferner ein Affe mit Spiegel, ein Hund), 179v (Pfingsten).
Sie sind in guter Zeichnung mit realistischen Mitteln und in kräftigen, leuchtenden Farben wiedergegeben. Die
Gesichter lassen einen bemerkenswerten Individualisierungswillen erkennen. Der Hintergrund ist nicht wie
beim ersten Bild neutral-ornamental gestaltet, sondern öffnet sich zum Blick in eine natürliche Landschrift. Der
Raum zwischen Initialkörper und Rahmen ist hier nicht mit Blattgold gefüllt, sondern zeigt einen farbigen
Grund, aus dem entweder Ton in Ton Akanthusblattformen herausmodelliert sind oder der mit goldenen
Federranken bedeckt ist.
Am Schluß des Temporalteils findet man Blatt 228v Votivmessen, Bl. 230r die Meßfeier zur Kirchweih, mit
einer großen, unter Verwendung von Blattgold, aber ohne figürlichen Schmuck gestalteten Zierinitiale; Bl. 232a
folgt ein Index für die verschiedenen Formulare der Ordinariumsgesänge für Temporal- und Sanktoralteil (um
1600), nach 232bv beginnt mit getrennter Zählung (1-41) eine Zusammenstellung dieser Formulare, ein-
geleitet durch eine große Zierinitiale »K« in Gold, auf purpurnem, golddamasziertem Grund (lr)-
Im »Proprium de sanctis« (ab Bl. 233') finden sich Bildinitialen zu Andreas (233r), Stephan (242v), Maria
Lichtmeß (267r), Johannes Baptista (305v), Petrus und Paulus (310v) sowie zu Maria Himmelfahrt (333r).
Zierinitialen und Rankenausläufer enthalten die Blätter 235r, 245r, 278\ 332r und 348r (Allerheiligen); am
unteren Rande von Blatt 268r erblickt man in ankolorierter Federzeichnung einen keulenschwingenden Putto.
der auf einen Storch zugeht, während dieser mit einer Schlange kämpft.
Zur Entstehungsgeschichte der Handschrift gibt es außer dem Abtswappen noch einige weitere Hinweise. In
einer Kadelle auf Blatt 32v liest man, auf den Kopf gestellt, die Buchstaben »HAS«, die vielleicht als Signatur
des Schreibers zu verstehen sind. Blatt 38r zeigt in einer Kadelle das Zisterzienserwappen. Als Wappenfigur
ist wohl das Mühlrad mit vier Speichen über einer Welle zu deuten, das man in einer Kadelle von Blatt 158r
findet. Auf das Entstehungsjahr 1463 scheint ein nur noch schwer lesbarer Vermerk am unteren, stark ver-
41