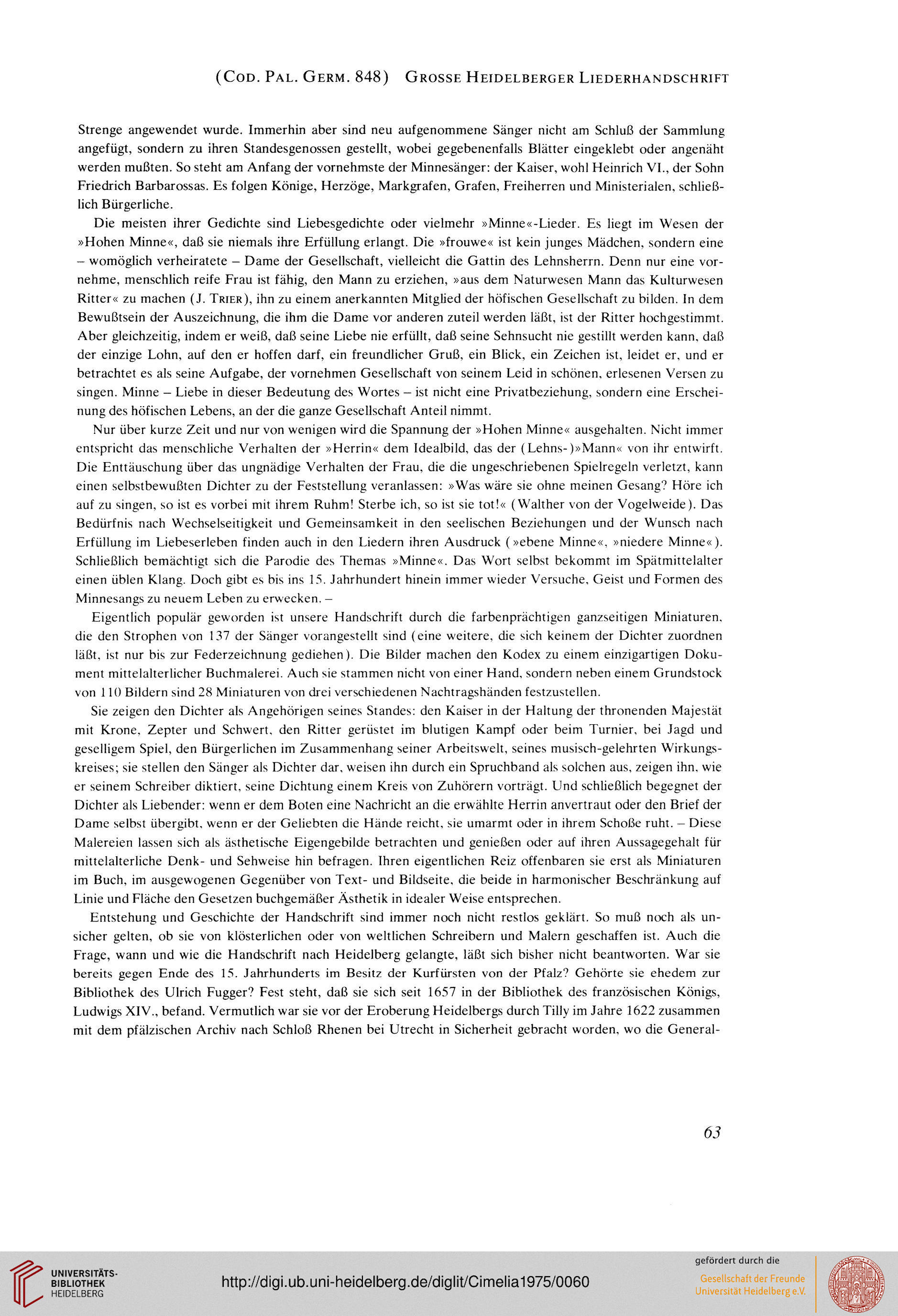(Cod. Pal. Germ. 848) Grosse Heidelberger Liederhandschrift
Strenge angewendet wurde. Immerhin aber sind neu aufgenommene Sänger nicht am Schluß der Sammlung
angefügt, sondern zu ihren Standesgenossen gestellt, wobei gegebenenfalls Blätter eingeklebt oder angenäht
werden mußten. So steht am Anfang der vornehmste der Minnesänger: der Kaiser, wohl Heinrich VI., der Sohn
Friedrich Barbarossas. Es folgen Könige, Herzöge, Markgrafen, Grafen, Freiherren und Ministerialen, schließ-
lich Bürgerliche.
Die meisten ihrer Gedichte sind Liebesgedichte oder vielmehr »Minne«-Lieder. Es liegt im Wesen der
»Hohen Minne«, daß sie niemals ihre Erfüllung erlangt. Die »frouwe« ist kein junges Mädchen, sondern eine
- womöglich verheiratete - Dame der Gesellschaft, vielleicht die Gattin des Lehnsherrn. Denn nur eine vor-
nehme, menschlich reife Frau ist fähig, den Mann zu erziehen, »aus dem Naturwesen Mann das Kulturwesen
Ritter« zu machen (J. Trier), ihn zu einem anerkannten Mitglied der höfischen Gesellschaft zu bilden. In dem
Bewußtsein der Auszeichnung, die ihm die Dame vor anderen zuteil werden läßt, ist der Ritter hochgestimmt.
Aber gleichzeitig, indem er weiß, daß seine Liebe nie erfüllt, daß seine Sehnsucht nie gestillt werden kann, daß
der einzige Lohn, auf den er hoffen darf, ein freundlicher Gruß, ein Blick, ein Zeichen ist, leidet er, und er
betrachtet es als seine Aufgabe, der vornehmen Gesellschaft von seinem Leid in schönen, erlesenen Versen zu
singen. Minne - Liebe in dieser Bedeutung des Wortes - ist nicht eine Privatbeziehung, sondern eine Erschei-
nung des höfischen Lebens, an der die ganze Gesellschaft Anteil nimmt.
Nur über kurze Zeit und nur von wenigen wird die Spannung der »Hohen Minne« ausgehalten. Nicht immer
entspricht das menschliche Verhalten der »Herrin« dem Idealbild, das der (Lehns-)»Mann« von ihr entwirft.
Die Enttäuschung über das ungnädige Verhalten der Frau, die die ungeschriebenen Spielregeln verletzt, kann
einen selbstbewußten Dichter zu der Feststellung veranlassen: »Was wäre sie ohne meinen Gesang? Höre ich
auf zu singen, so ist es vorbei mit ihrem Ruhm! Sterbe ich, so ist sie tot!« (Walther von der Vogelweide). Das
Bedürfnis nach Wechselseitigkeit und Gemeinsamkeit in den seelischen Beziehungen und der Wunsch nach
Erfüllung im Liebeserleben finden auch in den Liedern ihren Ausdruck (»ebene Minne«, »niedere Minne«).
Schließlich bemächtigt sich die Parodie des Themas »Minne«. Das Wort selbst bekommt im Spätmittelalter
einen üblen Klang. Doch gibt es bis ins 15. Jahrhundert hinein immer wieder Versuche, Geist und Formen des
Minnesangs zu neuem Leben zu erwecken. -
Eigentlich populär geworden ist unsere Handschrift durch die farbenprächtigen ganzseitigen Miniaturen,
die den Strophen von 137 der Sänger vorangestellt sind (eine weitere, die sich keinem der Dichter zuordnen
läßt, ist nur bis zur Federzeichnung gediehen). Die Bilder machen den Kodex zu einem einzigartigen Doku-
ment mittelalterlicher Buchmalerei. Auch sie stammen nicht von einer Hand, sondern neben einem Grundstock
von 110 Bildern sind 28 Miniaturen von drei verschiedenen Nachtragshänden festzustellen.
Sie zeigen den Dichter als Angehörigen seines Standes: den Kaiser in der Haltung der thronenden Majestät
mit Krone, Zepter und Schwert, den Ritter gerüstet im blutigen Kampf oder beim Turnier, bei Jagd und
geselligem Spiel, den Bürgerlichen im Zusammenhang seiner Arbeitswelt, seines musisch-gelehrten Wirkungs-
kreises; sie stellen den Sänger als Dichter dar, weisen ihn durch ein Spruchband als solchen aus, zeigen ihn, wie
er seinem Schreiber diktiert, seine Dichtung einem Kreis von Zuhörern vorträgt. Und schließlich begegnet der
Dichter als Liebender: wenn er dem Boten eine Nachricht an die erwählte Herrin anvertraut oder den Brief der
Dame selbst übergibt, wenn er der Geliebten die Hände reicht, sie umarmt oder in ihrem Schöße ruht. - Diese
Malereien lassen sich als ästhetische Eigengebilde betrachten und genießen oder auf ihren Aussagegehalt für
mittelalterliche Denk- und Sehweise hin befragen. Ihren eigentlichen Reiz offenbaren sie erst als Miniaturen
im Buch, im ausgewogenen Gegenüber von Text- und Bildseite, die beide in harmonischer Beschränkung auf
Linie und Fläche den Gesetzen buchgemäßer Ästhetik in idealer Weise entsprechen.
Entstehung und Geschichte der Handschrift sind immer noch nicht restlos geklärt. So muß noch als un-
sicher gelten, ob sie von klösterlichen oder von weltlichen Schreibern und Malern geschaffen ist. Auch die
Frage, wann und wie die Handschrift nach Heidelberg gelangte, läßt sich bisher nicht beantworten. War sie
bereits gegen Ende des 15. Jahrhunderts im Besitz der Kurfürsten von der Pfalz? Gehörte sie ehedem zur
Bibliothek des Ulrich Fugger? Fest steht, daß sie sich seit 1657 in der Bibliothek des französischen Königs,
Ludwigs XIV., befand. Vermutlich war sie vor der Eroberung Heidelbergs durch Tilly im Jahre 1622 zusammen
mit dem pfälzischen Archiv nach Schloß Rhenen bei Utrecht in Sicherheit gebracht worden, wo die General-
63
Strenge angewendet wurde. Immerhin aber sind neu aufgenommene Sänger nicht am Schluß der Sammlung
angefügt, sondern zu ihren Standesgenossen gestellt, wobei gegebenenfalls Blätter eingeklebt oder angenäht
werden mußten. So steht am Anfang der vornehmste der Minnesänger: der Kaiser, wohl Heinrich VI., der Sohn
Friedrich Barbarossas. Es folgen Könige, Herzöge, Markgrafen, Grafen, Freiherren und Ministerialen, schließ-
lich Bürgerliche.
Die meisten ihrer Gedichte sind Liebesgedichte oder vielmehr »Minne«-Lieder. Es liegt im Wesen der
»Hohen Minne«, daß sie niemals ihre Erfüllung erlangt. Die »frouwe« ist kein junges Mädchen, sondern eine
- womöglich verheiratete - Dame der Gesellschaft, vielleicht die Gattin des Lehnsherrn. Denn nur eine vor-
nehme, menschlich reife Frau ist fähig, den Mann zu erziehen, »aus dem Naturwesen Mann das Kulturwesen
Ritter« zu machen (J. Trier), ihn zu einem anerkannten Mitglied der höfischen Gesellschaft zu bilden. In dem
Bewußtsein der Auszeichnung, die ihm die Dame vor anderen zuteil werden läßt, ist der Ritter hochgestimmt.
Aber gleichzeitig, indem er weiß, daß seine Liebe nie erfüllt, daß seine Sehnsucht nie gestillt werden kann, daß
der einzige Lohn, auf den er hoffen darf, ein freundlicher Gruß, ein Blick, ein Zeichen ist, leidet er, und er
betrachtet es als seine Aufgabe, der vornehmen Gesellschaft von seinem Leid in schönen, erlesenen Versen zu
singen. Minne - Liebe in dieser Bedeutung des Wortes - ist nicht eine Privatbeziehung, sondern eine Erschei-
nung des höfischen Lebens, an der die ganze Gesellschaft Anteil nimmt.
Nur über kurze Zeit und nur von wenigen wird die Spannung der »Hohen Minne« ausgehalten. Nicht immer
entspricht das menschliche Verhalten der »Herrin« dem Idealbild, das der (Lehns-)»Mann« von ihr entwirft.
Die Enttäuschung über das ungnädige Verhalten der Frau, die die ungeschriebenen Spielregeln verletzt, kann
einen selbstbewußten Dichter zu der Feststellung veranlassen: »Was wäre sie ohne meinen Gesang? Höre ich
auf zu singen, so ist es vorbei mit ihrem Ruhm! Sterbe ich, so ist sie tot!« (Walther von der Vogelweide). Das
Bedürfnis nach Wechselseitigkeit und Gemeinsamkeit in den seelischen Beziehungen und der Wunsch nach
Erfüllung im Liebeserleben finden auch in den Liedern ihren Ausdruck (»ebene Minne«, »niedere Minne«).
Schließlich bemächtigt sich die Parodie des Themas »Minne«. Das Wort selbst bekommt im Spätmittelalter
einen üblen Klang. Doch gibt es bis ins 15. Jahrhundert hinein immer wieder Versuche, Geist und Formen des
Minnesangs zu neuem Leben zu erwecken. -
Eigentlich populär geworden ist unsere Handschrift durch die farbenprächtigen ganzseitigen Miniaturen,
die den Strophen von 137 der Sänger vorangestellt sind (eine weitere, die sich keinem der Dichter zuordnen
läßt, ist nur bis zur Federzeichnung gediehen). Die Bilder machen den Kodex zu einem einzigartigen Doku-
ment mittelalterlicher Buchmalerei. Auch sie stammen nicht von einer Hand, sondern neben einem Grundstock
von 110 Bildern sind 28 Miniaturen von drei verschiedenen Nachtragshänden festzustellen.
Sie zeigen den Dichter als Angehörigen seines Standes: den Kaiser in der Haltung der thronenden Majestät
mit Krone, Zepter und Schwert, den Ritter gerüstet im blutigen Kampf oder beim Turnier, bei Jagd und
geselligem Spiel, den Bürgerlichen im Zusammenhang seiner Arbeitswelt, seines musisch-gelehrten Wirkungs-
kreises; sie stellen den Sänger als Dichter dar, weisen ihn durch ein Spruchband als solchen aus, zeigen ihn, wie
er seinem Schreiber diktiert, seine Dichtung einem Kreis von Zuhörern vorträgt. Und schließlich begegnet der
Dichter als Liebender: wenn er dem Boten eine Nachricht an die erwählte Herrin anvertraut oder den Brief der
Dame selbst übergibt, wenn er der Geliebten die Hände reicht, sie umarmt oder in ihrem Schöße ruht. - Diese
Malereien lassen sich als ästhetische Eigengebilde betrachten und genießen oder auf ihren Aussagegehalt für
mittelalterliche Denk- und Sehweise hin befragen. Ihren eigentlichen Reiz offenbaren sie erst als Miniaturen
im Buch, im ausgewogenen Gegenüber von Text- und Bildseite, die beide in harmonischer Beschränkung auf
Linie und Fläche den Gesetzen buchgemäßer Ästhetik in idealer Weise entsprechen.
Entstehung und Geschichte der Handschrift sind immer noch nicht restlos geklärt. So muß noch als un-
sicher gelten, ob sie von klösterlichen oder von weltlichen Schreibern und Malern geschaffen ist. Auch die
Frage, wann und wie die Handschrift nach Heidelberg gelangte, läßt sich bisher nicht beantworten. War sie
bereits gegen Ende des 15. Jahrhunderts im Besitz der Kurfürsten von der Pfalz? Gehörte sie ehedem zur
Bibliothek des Ulrich Fugger? Fest steht, daß sie sich seit 1657 in der Bibliothek des französischen Königs,
Ludwigs XIV., befand. Vermutlich war sie vor der Eroberung Heidelbergs durch Tilly im Jahre 1622 zusammen
mit dem pfälzischen Archiv nach Schloß Rhenen bei Utrecht in Sicherheit gebracht worden, wo die General-
63