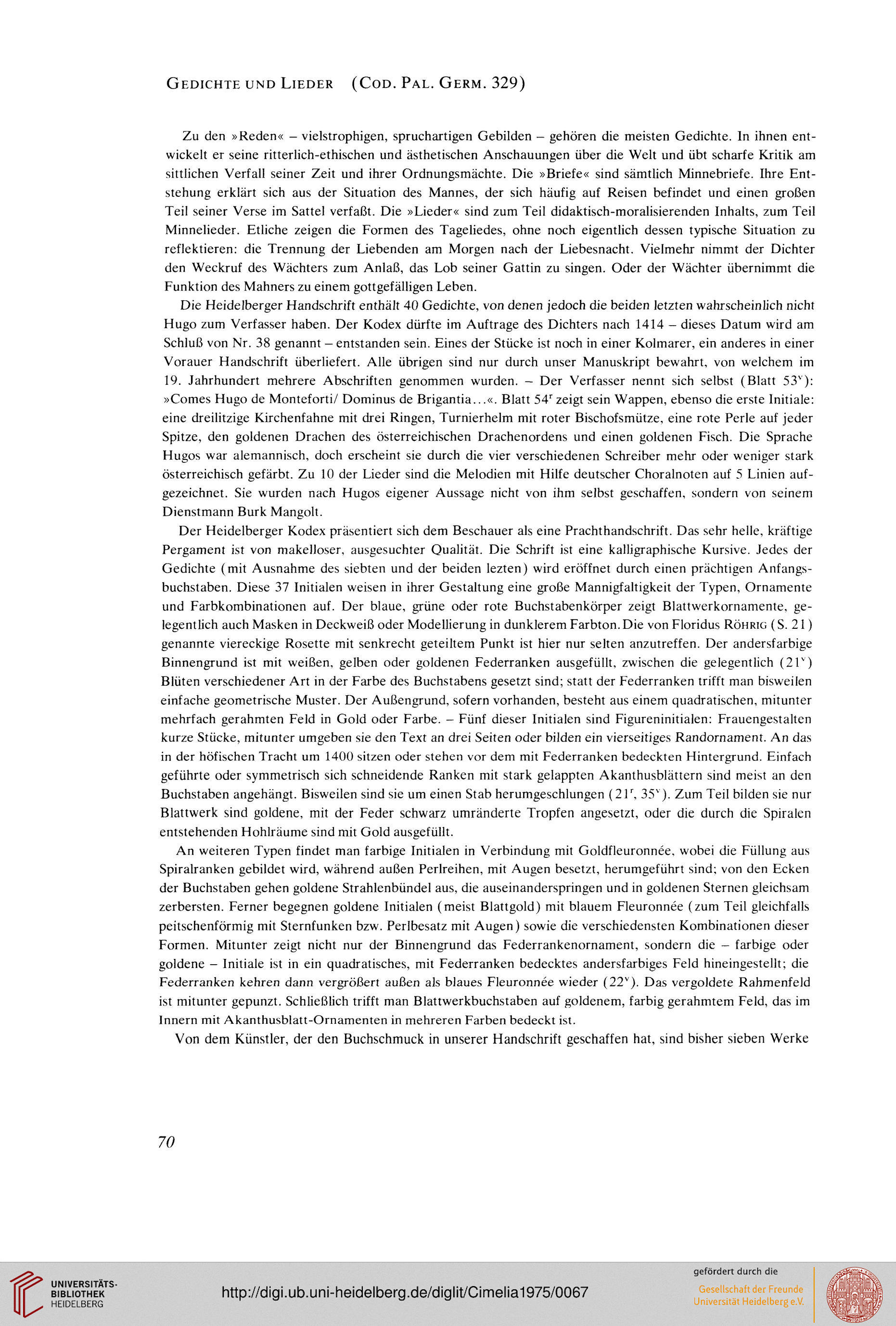Gedichte und Lieder (Cod. Pal. Germ. 329)
Zu den »Reden« - vielstrophigen, spruchartigen Gebilden - gehören die meisten Gedichte. In ihnen ent-
wickelt er seine ritterlich-ethischen und ästhetischen Anschauungen über die Welt und übt scharfe Kritik am
sittlichen Verfall seiner Zeit und ihrer Ordnungsmächte. Die »Briefe« sind sämtlich Minnebriefe. Ihre Ent-
stehung erklärt sich aus der Situation des Mannes, der sich häufig auf Reisen befindet und einen großen
Teil seiner Verse im Sattel verfaßt. Die »Lieder« sind zum Teil didaktisch-moralisierenden Inhalts, zum Teil
Minnelieder. Etliche zeigen die Formen des Tageliedes, ohne noch eigentlich dessen typische Situation zu
reflektieren: die Trennung der Liebenden am Morgen nach der Liebesnacht. Vielmehr nimmt der Dichter
den Weckruf des Wächters zum Anlaß, das Lob seiner Gattin zu singen. Oder der Wächter übernimmt die
Funktion des Mahners zu einem gottgefälligen Leben.
Die Heidelberger Handschrift enthält 40 Gedichte, von denen jedoch die beiden letzten wahrscheinlich nicht
Hugo zum Verfasser haben. Der Kodex dürfte im Auftrage des Dichters nach 1414 - dieses Datum wird am
Schluß von Nr. 38 genannt — entstanden sein. Eines der Stücke ist noch in einer Kolmarer, ein anderes in einer
Vorauer Handschrift überliefert. Alle übrigen sind nur durch unser Manuskript bewahrt, von welchem im
19. Jahrhundert mehrere Abschriften genommen wurden. — Der Verfasser nennt sich selbst (Blatt 53v):
»Comes Hugo de Monteforti/ Dominus de Brigantia...«. Blatt 54r zeigt sein Wappen, ebenso die erste Initiale:
eine dreilitzige Kirchenfahne mit drei Ringen, Turnierhelm mit roter Bischofsmütze, eine rote Perle auf jeder
Spitze, den goldenen Drachen des österreichischen Drachenordens und einen goldenen Fisch. Die Sprache
Hugos war alemannisch, doch erscheint sie durch die vier verschiedenen Schreiber mehr oder weniger stark
österreichisch gefärbt. Zu 10 der Lieder sind die Melodien mit Hilfe deutscher Choralnoten auf 5 Linien auf-
gezeichnet. Sie wurden nach Hugos eigener Aussage nicht von ihm selbst geschaffen, sondern von seinem
Dienstmann Burk Mangolt.
Der Heidelberger Kodex präsentiert sich dem Beschauer als eine Prachthandschrift. Das sehr helle, kräftige
Pergament ist von makelloser, ausgesuchter Qualität. Die Schrift ist eine kalligraphische Kursive. Jedes der
Gedichte (mit Ausnahme des siebten und der beiden lezten) wird eröffnet durch einen prächtigen Anfangs-
buchstaben. Diese 37 Initialen weisen in ihrer Gestaltung eine große Mannigfaltigkeit der Typen, Ornamente
und Farbkombinationen auf. Der blaue, grüne oder rote Buchstabenkörper zeigt Blattwerkornamente, ge-
legentlich auch Masken in Deckweiß oder Modellierung in dunklerem Farbton.Die von Floridus Röhrig (S. 21)
genannte viereckige Rosette mit senkrecht geteiltem Punkt ist hier nur selten anzutreffen. Der andersfarbige
Binnengrund ist mit weißen, gelben oder goldenen Federranken ausgefüllt, zwischen die gelegentlich (21v)
Blüten verschiedener Art in der Farbe des Buchstabens gesetzt sind; statt der Federranken trifft man bisweilen
einfache geometrische Muster. Der Außengrund, sofern vorhanden, besteht aus einem quadratischen, mitunter
mehrfach gerahmten Feld in Gold oder Farbe. - Fünf dieser Initialen sind Figureninitialen: Frauengestalten
kurze Stücke, mitunter umgeben sie den Text an drei Seiten oder bilden ein vierseitiges Randornament. An das
in der höfischen Tracht um 1400 sitzen oder stehen vor dem mit Federranken bedeckten Hintergrund. Einfach
geführte oder symmetrisch sich schneidende Ranken mit stark gelappten Akanthusblättern sind meist an den
Buchstaben angehängt. Bisweilen sind sie um einen Stab herumgeschlungen (21r, 35v). Zum Teil bilden sie nur
Blattwerk sind goldene, mit der Feder schwarz umränderte Tropfen angesetzt, oder die durch die Spiralen
entstehenden Hohlräume sind mit Gold ausgefüllt.
An weiteren Typen findet man farbige Initialen in Verbindung mit Goldfleuronnee, wobei die Füllung aus
Spiralranken gebildet wird, während außen Perlreihen, mit Augen besetzt, herumgeführt sind; von den Ecken
der Buchstaben gehen goldene Strahlenbündel aus, die auseinanderspringen und in goldenen Sternen gleichsam
zerbersten. Ferner begegnen goldene Initialen (meist Blattgold) mit blauem Fleuronnee (zum Teil gleichfalls
peitschenförmig mit Sternfunken bzw. Perlbesatz mit Augen) sowie die verschiedensten Kombinationen dieser
Formen. Mitunter zeigt nicht nur der Binnengrund das Federrankenornament, sondern die - farbige oder
goldene - Initiale ist in ein quadratisches, mit Federranken bedecktes andersfarbiges Feld hineingestellt; die
Federranken kehren dann vergrößert außen als blaues Fleuronnee wieder (22v). Das vergoldete Rahmenfeld
ist mitunter gepunzt. Schließlich trifft man Blattwerkbuchstaben auf goldenem, farbig gerahmtem Feld, das im
Innern mit Akanthusblatt-Ornamenten in mehreren Farben bedeckt ist.
Von dem Künstler, der den Buchschmuck in unserer Handschrift geschaffen hat, sind bisher sieben Werke
70
Zu den »Reden« - vielstrophigen, spruchartigen Gebilden - gehören die meisten Gedichte. In ihnen ent-
wickelt er seine ritterlich-ethischen und ästhetischen Anschauungen über die Welt und übt scharfe Kritik am
sittlichen Verfall seiner Zeit und ihrer Ordnungsmächte. Die »Briefe« sind sämtlich Minnebriefe. Ihre Ent-
stehung erklärt sich aus der Situation des Mannes, der sich häufig auf Reisen befindet und einen großen
Teil seiner Verse im Sattel verfaßt. Die »Lieder« sind zum Teil didaktisch-moralisierenden Inhalts, zum Teil
Minnelieder. Etliche zeigen die Formen des Tageliedes, ohne noch eigentlich dessen typische Situation zu
reflektieren: die Trennung der Liebenden am Morgen nach der Liebesnacht. Vielmehr nimmt der Dichter
den Weckruf des Wächters zum Anlaß, das Lob seiner Gattin zu singen. Oder der Wächter übernimmt die
Funktion des Mahners zu einem gottgefälligen Leben.
Die Heidelberger Handschrift enthält 40 Gedichte, von denen jedoch die beiden letzten wahrscheinlich nicht
Hugo zum Verfasser haben. Der Kodex dürfte im Auftrage des Dichters nach 1414 - dieses Datum wird am
Schluß von Nr. 38 genannt — entstanden sein. Eines der Stücke ist noch in einer Kolmarer, ein anderes in einer
Vorauer Handschrift überliefert. Alle übrigen sind nur durch unser Manuskript bewahrt, von welchem im
19. Jahrhundert mehrere Abschriften genommen wurden. — Der Verfasser nennt sich selbst (Blatt 53v):
»Comes Hugo de Monteforti/ Dominus de Brigantia...«. Blatt 54r zeigt sein Wappen, ebenso die erste Initiale:
eine dreilitzige Kirchenfahne mit drei Ringen, Turnierhelm mit roter Bischofsmütze, eine rote Perle auf jeder
Spitze, den goldenen Drachen des österreichischen Drachenordens und einen goldenen Fisch. Die Sprache
Hugos war alemannisch, doch erscheint sie durch die vier verschiedenen Schreiber mehr oder weniger stark
österreichisch gefärbt. Zu 10 der Lieder sind die Melodien mit Hilfe deutscher Choralnoten auf 5 Linien auf-
gezeichnet. Sie wurden nach Hugos eigener Aussage nicht von ihm selbst geschaffen, sondern von seinem
Dienstmann Burk Mangolt.
Der Heidelberger Kodex präsentiert sich dem Beschauer als eine Prachthandschrift. Das sehr helle, kräftige
Pergament ist von makelloser, ausgesuchter Qualität. Die Schrift ist eine kalligraphische Kursive. Jedes der
Gedichte (mit Ausnahme des siebten und der beiden lezten) wird eröffnet durch einen prächtigen Anfangs-
buchstaben. Diese 37 Initialen weisen in ihrer Gestaltung eine große Mannigfaltigkeit der Typen, Ornamente
und Farbkombinationen auf. Der blaue, grüne oder rote Buchstabenkörper zeigt Blattwerkornamente, ge-
legentlich auch Masken in Deckweiß oder Modellierung in dunklerem Farbton.Die von Floridus Röhrig (S. 21)
genannte viereckige Rosette mit senkrecht geteiltem Punkt ist hier nur selten anzutreffen. Der andersfarbige
Binnengrund ist mit weißen, gelben oder goldenen Federranken ausgefüllt, zwischen die gelegentlich (21v)
Blüten verschiedener Art in der Farbe des Buchstabens gesetzt sind; statt der Federranken trifft man bisweilen
einfache geometrische Muster. Der Außengrund, sofern vorhanden, besteht aus einem quadratischen, mitunter
mehrfach gerahmten Feld in Gold oder Farbe. - Fünf dieser Initialen sind Figureninitialen: Frauengestalten
kurze Stücke, mitunter umgeben sie den Text an drei Seiten oder bilden ein vierseitiges Randornament. An das
in der höfischen Tracht um 1400 sitzen oder stehen vor dem mit Federranken bedeckten Hintergrund. Einfach
geführte oder symmetrisch sich schneidende Ranken mit stark gelappten Akanthusblättern sind meist an den
Buchstaben angehängt. Bisweilen sind sie um einen Stab herumgeschlungen (21r, 35v). Zum Teil bilden sie nur
Blattwerk sind goldene, mit der Feder schwarz umränderte Tropfen angesetzt, oder die durch die Spiralen
entstehenden Hohlräume sind mit Gold ausgefüllt.
An weiteren Typen findet man farbige Initialen in Verbindung mit Goldfleuronnee, wobei die Füllung aus
Spiralranken gebildet wird, während außen Perlreihen, mit Augen besetzt, herumgeführt sind; von den Ecken
der Buchstaben gehen goldene Strahlenbündel aus, die auseinanderspringen und in goldenen Sternen gleichsam
zerbersten. Ferner begegnen goldene Initialen (meist Blattgold) mit blauem Fleuronnee (zum Teil gleichfalls
peitschenförmig mit Sternfunken bzw. Perlbesatz mit Augen) sowie die verschiedensten Kombinationen dieser
Formen. Mitunter zeigt nicht nur der Binnengrund das Federrankenornament, sondern die - farbige oder
goldene - Initiale ist in ein quadratisches, mit Federranken bedecktes andersfarbiges Feld hineingestellt; die
Federranken kehren dann vergrößert außen als blaues Fleuronnee wieder (22v). Das vergoldete Rahmenfeld
ist mitunter gepunzt. Schließlich trifft man Blattwerkbuchstaben auf goldenem, farbig gerahmtem Feld, das im
Innern mit Akanthusblatt-Ornamenten in mehreren Farben bedeckt ist.
Von dem Künstler, der den Buchschmuck in unserer Handschrift geschaffen hat, sind bisher sieben Werke
70