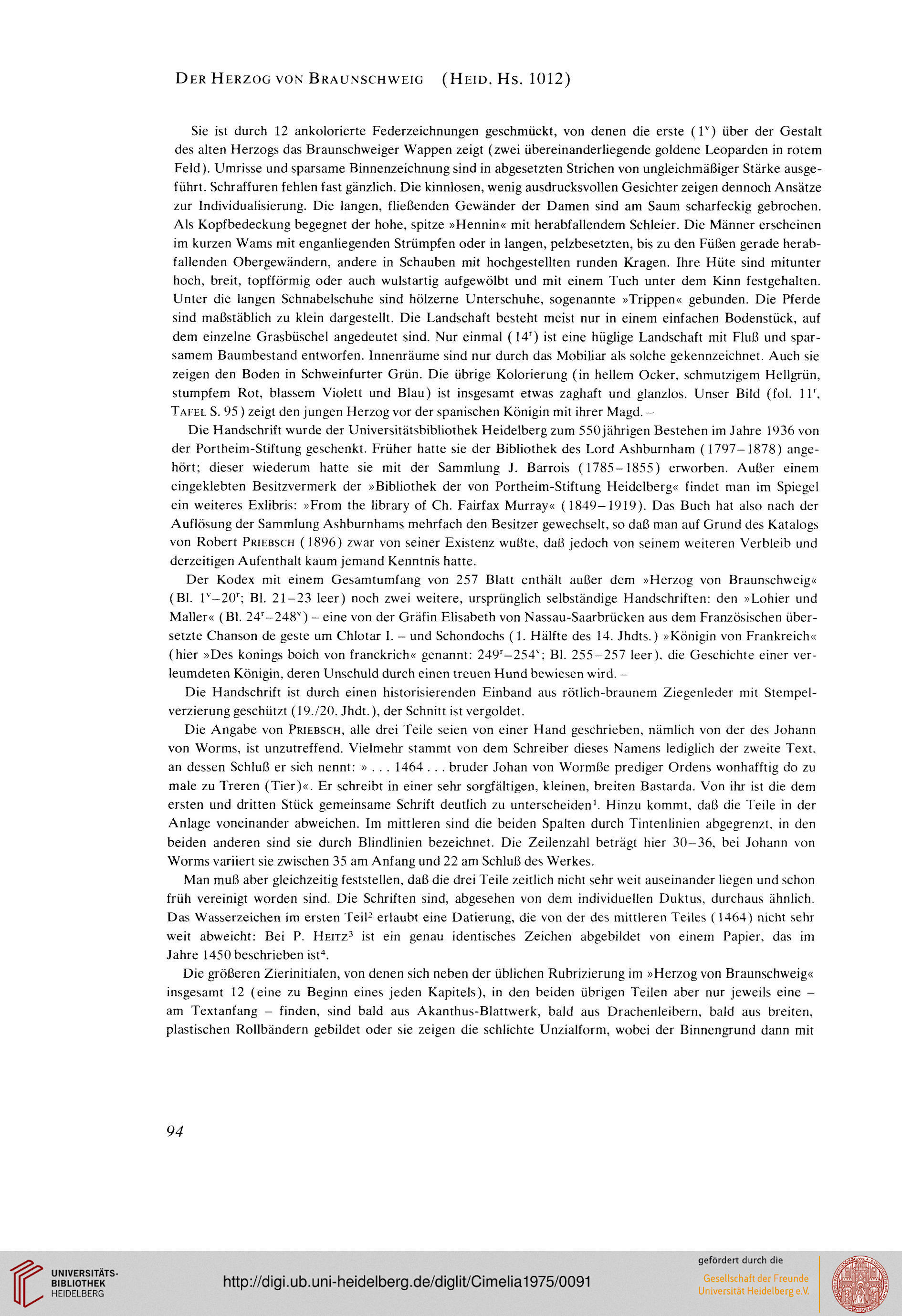Der Herzog von Braunschweig (Heid. Hs. 1012)
Sie ist durch 12 ankolorierte Federzeichnungen geschmückt, von denen die erste (lv) über der Gestalt
des alten Herzogs das Braunschweiger Wappen zeigt (zwei übereinanderliegende goldene Leoparden in rotem
Feld). Umrisse und sparsame Binnenzeichnung sind in abgesetzten Strichen von ungleichmäßiger Stärke ausge-
führt. Sehraffüren fehlen fast gänzlich. Die kinnlosen, wenig ausdrucksvollen Gesichter zeigen dennoch Ansätze
zur Individualisierung. Die langen, fließenden Gewänder der Damen sind am Saum scharfeckig gebrochen.
Als Kopfbedeckung begegnet der hohe, spitze »Hennin« mit herabfallendem Schleier. Die Männer erscheinen
im kurzen Wams mit enganliegenden Strümpfen oder in langen, pelzbesetzten, bis zu den Füßen gerade herab-
fallenden Obergewändern, andere in Schauben mit hochgestellten runden Kragen. Ihre Hüte sind mitunter
hoch, breit, topfförmig oder auch wulstartig aufgewölbt und mit einem Tuch unter dem Kinn festgehalten.
Unter die langen Schnabelschuhe sind hölzerne Unterschuhe, sogenannte »Trippen« gebunden. Die Pferde
sind maßstäblich zu klein dargestellt. Die Landschaft besteht meist nur in einem einfachen Bodenstück, auf
dem einzelne Grasbüschel angedeutet sind. Nur einmal (14r) ist eine hüglige Landschaft mit Fluß und spar-
samem Baumbestand entworfen. Innenräume sind nur durch das Mobiliar als solche gekennzeichnet. Auch sie
zeigen den Boden in Schweinfurter Grün. Die übrige Kolorierung (in hellem Ocker, schmutzigem Hellgrün,
stumpfem Rot, blassem Violett und Blau) ist insgesamt etwas zaghaft und glanzlos. Unser Bild (fol. 1 lr,
Tafel S. 95) zeigt den jungen Herzog vor der spanischen Königin mit ihrer Magd. -
Die Handschrift wurde der Universitätsbibliothek Heidelberg zum 550jährigen Bestehen im Jahre 1936 von
der Portheim-Stiftung geschenkt. Früher hatte sie der Bibliothek des Lord Ashburnham (1797- 1878) ange-
hört; dieser wiederum hatte sie mit der Sammlung J. Barrois (1785-1855) erworben. Außer einem
eingeklebten Besitzvermerk der »Bibliothek der von Portheim-Stiftung Heidelberg« findet man im Spiegel
ein weiteres Exlibris: »From the library of Ch. Fairfax Murray« (1849-1919). Das Buch hat also nach der
Auflösung der Sammlung Ashburnhams mehrfach den Besitzer gewechselt, so daß man auf Grund des Katalogs
von Robert Priebsch (1896) zwar von seiner Existenz wußte, daß jedoch von seinem weiteren Verbleib und
derzeitigen Aufenthalt kaum jemand Kenntnis hatte.
Der Kodex mit einem Gesamtumfang von 257 Blatt enthält außer dem »Herzog von Braunschweig«
(Bl. lv-20r; Bl. 21-23 leer) noch zwei weitere, ursprünglich selbständige Handschriften: den »Lohier und
Maller« (Bl. 24r-248v) - eine von der Gräfin Elisabeth von Nassau-Saarbrücken aus dem Französischen über-
setzte Chanson de geste um Chlotar I. - und Schondochs (1. Hälfte des 14. Jhdts.) »Königin von Frankreich«
(hier »Des konings boieh von franckrich« genannt: 249r-254v; Bl. 255—257 leer), die Geschichte einer ver-
leumdeten Königin, deren Unschuld durch einen treuen Hund bewiesen wird. -
Die Handschrift ist durch einen historisierenden Einband aus rötlich-braunem Ziegenleder mit Stempel-
verzierung geschützt (19./20. Jhdt.), der Schnitt ist vergoldet.
Die Angabe von Priebsch, alle drei Teile seien von einer Hand geschrieben, nämlich von der des Johann
von Worms, ist unzutreffend. Vielmehr stammt von dem Schreiber dieses Namens lediglich der zweite Text,
an dessen Schluß er sich nennt: » . . . 1464 . . . bruder Johan von Wormße prediger Ordens wonhafftig do zu
male zu Treren (Tier)«. Er schreibt in einer sehr sorgfältigen, kleinen, breiten Bastarda. Von ihr ist die dem
ersten und dritten Stück gemeinsame Schrift deutlich zu unterscheiden1. Hinzu kommt, daß die Teile in der
Anlage voneinander abweichen. Im mittleren sind die beiden Spalten durch Tintenlinien abgegrenzt, in den
beiden anderen sind sie durch Blindlinien bezeichnet. Die Zeilenzahl beträgt hier 30-36, bei Johann von
Worms variiert sie zwischen 35 am Anfang und 22 am Schluß des Werkes.
Man muß aber gleichzeitig feststellen, daß die drei Teile zeitlich nicht sehr weit auseinander liegen und schon
früh vereinigt worden sind. Die Schriften sind, abgesehen von dem individuellen Duktus, durchaus ähnlich.
Das Wasserzeichen im ersten Teil2 erlaubt eine Datierung, die von der des mittleren Teiles (1464) nicht sehr
weit abweicht: Bei P. Heitz3 ist ein genau identisches Zeichen abgebildet von einem Papier, das im
Jahre 1450 beschrieben ist4.
Die größeren Zierinitialen, von denen sich neben der üblichen Rubrizierung im »Herzog von Braunschweig«
insgesamt 12 (eine zu Beginn eines jeden Kapitels), in den beiden übrigen Teilen aber nur jeweils eine -
am Textanfang - finden, sind bald aus Akanthus-Blattwerk, bald aus Drachenleibern, bald aus breiten,
plastischen Rollbändern gebildet oder sie zeigen die schlichte Unzialform, wobei der Binnengrund dann mit
94
Sie ist durch 12 ankolorierte Federzeichnungen geschmückt, von denen die erste (lv) über der Gestalt
des alten Herzogs das Braunschweiger Wappen zeigt (zwei übereinanderliegende goldene Leoparden in rotem
Feld). Umrisse und sparsame Binnenzeichnung sind in abgesetzten Strichen von ungleichmäßiger Stärke ausge-
führt. Sehraffüren fehlen fast gänzlich. Die kinnlosen, wenig ausdrucksvollen Gesichter zeigen dennoch Ansätze
zur Individualisierung. Die langen, fließenden Gewänder der Damen sind am Saum scharfeckig gebrochen.
Als Kopfbedeckung begegnet der hohe, spitze »Hennin« mit herabfallendem Schleier. Die Männer erscheinen
im kurzen Wams mit enganliegenden Strümpfen oder in langen, pelzbesetzten, bis zu den Füßen gerade herab-
fallenden Obergewändern, andere in Schauben mit hochgestellten runden Kragen. Ihre Hüte sind mitunter
hoch, breit, topfförmig oder auch wulstartig aufgewölbt und mit einem Tuch unter dem Kinn festgehalten.
Unter die langen Schnabelschuhe sind hölzerne Unterschuhe, sogenannte »Trippen« gebunden. Die Pferde
sind maßstäblich zu klein dargestellt. Die Landschaft besteht meist nur in einem einfachen Bodenstück, auf
dem einzelne Grasbüschel angedeutet sind. Nur einmal (14r) ist eine hüglige Landschaft mit Fluß und spar-
samem Baumbestand entworfen. Innenräume sind nur durch das Mobiliar als solche gekennzeichnet. Auch sie
zeigen den Boden in Schweinfurter Grün. Die übrige Kolorierung (in hellem Ocker, schmutzigem Hellgrün,
stumpfem Rot, blassem Violett und Blau) ist insgesamt etwas zaghaft und glanzlos. Unser Bild (fol. 1 lr,
Tafel S. 95) zeigt den jungen Herzog vor der spanischen Königin mit ihrer Magd. -
Die Handschrift wurde der Universitätsbibliothek Heidelberg zum 550jährigen Bestehen im Jahre 1936 von
der Portheim-Stiftung geschenkt. Früher hatte sie der Bibliothek des Lord Ashburnham (1797- 1878) ange-
hört; dieser wiederum hatte sie mit der Sammlung J. Barrois (1785-1855) erworben. Außer einem
eingeklebten Besitzvermerk der »Bibliothek der von Portheim-Stiftung Heidelberg« findet man im Spiegel
ein weiteres Exlibris: »From the library of Ch. Fairfax Murray« (1849-1919). Das Buch hat also nach der
Auflösung der Sammlung Ashburnhams mehrfach den Besitzer gewechselt, so daß man auf Grund des Katalogs
von Robert Priebsch (1896) zwar von seiner Existenz wußte, daß jedoch von seinem weiteren Verbleib und
derzeitigen Aufenthalt kaum jemand Kenntnis hatte.
Der Kodex mit einem Gesamtumfang von 257 Blatt enthält außer dem »Herzog von Braunschweig«
(Bl. lv-20r; Bl. 21-23 leer) noch zwei weitere, ursprünglich selbständige Handschriften: den »Lohier und
Maller« (Bl. 24r-248v) - eine von der Gräfin Elisabeth von Nassau-Saarbrücken aus dem Französischen über-
setzte Chanson de geste um Chlotar I. - und Schondochs (1. Hälfte des 14. Jhdts.) »Königin von Frankreich«
(hier »Des konings boieh von franckrich« genannt: 249r-254v; Bl. 255—257 leer), die Geschichte einer ver-
leumdeten Königin, deren Unschuld durch einen treuen Hund bewiesen wird. -
Die Handschrift ist durch einen historisierenden Einband aus rötlich-braunem Ziegenleder mit Stempel-
verzierung geschützt (19./20. Jhdt.), der Schnitt ist vergoldet.
Die Angabe von Priebsch, alle drei Teile seien von einer Hand geschrieben, nämlich von der des Johann
von Worms, ist unzutreffend. Vielmehr stammt von dem Schreiber dieses Namens lediglich der zweite Text,
an dessen Schluß er sich nennt: » . . . 1464 . . . bruder Johan von Wormße prediger Ordens wonhafftig do zu
male zu Treren (Tier)«. Er schreibt in einer sehr sorgfältigen, kleinen, breiten Bastarda. Von ihr ist die dem
ersten und dritten Stück gemeinsame Schrift deutlich zu unterscheiden1. Hinzu kommt, daß die Teile in der
Anlage voneinander abweichen. Im mittleren sind die beiden Spalten durch Tintenlinien abgegrenzt, in den
beiden anderen sind sie durch Blindlinien bezeichnet. Die Zeilenzahl beträgt hier 30-36, bei Johann von
Worms variiert sie zwischen 35 am Anfang und 22 am Schluß des Werkes.
Man muß aber gleichzeitig feststellen, daß die drei Teile zeitlich nicht sehr weit auseinander liegen und schon
früh vereinigt worden sind. Die Schriften sind, abgesehen von dem individuellen Duktus, durchaus ähnlich.
Das Wasserzeichen im ersten Teil2 erlaubt eine Datierung, die von der des mittleren Teiles (1464) nicht sehr
weit abweicht: Bei P. Heitz3 ist ein genau identisches Zeichen abgebildet von einem Papier, das im
Jahre 1450 beschrieben ist4.
Die größeren Zierinitialen, von denen sich neben der üblichen Rubrizierung im »Herzog von Braunschweig«
insgesamt 12 (eine zu Beginn eines jeden Kapitels), in den beiden übrigen Teilen aber nur jeweils eine -
am Textanfang - finden, sind bald aus Akanthus-Blattwerk, bald aus Drachenleibern, bald aus breiten,
plastischen Rollbändern gebildet oder sie zeigen die schlichte Unzialform, wobei der Binnengrund dann mit
94