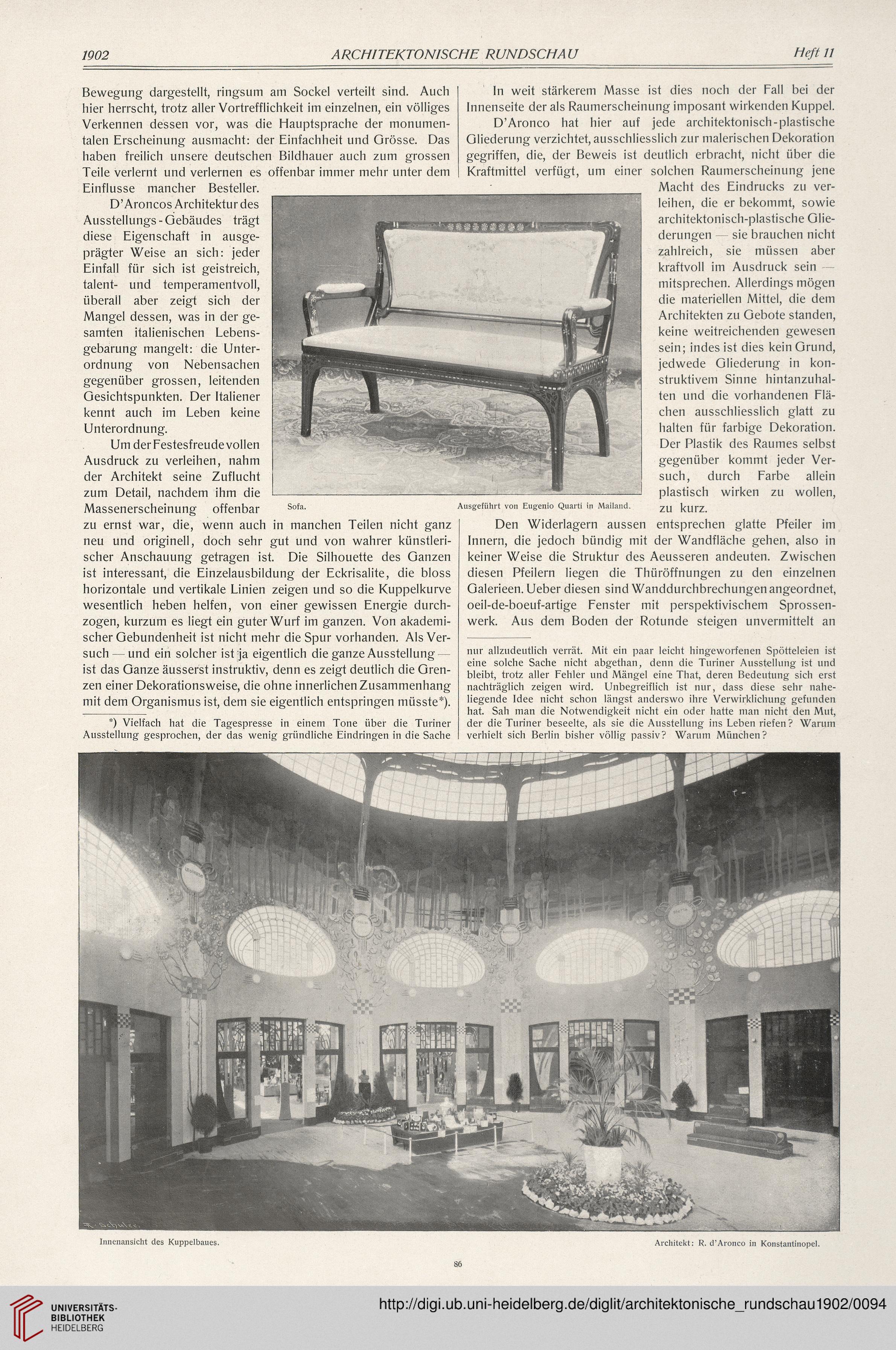1902
ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU
Heft 11
Bewegung dargestellt, ringsum am Sockel verteilt sind. Auch
hier herrscht, trotz aller Vortrefflichkeit im einzelnen, ein völliges
Verkennen dessen vor, was die Hauptsprache der monumen-
talen Erscheinung ausmacht: der Einfachheit und Grösse. Das
haben freilich unsere deutschen Bildhauer auch zum grossen
Teile verlernt und verlernen es offenbar immer mehr unter dem
Einflüsse mancher Besteller.
D’Aroncos Architektur des
Ausstellungs-Gebäudes trägt
diese Eigenschaft in ausge¬
prägter Weise an sich: jeder
Einfall für sich ist geistreich,
talent- und temperamentvoll,
überall aber zeigt sich der
Mangel dessen, was in der ge¬
samten italienischen Lebens¬
gebarung mangelt: die Unter¬
ordnung von Nebensachen
gegenüber grossen, leitenden
Gesichtspunkten. Der Italiener
kennt auch im Leben keine
Unterordnung.
Um der Festesfreude vollen
Ausdruck zu verleihen, nahm
der Architekt seine Zuflucht
zum Detail, nachdem ihm die
Massenerscheinung offenbar
zu ernst war, die, wenn auch in manchen Teilen nicht ganz
neu und originell, doch sehr gut und von wahrer künstleri-
scher Anschauung getragen ist. Die Silhouette des Ganzen
ist interessant, die Einzelausbildung der Eckrisalite, die bloss
horizontale und vertikale Linien zeigen und so die Kuppelkurve
wesentlich heben helfen, von einer gewissen Energie durch-
zogen, kurzum es liegt ein guter Wurf im ganzen. Von akademi-
scher Gebundenheit ist nicht mehr die Spur vorhanden. Als Ver-
such— und ein solcher ist ja eigentlich die ganze Ausstellung —
ist das Ganze äusserst instruktiv, denn es zeigt deutlich die Gren-
zen einer Dekorationsweise, die ohne innerlichen Zusammenhang
mit dem Organismus ist, dem sie eigentlich entspringen müsste*).
*) Vielfach hat die Tagespresse in einem Tone über die Turiner
Ausstellung gesprochen, der das wenig gründliche Eindringen in die Sache
In weit stärkerem Masse ist dies noch der Fall bei der
Innenseite der als Raumerscheinung imposant wirkenden Kuppel.
D’Aronco hat hier auf jede architektonisch-plastische
Gliederung verzichtet, ausschliesslich zur malerischen Dekoration
gegriffen, die, der Beweis ist deutlich erbracht, nicht über die
Kraftmittel verfügt, um einer solchen Raumerscheinung jene
Macht des Eindrucks zu ver-
leihen, die er bekommt, sowie
architektonisch-plastische Glie-
derungen sie brauchen nicht
zahlreich, sie müssen aber
kraftvoll im Ausdruck sein —
mitsprechen. Allerdings mögen
die materiellen Mittel, die dem
Architekten zu Gebote standen,
keine weitreichenden gewesen
sein; indes ist dies kein Grund,
jedwede Gliederung in kon-
struktivem Sinne hintanzuhal-
ten und die vorhandenen Flä-
chen ausschliesslich glatt zu
halten für farbige Dekoration.
Der Plastik des Raumes selbst
gegenüber kommt jeder Ver-
such, durch Farbe allein
plastisch wirken zu wollen,
zu kurz.
Den Widerlagern aussen entsprechen glatte Pfeiler im
Innern, die jedoch bündig mit der Wandfläche gehen, also in
keiner Weise die Struktur des Aeusseren andeuten. Zwischen
diesen Pfeilern liegen die Thüröffnungen zu den einzelnen
Galerieen. Ueber diesen sind Wanddurchbrechungen angeordnet,
oeil-de-boeuf-artige Fenster mit perspektivischem Sprossen-
werk. Aus dem Boden der Rotunde steigen unvermittelt an
nur allzudeutlich verrät. Mit ein paar leicht hingeworfenen Spötteleien ist
eine solche Sache nicht abgethan, denn die Turiner Ausstellung ist und
bleibt, trotz aller Fehler und Mängel eine That, deren Bedeutung sich erst
nachträglich zeigen wird. Unbegreiflich ist nur, dass diese sehr nahe-
liegende Idee nicht schon längst anderswo ihre Verwirklichung gefunden
hat. Sah man die Notwendigkeit nicht ein oder hatte man nicht den Mut,
der die Turiner beseelte, als sie die Ausstellung ins Leben riefen ? Warum
verhielt sich Berlin bisher völlig passiv? Warum München?
Sofa. Ausgeführt von Eugenio Quarti in Mailand.
Innenansicht des Kuppelbaues.
Architekt: R. d’Aronco in Konstantinopel.
86
ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU
Heft 11
Bewegung dargestellt, ringsum am Sockel verteilt sind. Auch
hier herrscht, trotz aller Vortrefflichkeit im einzelnen, ein völliges
Verkennen dessen vor, was die Hauptsprache der monumen-
talen Erscheinung ausmacht: der Einfachheit und Grösse. Das
haben freilich unsere deutschen Bildhauer auch zum grossen
Teile verlernt und verlernen es offenbar immer mehr unter dem
Einflüsse mancher Besteller.
D’Aroncos Architektur des
Ausstellungs-Gebäudes trägt
diese Eigenschaft in ausge¬
prägter Weise an sich: jeder
Einfall für sich ist geistreich,
talent- und temperamentvoll,
überall aber zeigt sich der
Mangel dessen, was in der ge¬
samten italienischen Lebens¬
gebarung mangelt: die Unter¬
ordnung von Nebensachen
gegenüber grossen, leitenden
Gesichtspunkten. Der Italiener
kennt auch im Leben keine
Unterordnung.
Um der Festesfreude vollen
Ausdruck zu verleihen, nahm
der Architekt seine Zuflucht
zum Detail, nachdem ihm die
Massenerscheinung offenbar
zu ernst war, die, wenn auch in manchen Teilen nicht ganz
neu und originell, doch sehr gut und von wahrer künstleri-
scher Anschauung getragen ist. Die Silhouette des Ganzen
ist interessant, die Einzelausbildung der Eckrisalite, die bloss
horizontale und vertikale Linien zeigen und so die Kuppelkurve
wesentlich heben helfen, von einer gewissen Energie durch-
zogen, kurzum es liegt ein guter Wurf im ganzen. Von akademi-
scher Gebundenheit ist nicht mehr die Spur vorhanden. Als Ver-
such— und ein solcher ist ja eigentlich die ganze Ausstellung —
ist das Ganze äusserst instruktiv, denn es zeigt deutlich die Gren-
zen einer Dekorationsweise, die ohne innerlichen Zusammenhang
mit dem Organismus ist, dem sie eigentlich entspringen müsste*).
*) Vielfach hat die Tagespresse in einem Tone über die Turiner
Ausstellung gesprochen, der das wenig gründliche Eindringen in die Sache
In weit stärkerem Masse ist dies noch der Fall bei der
Innenseite der als Raumerscheinung imposant wirkenden Kuppel.
D’Aronco hat hier auf jede architektonisch-plastische
Gliederung verzichtet, ausschliesslich zur malerischen Dekoration
gegriffen, die, der Beweis ist deutlich erbracht, nicht über die
Kraftmittel verfügt, um einer solchen Raumerscheinung jene
Macht des Eindrucks zu ver-
leihen, die er bekommt, sowie
architektonisch-plastische Glie-
derungen sie brauchen nicht
zahlreich, sie müssen aber
kraftvoll im Ausdruck sein —
mitsprechen. Allerdings mögen
die materiellen Mittel, die dem
Architekten zu Gebote standen,
keine weitreichenden gewesen
sein; indes ist dies kein Grund,
jedwede Gliederung in kon-
struktivem Sinne hintanzuhal-
ten und die vorhandenen Flä-
chen ausschliesslich glatt zu
halten für farbige Dekoration.
Der Plastik des Raumes selbst
gegenüber kommt jeder Ver-
such, durch Farbe allein
plastisch wirken zu wollen,
zu kurz.
Den Widerlagern aussen entsprechen glatte Pfeiler im
Innern, die jedoch bündig mit der Wandfläche gehen, also in
keiner Weise die Struktur des Aeusseren andeuten. Zwischen
diesen Pfeilern liegen die Thüröffnungen zu den einzelnen
Galerieen. Ueber diesen sind Wanddurchbrechungen angeordnet,
oeil-de-boeuf-artige Fenster mit perspektivischem Sprossen-
werk. Aus dem Boden der Rotunde steigen unvermittelt an
nur allzudeutlich verrät. Mit ein paar leicht hingeworfenen Spötteleien ist
eine solche Sache nicht abgethan, denn die Turiner Ausstellung ist und
bleibt, trotz aller Fehler und Mängel eine That, deren Bedeutung sich erst
nachträglich zeigen wird. Unbegreiflich ist nur, dass diese sehr nahe-
liegende Idee nicht schon längst anderswo ihre Verwirklichung gefunden
hat. Sah man die Notwendigkeit nicht ein oder hatte man nicht den Mut,
der die Turiner beseelte, als sie die Ausstellung ins Leben riefen ? Warum
verhielt sich Berlin bisher völlig passiv? Warum München?
Sofa. Ausgeführt von Eugenio Quarti in Mailand.
Innenansicht des Kuppelbaues.
Architekt: R. d’Aronco in Konstantinopel.
86