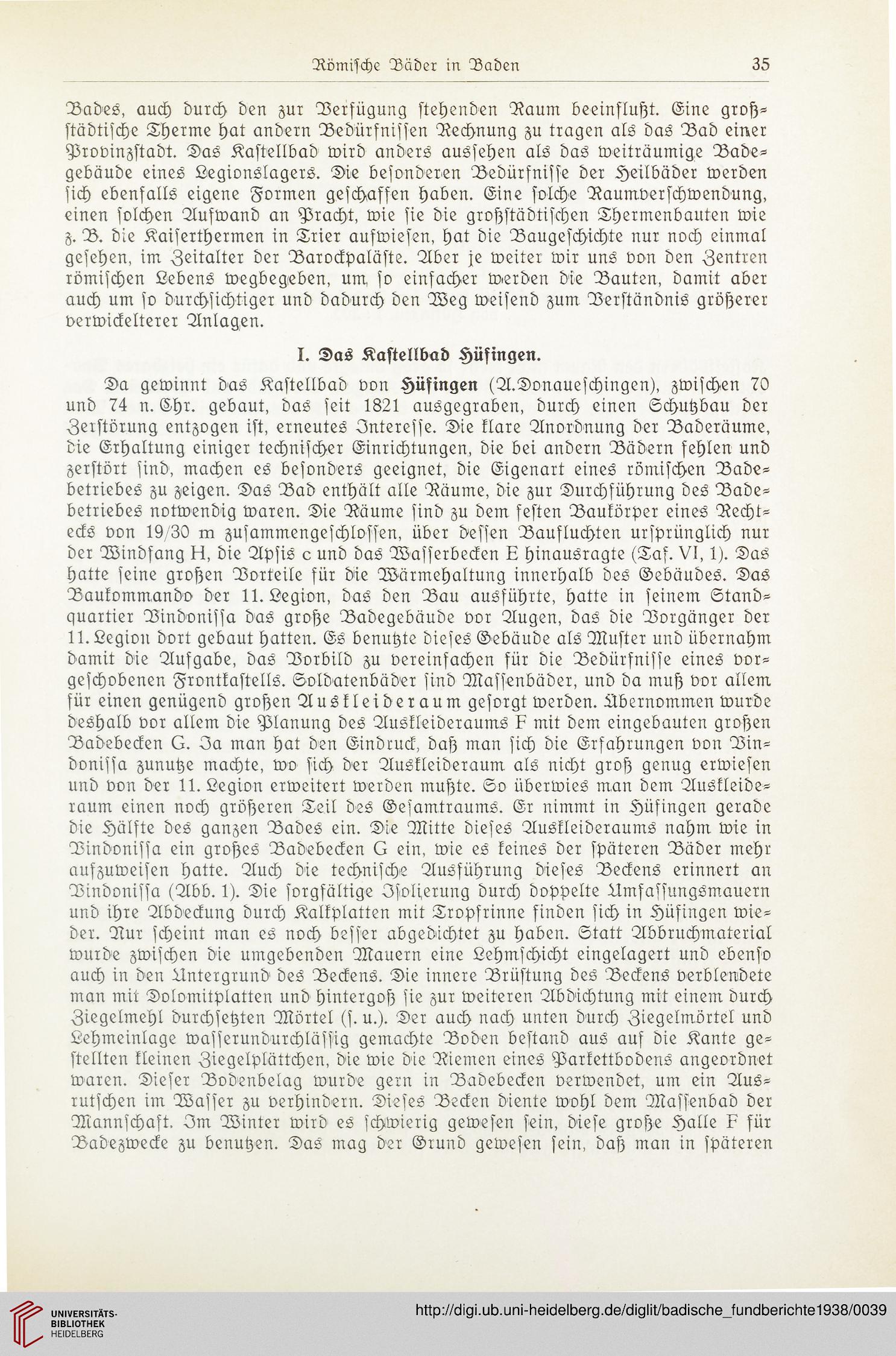Römische Bäder in Baden
35
Bades, auch durch den zur Verfügung stehenden Raum beeinflußt. Eine groß-
städtische Therme hat andern Bedürfniffen Rechnung zu tragen als das Bad einer
Provinzstadt. Das Kastellbad wird anders aussehen als das weiträumige Bade-
gebäude eines Legionslagers. Die besonderen Bedürfnisse der Heilbäder werden
sich ebenfalls eigene Formen geschaffen haben. Eine solche Raumverschwendung,
einen solchen Aufwand an Pracht, wie sie die großstädtischen Thermenbauten wie
z. B. die Kaiserthermen in Trier aufwiesen, hat die Baugefchichte nur noch einmal
gesehen, im Zeitalter der Barockpaläfte. Aber je weiter wir uns von den Zentren
römischen Lebens wegbeg-eben, um, so einfacher werden die Bauten, damit aber
auch um so durchsichtiger und dadurch den Weg weisend zum Verständnis größerer
verwickelterer Anlagen.
I. Das Kastellbad Hüfingen.
Da gewinnt das Kastellbad von Hüfingen (A.Donaueschingen), zwischen 70
und 74 n. Ehr. gebaut, das seit 1821 ausgegraben, durch einen Schutzbau der
Zerstörung entzogen ist, erneutes Interesse. Die klare Anordnung der Baöeräume,
die Erhaltung einiger technischer Einrichtungen, die bei andern Bädern fehlen und
zerstört sind, machen es besonders geeignet, die Eigenart eines römischen Bade-
betriebes zu zeigen. Das Bad enthält alle Räume, die zur Durchführung des Bade-
betriebes notwendig waren. Die Räume sind zu dem festen Baukörper eines Recht-
ecks von 19/30 na zusammengeschlossen, über dessen Baufluchten ursprünglich nur
der Windfang 44, die Apsis c und das Wasserbecken L hinausragte (Tas. VI, 1). Das
hatte seine großen Vorteile für die Wärmehaltung innerhalb des Gebäudes. Das
Baukommando der 11. Legion, das den Bau ausführte, hatte in seinem Stand-
quartier Vindonissa das große Badegebäude vor Augen, das die Vorgänger der
11. Legion dort gebaut hatten. Es benutzte dieses Gebäude als Muster und übernahm
damit die Aufgabe, das Vorbild zu vereinfachen für die Bedürfnisse eines vor-
geschobenen Frontkastells. Soldatenbäder sind Masfenbäder, und da muß vor allem
für einen genügend großen Auskleideraum gesorgt werden. Äbernommen wurde
deshalb vor allem die Planung des Auskleideraums k mit dem eingebauten großen
Badebecken 6. Ia man hat den Eindruck, daß man sich die Erfahrungen von Vin-
donissa zunutze machte, wo sich der Auskleideraum als nicht groß genug erwiesen
und von der 11. Legion erweitert werden mußte. So überwies man dem Auskleide-
raum einen noch größeren Teil des Gesamtraums. Er nimmt in Hüfingen gerade
die Hälfte des ganzen Bades ein. Die Mitte dieses Auskleideraums nahm wie in
Vindonissa ein großes Badebecken O ein, wie es keines der späteren Bäder mehr
aufzuweisen hatte. Auch die technische Ausführung dieses Beckens erinnert an
Vindonissa (Abb. 1). Die sorgfältige Isolierung durch doppelte Umfassungsmauern
und ihre Abdeckung durch Kalkplatten mit Tropfrinne finden sich in Hüfingen wie-
der. Nur scheint man es noch besser abgedichtet zu haben. Statt Abbruchmaterial
wurde zwischen die umgebenden Mauern eine Lehmschicht eingelagert und ebenso
auch in den Hintergrund des Beckens. Die innere Brüstung des Beckens verblendete
man mit Dolomitplatten und hintergoß sie zur weiteren Abdichtung mit einem durch
Ziegelmehl durchsetzten Mörtel (s. u.). Der auch nach unten durch Ziegelmörtel und
Lehmeinlage wasserundurchlässig gemachte Boden bestand aus auf die Kante ge-
stellten kleinen Ziegelplättchen, die wie die Riemen eines Parkettbodens angeordnet
waren. Dieser Bodenbelag wurde gern in Badebecken verwendet, um ein Aus-
rutschen im Wasser zu verhindern. Dieses Becken diente wohl dem Massenbad der
Mannschaft. Im Winter wird es schwierig gewesen fein, diese große Halle ? für
Badezwecke zu benutzen. Das mag der Grund gewesen sein, daß man in späteren
35
Bades, auch durch den zur Verfügung stehenden Raum beeinflußt. Eine groß-
städtische Therme hat andern Bedürfniffen Rechnung zu tragen als das Bad einer
Provinzstadt. Das Kastellbad wird anders aussehen als das weiträumige Bade-
gebäude eines Legionslagers. Die besonderen Bedürfnisse der Heilbäder werden
sich ebenfalls eigene Formen geschaffen haben. Eine solche Raumverschwendung,
einen solchen Aufwand an Pracht, wie sie die großstädtischen Thermenbauten wie
z. B. die Kaiserthermen in Trier aufwiesen, hat die Baugefchichte nur noch einmal
gesehen, im Zeitalter der Barockpaläfte. Aber je weiter wir uns von den Zentren
römischen Lebens wegbeg-eben, um, so einfacher werden die Bauten, damit aber
auch um so durchsichtiger und dadurch den Weg weisend zum Verständnis größerer
verwickelterer Anlagen.
I. Das Kastellbad Hüfingen.
Da gewinnt das Kastellbad von Hüfingen (A.Donaueschingen), zwischen 70
und 74 n. Ehr. gebaut, das seit 1821 ausgegraben, durch einen Schutzbau der
Zerstörung entzogen ist, erneutes Interesse. Die klare Anordnung der Baöeräume,
die Erhaltung einiger technischer Einrichtungen, die bei andern Bädern fehlen und
zerstört sind, machen es besonders geeignet, die Eigenart eines römischen Bade-
betriebes zu zeigen. Das Bad enthält alle Räume, die zur Durchführung des Bade-
betriebes notwendig waren. Die Räume sind zu dem festen Baukörper eines Recht-
ecks von 19/30 na zusammengeschlossen, über dessen Baufluchten ursprünglich nur
der Windfang 44, die Apsis c und das Wasserbecken L hinausragte (Tas. VI, 1). Das
hatte seine großen Vorteile für die Wärmehaltung innerhalb des Gebäudes. Das
Baukommando der 11. Legion, das den Bau ausführte, hatte in seinem Stand-
quartier Vindonissa das große Badegebäude vor Augen, das die Vorgänger der
11. Legion dort gebaut hatten. Es benutzte dieses Gebäude als Muster und übernahm
damit die Aufgabe, das Vorbild zu vereinfachen für die Bedürfnisse eines vor-
geschobenen Frontkastells. Soldatenbäder sind Masfenbäder, und da muß vor allem
für einen genügend großen Auskleideraum gesorgt werden. Äbernommen wurde
deshalb vor allem die Planung des Auskleideraums k mit dem eingebauten großen
Badebecken 6. Ia man hat den Eindruck, daß man sich die Erfahrungen von Vin-
donissa zunutze machte, wo sich der Auskleideraum als nicht groß genug erwiesen
und von der 11. Legion erweitert werden mußte. So überwies man dem Auskleide-
raum einen noch größeren Teil des Gesamtraums. Er nimmt in Hüfingen gerade
die Hälfte des ganzen Bades ein. Die Mitte dieses Auskleideraums nahm wie in
Vindonissa ein großes Badebecken O ein, wie es keines der späteren Bäder mehr
aufzuweisen hatte. Auch die technische Ausführung dieses Beckens erinnert an
Vindonissa (Abb. 1). Die sorgfältige Isolierung durch doppelte Umfassungsmauern
und ihre Abdeckung durch Kalkplatten mit Tropfrinne finden sich in Hüfingen wie-
der. Nur scheint man es noch besser abgedichtet zu haben. Statt Abbruchmaterial
wurde zwischen die umgebenden Mauern eine Lehmschicht eingelagert und ebenso
auch in den Hintergrund des Beckens. Die innere Brüstung des Beckens verblendete
man mit Dolomitplatten und hintergoß sie zur weiteren Abdichtung mit einem durch
Ziegelmehl durchsetzten Mörtel (s. u.). Der auch nach unten durch Ziegelmörtel und
Lehmeinlage wasserundurchlässig gemachte Boden bestand aus auf die Kante ge-
stellten kleinen Ziegelplättchen, die wie die Riemen eines Parkettbodens angeordnet
waren. Dieser Bodenbelag wurde gern in Badebecken verwendet, um ein Aus-
rutschen im Wasser zu verhindern. Dieses Becken diente wohl dem Massenbad der
Mannschaft. Im Winter wird es schwierig gewesen fein, diese große Halle ? für
Badezwecke zu benutzen. Das mag der Grund gewesen sein, daß man in späteren