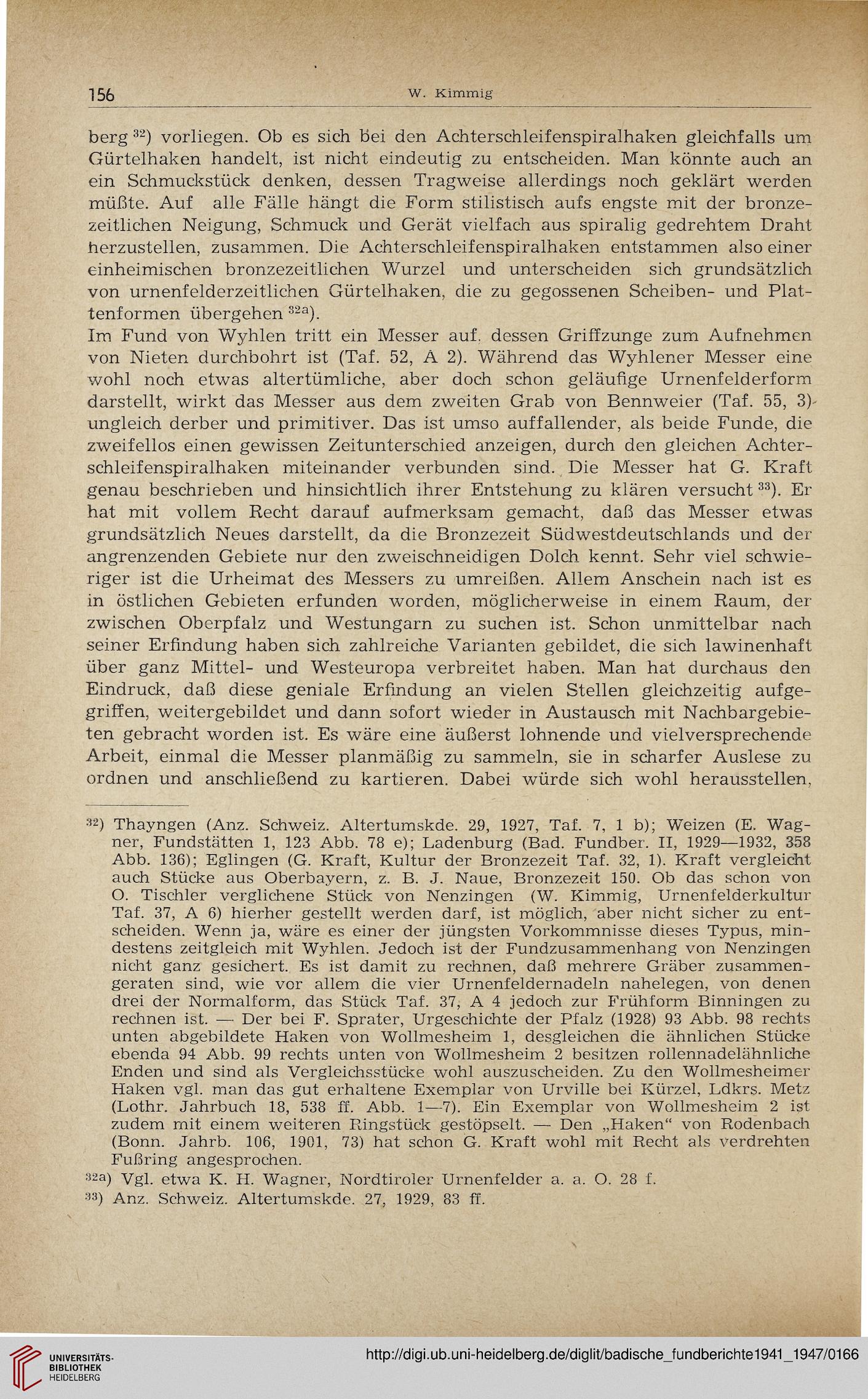156
borg vorllegen. Ob es sich Lei den ^.cktersckleifensplralhaken gleichfalls um
Oürtelhaken bandelt, ist nickt eindeutig 2U entscheiden. Man könnte auch an
ein Lckmuckstück denken, dessen Vragweise allerdings nock geklärt werden
mübte. T^uf alle Ralle bängt dis Rorm stilistisck aufs engste mit der bron^e-
^eitlicken bleigung, Lckmuck und Oerät vielfach aus spiralig gedrehtem Orabt
ber^ustellen, Zusammen. Oie Tkcktersckleifenspiralhaken entstammen also einer
einheimischen bron^e^eitlicken Wurzel und unterscheiden sick grundsätzlich
von urnenkelder^eitlicken Oürtelbaken, die r:u gegossenen Lckeiben- und Rlat-
tenformen übergeben 32s)
Im Rund von Wahlen tritt ein Messer auf. dessen OriK^unge 2um T^ulnebmen
von Meten durchbohrt ist (Vaf. 52, 2). Während das W^blener Messer sine
wobl nock etwas altertümliche, aber dock sckon geläuüge Ornenfelderform
darstellt, wirkt das Messer aus dem Zweiten Orab von Rennweier (lat. 55, 3)
ungleich derber und primitiver. Das ist umso auffallender, als beide Runde, die
Zweifellos einen gewissen Reltuntersckied an^eigen, durck den gleichen ^.ckter-
scklsifenspiralbaken miteinander verbunden sind. Oie Messer bat O. Rraft
genau beschrieben und hinsichtlich ihrer Rntstebung ^u klären versucht 33). Rr
bat mit vollem Reckt darauf aufmerksam gemacht, dab das Messer etwas
grundsätzlich bleues darstellt, da die Rron^e^eit Lüdwestdeutscklands und der
angrenzenden Oebiete nur den Zweischneidigen Oolck kennt. 8ebr viel schwie-
riger ist die Urheimat des Messers 2U umreiben. Ellern Anschein nach ist es
in östlichen Oebieten erfunden worden, möglicherweise in einem Raum, der
Zwischen OberpfaO und Westungarn ^u sucken ist. Lckon unmittelbar nach
seiner Rrklndung haben sich Zahlreiche Varianten gebildet, die sich lawinenbaft
über gan^ Mittel- und Westeuropa verbreitet haben. Man bat durchaus den
Rindruck, dab diese geniale Rründung an vielen Ltellen gleichzeitig aufge-
griffen, weitergebildet und dann sofort wieder in Austausch mit blackbargebie-
ten gebracht worden ist. Rs wäre eine auberst lohnende und vielversprechende
Arbeit, einmal die Messer planmäßig ^u sammeln, sie in sckarfer Auslese ?u
ordnen und ansckliebend 2U kartieren. Dabei würde sick wobl Herausstellen,
32) Rba^ngen (/^N2. Lckweix. Mtertumskde. 29, 1927, Rat. 7, 1 b); Weiten (R. Wag-
ner, Rundstätten 1, 123 2Vbb. 78 e); Radenburg (Rad. Rundber. II, 1929—1932, 358
^.bb. 136); Rglingen (O. Rralt, Rultur der Rron^e^eit Rat. 32, 1). Rraft vergleickt
auck Stücke aus Oberba^ern, R. d. Raue, Rron^e^eit 150. Ob das sckon von
O. Risckler verglichene Stück von blerckngen (V. Rimmig, Ilrnentelderkultur
Rat. 37, 2V 6) hierher gestellt werden darf, ist möglich, aber nickt sicher ?u ent-
scheiden. Wenn )a, wäre es einer der längsten Vorkommnisse dieses 1>pus, min-
destens ^eitgleicb mit Wahlen. dedoch ist der Runckusammenkang von Henningen
nickt gan^ gesickert. Rs ist damit ^u rechnen, daü mehrere Oräber ^usammen-
geraten sind, wie vor allem die vier Ilrnenteldernadeln nabelegen, von denen
drei der blormaltorm, das Stück Rat. 37, 2V 4 )edock ^ur Rrübtorm Rinningen ^u
rechnen ist. — Oer bei R. Sprater, Idrgescbickte der RtaR (1928) 93 Tckb. 98 reckts
unten abgebildete Raken von Wollmesheim 1, desgleichen die ähnlichen Stücke
ebenda 94 ^bb. 99 reckts unten von Wollmesheim 2 besitzen rollennadeläbnlicke
Rnden und sind als Vergleichsstücke wohl ausxusckeiden. Ru den Wollmesheimer
Raken vgl. man das gut erhaltene Rxemplar von Rrville bei Rür^el, Odkrs. Met^
(Ootbr. dabrbuck 18, 538 II. 2Vbb. 1—7). Rin Rxemplar von Wollmesheim 2 ist
rudern mit einem weiteren Ringstück gestöpselt. — Oen „Raken" von Rodenback
(Ronn. dabrb. 106, 1901, 73) bat sckon O. Rratt wobl mit Reckt als verdrehten
Rubring angesprocken.
323) vgl. etwa R. R. Wagner, Rordtiroler Rrnentelder a. a. O. 28 t.
33) /m?. Schwein. Mtertumskde. 27, 1929, 83 R.
borg vorllegen. Ob es sich Lei den ^.cktersckleifensplralhaken gleichfalls um
Oürtelhaken bandelt, ist nickt eindeutig 2U entscheiden. Man könnte auch an
ein Lckmuckstück denken, dessen Vragweise allerdings nock geklärt werden
mübte. T^uf alle Ralle bängt dis Rorm stilistisck aufs engste mit der bron^e-
^eitlicken bleigung, Lckmuck und Oerät vielfach aus spiralig gedrehtem Orabt
ber^ustellen, Zusammen. Oie Tkcktersckleifenspiralhaken entstammen also einer
einheimischen bron^e^eitlicken Wurzel und unterscheiden sick grundsätzlich
von urnenkelder^eitlicken Oürtelbaken, die r:u gegossenen Lckeiben- und Rlat-
tenformen übergeben 32s)
Im Rund von Wahlen tritt ein Messer auf. dessen OriK^unge 2um T^ulnebmen
von Meten durchbohrt ist (Vaf. 52, 2). Während das W^blener Messer sine
wobl nock etwas altertümliche, aber dock sckon geläuüge Ornenfelderform
darstellt, wirkt das Messer aus dem Zweiten Orab von Rennweier (lat. 55, 3)
ungleich derber und primitiver. Das ist umso auffallender, als beide Runde, die
Zweifellos einen gewissen Reltuntersckied an^eigen, durck den gleichen ^.ckter-
scklsifenspiralbaken miteinander verbunden sind. Oie Messer bat O. Rraft
genau beschrieben und hinsichtlich ihrer Rntstebung ^u klären versucht 33). Rr
bat mit vollem Reckt darauf aufmerksam gemacht, dab das Messer etwas
grundsätzlich bleues darstellt, da die Rron^e^eit Lüdwestdeutscklands und der
angrenzenden Oebiete nur den Zweischneidigen Oolck kennt. 8ebr viel schwie-
riger ist die Urheimat des Messers 2U umreiben. Ellern Anschein nach ist es
in östlichen Oebieten erfunden worden, möglicherweise in einem Raum, der
Zwischen OberpfaO und Westungarn ^u sucken ist. Lckon unmittelbar nach
seiner Rrklndung haben sich Zahlreiche Varianten gebildet, die sich lawinenbaft
über gan^ Mittel- und Westeuropa verbreitet haben. Man bat durchaus den
Rindruck, dab diese geniale Rründung an vielen Ltellen gleichzeitig aufge-
griffen, weitergebildet und dann sofort wieder in Austausch mit blackbargebie-
ten gebracht worden ist. Rs wäre eine auberst lohnende und vielversprechende
Arbeit, einmal die Messer planmäßig ^u sammeln, sie in sckarfer Auslese ?u
ordnen und ansckliebend 2U kartieren. Dabei würde sick wobl Herausstellen,
32) Rba^ngen (/^N2. Lckweix. Mtertumskde. 29, 1927, Rat. 7, 1 b); Weiten (R. Wag-
ner, Rundstätten 1, 123 2Vbb. 78 e); Radenburg (Rad. Rundber. II, 1929—1932, 358
^.bb. 136); Rglingen (O. Rralt, Rultur der Rron^e^eit Rat. 32, 1). Rraft vergleickt
auck Stücke aus Oberba^ern, R. d. Raue, Rron^e^eit 150. Ob das sckon von
O. Risckler verglichene Stück von blerckngen (V. Rimmig, Ilrnentelderkultur
Rat. 37, 2V 6) hierher gestellt werden darf, ist möglich, aber nickt sicher ?u ent-
scheiden. Wenn )a, wäre es einer der längsten Vorkommnisse dieses 1>pus, min-
destens ^eitgleicb mit Wahlen. dedoch ist der Runckusammenkang von Henningen
nickt gan^ gesickert. Rs ist damit ^u rechnen, daü mehrere Oräber ^usammen-
geraten sind, wie vor allem die vier Ilrnenteldernadeln nabelegen, von denen
drei der blormaltorm, das Stück Rat. 37, 2V 4 )edock ^ur Rrübtorm Rinningen ^u
rechnen ist. — Oer bei R. Sprater, Idrgescbickte der RtaR (1928) 93 Tckb. 98 reckts
unten abgebildete Raken von Wollmesheim 1, desgleichen die ähnlichen Stücke
ebenda 94 ^bb. 99 reckts unten von Wollmesheim 2 besitzen rollennadeläbnlicke
Rnden und sind als Vergleichsstücke wohl ausxusckeiden. Ru den Wollmesheimer
Raken vgl. man das gut erhaltene Rxemplar von Rrville bei Rür^el, Odkrs. Met^
(Ootbr. dabrbuck 18, 538 II. 2Vbb. 1—7). Rin Rxemplar von Wollmesheim 2 ist
rudern mit einem weiteren Ringstück gestöpselt. — Oen „Raken" von Rodenback
(Ronn. dabrb. 106, 1901, 73) bat sckon O. Rratt wobl mit Reckt als verdrehten
Rubring angesprocken.
323) vgl. etwa R. R. Wagner, Rordtiroler Rrnentelder a. a. O. 28 t.
33) /m?. Schwein. Mtertumskde. 27, 1929, 83 R.